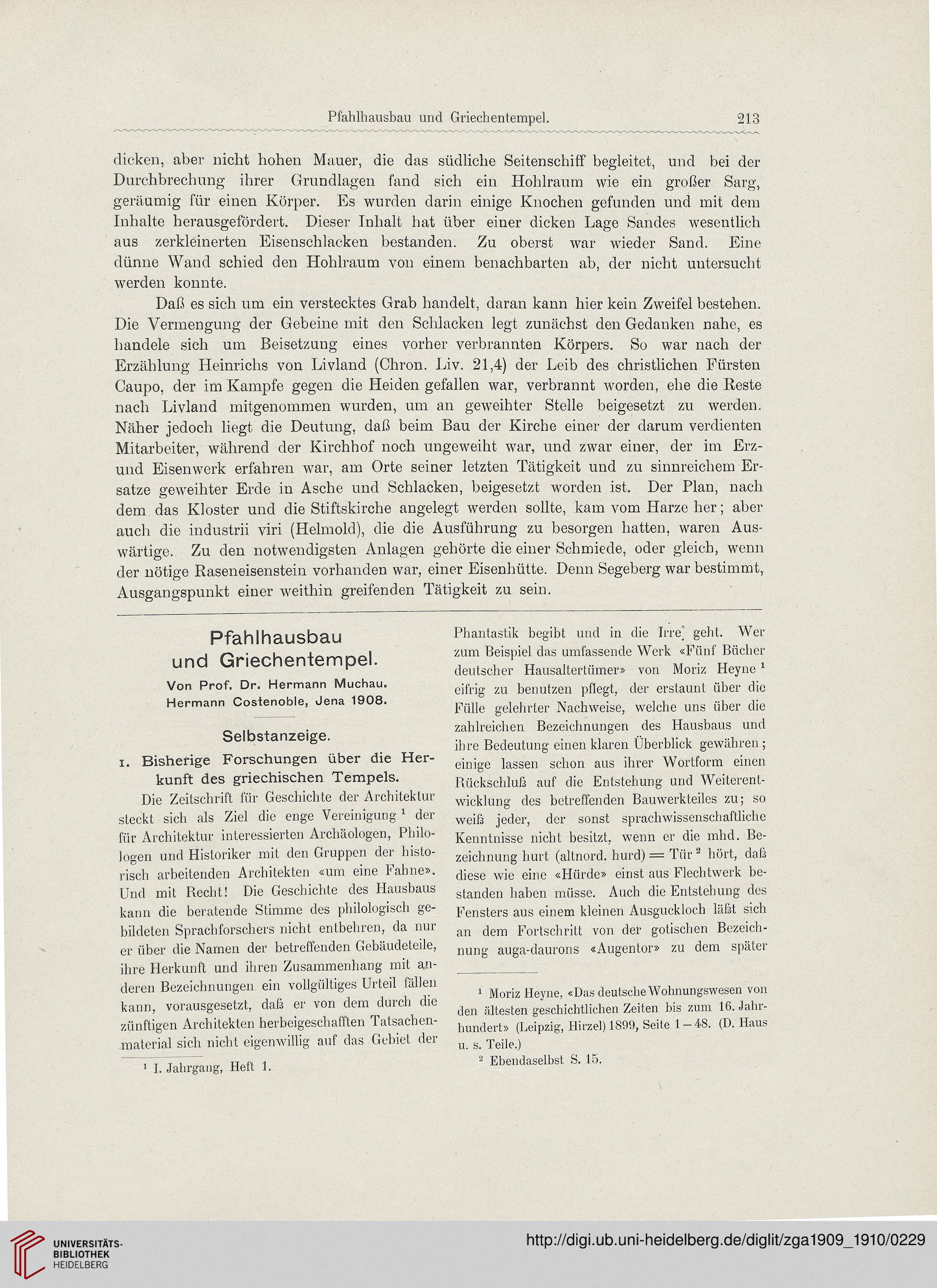Pfahlhausbau und Griechentempel. 213
dicken, aber nicht hohen Mauer, die das südliche Seitenschiff begleitet, und bei der
Durchbrechung ihrer Grundlagen fand sich ein Hohlraum wie ein großer Sarg,
geräumig für einen Körper. Es wurden darin einige Knochen gefunden und mit dem
Inhalte herausgefördert. Dieser Inhalt hat über eiuer dicken Lage Sandes wesentlich
aus zerkleinerten Eisenschlacken bestanden. Zu oberst war wieder Sand. Eine
dünne Wand schied den Hohlraum von einem benachbarten ab, der nicht untersucht
werden konnte.
Daß es sich um ein verstecktes Grab handelt, daran kann hier kein Zweifel bestehen.
Die Vermengung der Gebeine mit den Schlacken legt zunächst den Gedanken nahe, es
handele sich um Beisetzung eines vorher verbrannten Körpers. So war nach der
Erzählung Heinrichs von Livland (Chron. Liv. 21,4) der Leib des christlichen Fürsten
Caupo, der im Kampfe gegen die Heiden gefallen war, verbrannt worden, ehe die Reste
nach Livland mitgenommen wurden, um an geweihter Stelle beigesetzt zu werden.
Näher jedoch liegt die Deutung, daß beim Bau der Kirche einer der darum verdienten
Mitarbeiter, während der Kirchhof noch ungeweiht war, und zwar einer, der im Erz-
und Eisenwerk erfahren war, am Orte seiner letzten Tätigkeit und zu sinnreichem Er-
sätze geweihter Erde in Asche und Schlacken, beigesetzt worden ist. Der Plan, nach
dem das Kloster und die Stiftskirche angelegt werden sollte, kam vom Harze her; aber
auch die industrii viri (Helmold), die die Ausführung zu besorgen hatten, waren Aus-
wärtige. Zu den notwendigsten Anlagen gehörte die einer Schmiede, oder gleich, wenn
der nötige Raseneisenstein vorhanden war, einer Eisenhütte. Denn Segeberg war bestimmt,
Ausgangspunkt einer weithin greifenden Tätigkeit zu sein.
Pfahlhausbau
und Griechentempel.
Von Prof. Dr. Hermann Muchau.
Hermann Costenoble, Jena 1908.
Selbstanzeige,
i. Bisherige Forschungen über die Her-
kunft des griechischen Tempels.
Die Zeitschrift für Geschichte der Architektur
steckt sicli als Ziel die enge Vereinigung 1 der
für Architektur interessierten Archäologen, Philo-
logen und Historiker mit den Gruppen der histo-
risch arbeitenden Architekten «um eine Fahne».
Und mit Recht! Die Geschichte des Hausbaus
kann die beratende Stimme des philologisch ge-
bildeten Sprachforschers nicht entbehren, da nur
er über die Namen der betreffenden Gebäudeteile,
ihre Herkunft und ihren Zusammenhang mit an-
deren Bezeichnungen ein vollgültiges Urteil fällen
kann, vorausgesetzt, daß er von dem durch die
zünftigen Architekten herbeigeschafften Tatsachen-
material sich nicht eigenwillig auf das Gebiet der
1 I. Jahrgang, Hell 1.
Phantastik begibt und in die Irre] geht. Wer
zum Beispiel das umfassende Werk «Fünf Bücher
deutscher Hausaltertümer» von Moriz Heyne 1
eifrig zu benutzen pflegt, der erstaunt über die
Fülle gelehrter Nachweise, welche uns über die
zahlreichen Bezeichnungen des Hausbaus und
ihre Bedeutung einen klaren Überblick gewähren ;
einige lassen schon aus ihrer Wortform einen
Rückschluß auf die Entstehung und Weiterent-
wicklung des betreffenden Bauwerkteiles zu; so
weiß jeder, der sonst sprachwissenschaftliche
Kenntnisse nicht besitzt, wenn er die mhd. Be-
zeichnung hurt (altnord. hurd) = Tür 2 hört, daß
diese wie eine «Hürde» einst aus Flechtwerk be-
standen haben müsse. Auch die Entstehung des
Fensters aus einem kleinen Ausguckloch läßt sich
an dem Fortschritt von der gotischen Bezeich-
nung auga-daurons «Augentor» zu dem später
1 Moriz Heyne, «Das deutsche Wohnungswesen von
den ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahr-
hundert» (Leipzig, Hirzel) 1899, Seite 1-48. (D. Haus
u. s. Teile.)
2 Ebendaselbst S. 15.
dicken, aber nicht hohen Mauer, die das südliche Seitenschiff begleitet, und bei der
Durchbrechung ihrer Grundlagen fand sich ein Hohlraum wie ein großer Sarg,
geräumig für einen Körper. Es wurden darin einige Knochen gefunden und mit dem
Inhalte herausgefördert. Dieser Inhalt hat über eiuer dicken Lage Sandes wesentlich
aus zerkleinerten Eisenschlacken bestanden. Zu oberst war wieder Sand. Eine
dünne Wand schied den Hohlraum von einem benachbarten ab, der nicht untersucht
werden konnte.
Daß es sich um ein verstecktes Grab handelt, daran kann hier kein Zweifel bestehen.
Die Vermengung der Gebeine mit den Schlacken legt zunächst den Gedanken nahe, es
handele sich um Beisetzung eines vorher verbrannten Körpers. So war nach der
Erzählung Heinrichs von Livland (Chron. Liv. 21,4) der Leib des christlichen Fürsten
Caupo, der im Kampfe gegen die Heiden gefallen war, verbrannt worden, ehe die Reste
nach Livland mitgenommen wurden, um an geweihter Stelle beigesetzt zu werden.
Näher jedoch liegt die Deutung, daß beim Bau der Kirche einer der darum verdienten
Mitarbeiter, während der Kirchhof noch ungeweiht war, und zwar einer, der im Erz-
und Eisenwerk erfahren war, am Orte seiner letzten Tätigkeit und zu sinnreichem Er-
sätze geweihter Erde in Asche und Schlacken, beigesetzt worden ist. Der Plan, nach
dem das Kloster und die Stiftskirche angelegt werden sollte, kam vom Harze her; aber
auch die industrii viri (Helmold), die die Ausführung zu besorgen hatten, waren Aus-
wärtige. Zu den notwendigsten Anlagen gehörte die einer Schmiede, oder gleich, wenn
der nötige Raseneisenstein vorhanden war, einer Eisenhütte. Denn Segeberg war bestimmt,
Ausgangspunkt einer weithin greifenden Tätigkeit zu sein.
Pfahlhausbau
und Griechentempel.
Von Prof. Dr. Hermann Muchau.
Hermann Costenoble, Jena 1908.
Selbstanzeige,
i. Bisherige Forschungen über die Her-
kunft des griechischen Tempels.
Die Zeitschrift für Geschichte der Architektur
steckt sicli als Ziel die enge Vereinigung 1 der
für Architektur interessierten Archäologen, Philo-
logen und Historiker mit den Gruppen der histo-
risch arbeitenden Architekten «um eine Fahne».
Und mit Recht! Die Geschichte des Hausbaus
kann die beratende Stimme des philologisch ge-
bildeten Sprachforschers nicht entbehren, da nur
er über die Namen der betreffenden Gebäudeteile,
ihre Herkunft und ihren Zusammenhang mit an-
deren Bezeichnungen ein vollgültiges Urteil fällen
kann, vorausgesetzt, daß er von dem durch die
zünftigen Architekten herbeigeschafften Tatsachen-
material sich nicht eigenwillig auf das Gebiet der
1 I. Jahrgang, Hell 1.
Phantastik begibt und in die Irre] geht. Wer
zum Beispiel das umfassende Werk «Fünf Bücher
deutscher Hausaltertümer» von Moriz Heyne 1
eifrig zu benutzen pflegt, der erstaunt über die
Fülle gelehrter Nachweise, welche uns über die
zahlreichen Bezeichnungen des Hausbaus und
ihre Bedeutung einen klaren Überblick gewähren ;
einige lassen schon aus ihrer Wortform einen
Rückschluß auf die Entstehung und Weiterent-
wicklung des betreffenden Bauwerkteiles zu; so
weiß jeder, der sonst sprachwissenschaftliche
Kenntnisse nicht besitzt, wenn er die mhd. Be-
zeichnung hurt (altnord. hurd) = Tür 2 hört, daß
diese wie eine «Hürde» einst aus Flechtwerk be-
standen haben müsse. Auch die Entstehung des
Fensters aus einem kleinen Ausguckloch läßt sich
an dem Fortschritt von der gotischen Bezeich-
nung auga-daurons «Augentor» zu dem später
1 Moriz Heyne, «Das deutsche Wohnungswesen von
den ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahr-
hundert» (Leipzig, Hirzel) 1899, Seite 1-48. (D. Haus
u. s. Teile.)
2 Ebendaselbst S. 15.