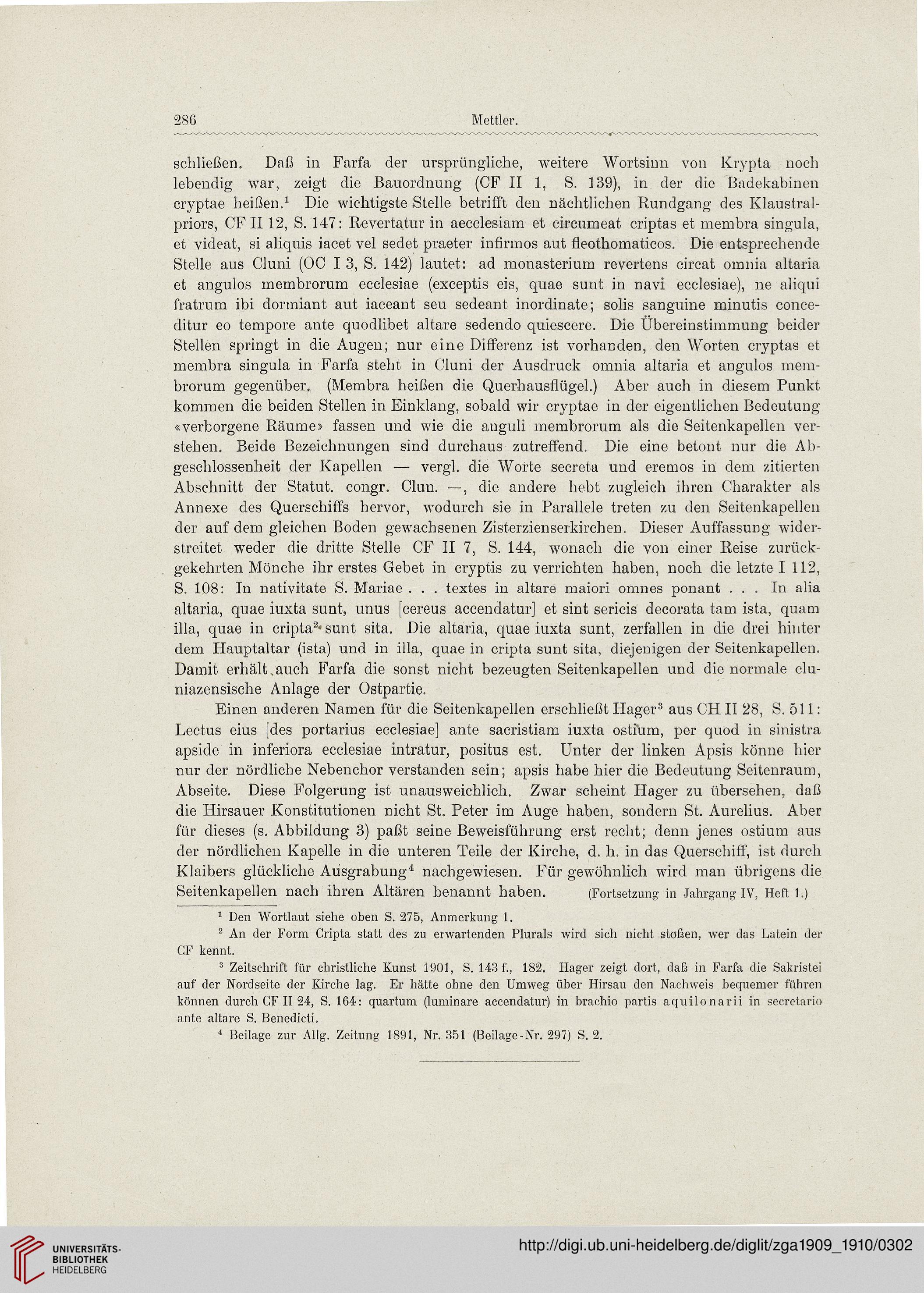Mettler.
schließen. Daß in Farfa der ursprüngliche, weitere Wortsinn von Krypta noch
lebendig war, zeigt die Bauordnung (CF II 1, S. 139), in der die Badekabinen
cryptae heißen.1 Die wichtigste Stelle betrifft den nächtlichen Rundgang des Klaustral-
priors, CF II 12, S. 147: Revertatur in aecclesiam et circumeat criptas et membra singula,
et videat, si aliquis iacet vel sedet praeter infirmos aut fleothomaticos. Die entsprechende
Stelle aus Cluni (OC I 3, S. 142) lautet: ad monasterium revertens circat omnia altaria
et angulos membrorum ecclesiae (exceptis eis, quae sunt in navi ecclesiae), ne aliqui
fratrum ibi dormiant aut iaceant seu sedeant inordinate; solis sanguine minutis conce-
ditur eo tempore ante quodlibet altare sedendo quiescere. Die Übereinstimmung beider
Stellen springt in die Augen; nur eine Differenz ist vorhanden, den Worten cryptas et
membra singula in Farfa steht in Cluni der Ausdruck omnia altaria et angulos mem-
brorum gegenüber. (Membra heißen die Querhausflügel.) Aber auch in diesem Punkt
kommen die beiden Stellen in Einklang, sobald wir cryptae in der eigentlichen Bedeutung
«verborgene Räume» fassen und wie die anguli membrorum als die Seitenkapellen ver-
stehen. Beide Bezeichnungen sind durchaus zutreffend. Die eine betont nur die Ab-
geschlossenheit der Kapellen — vergl. die Worte secreta und eremos in dem zitierten
Abschnitt der Statut, congr. Clun. —, die andere hebt zugleich ihren Charakter als
Annexe des Querschiffs hervor, wodurch sie in Parallele treten zu den Seitenkapellen
der auf dem gleichen Boden gewachsenen Zisterzienserkirchen. Dieser Auffassung wider-
streitet weder die dritte Stelle CF II 7, S. 144, wonach die von einer Reise zurück-
gekehrten Mönche ihr erstes Gebet in cryptis zu verrichten haben, noch die letzte I 112,
S. 108: In nativitate S. Mariae . . . textes in altare maiori omnes ponant ... In alia
altaria, quae iuxta sunt, unus [cereus accendatur] et sint sericis decorata tarn ista, quam
illa, quae in cripta2* sunt sita. Die altaria, quae iuxta sunt, zerfallen in die drei hinter
dem Hauptaltar (ista) und in illa, quae in cripta sunt sita, diejenigen der Seitenkapellen.
Damit erhält,auch Farfa die sonst nicht bezeugten Seitenkapellen und die normale clu-
niazensische Anlage der Ostpartie.
Einen anderen Namen für die Seitenkapellen erschließt Hager3 aus CH II 28, S. 511:
Lectus eius [des portarius ecclesiae] ante sacristiam iuxta ostium, per quod in sinistra
apside in inferiora ecclesiae intratur, positus est. Unter der linken Apsis könne hier
nur der nördliche Nebenchor verstanden sein; apsis habe hier die Bedeutung Seitenraum,
Abseite. Diese Folgerung ist unausweichlich. Zwar scheint Hager zu übersehen, daß
die Hirsauer Konstitutionen nicht St. Peter im Auge haben, sondern St. Aurelius. Aber
für dieses (s. Abbildung 3) paßt seine Beweisführung erst recht; denn jenes ostium aus
der nördlichen Kapelle in die unteren Teile der Kirche, d. h. in das Querschiff, ist durch
Klaihers glückliche Ausgrabung4 nachgewiesen. Für gewöhnlich wird man übrigens die
Seitenkapellen nach ihren Altären benannt haben. (Fortsetzung in Jahrgang IV, Heft 1.)
1 Den Wortlaut siehe oben S. 275, Anmerkung 1.
2 An der Form Cripta statt des zu erwartenden Plurals wird sich nicht stcfaen, wer das Latein der
CF kennt.
3 Zeitschrift für christliche Kunst 1901, S. 143 f., 182. Hager zeigt dort, daß in Farfa die Sakristei
auf der Nordseite der Kirche lag. Er hätte ohne den Umweg über Hirsau den Nachweis bequemer führen
können durch CF II 24, S. 164: quartum (luminare accendatur) in brachio partis aquilonarii in secrctario
ante altare S. Benedicti.
4 Beilage zur Allg. Zeitung 1891, Nr. 351 (Beilage-Nr. 297) S. 2.
schließen. Daß in Farfa der ursprüngliche, weitere Wortsinn von Krypta noch
lebendig war, zeigt die Bauordnung (CF II 1, S. 139), in der die Badekabinen
cryptae heißen.1 Die wichtigste Stelle betrifft den nächtlichen Rundgang des Klaustral-
priors, CF II 12, S. 147: Revertatur in aecclesiam et circumeat criptas et membra singula,
et videat, si aliquis iacet vel sedet praeter infirmos aut fleothomaticos. Die entsprechende
Stelle aus Cluni (OC I 3, S. 142) lautet: ad monasterium revertens circat omnia altaria
et angulos membrorum ecclesiae (exceptis eis, quae sunt in navi ecclesiae), ne aliqui
fratrum ibi dormiant aut iaceant seu sedeant inordinate; solis sanguine minutis conce-
ditur eo tempore ante quodlibet altare sedendo quiescere. Die Übereinstimmung beider
Stellen springt in die Augen; nur eine Differenz ist vorhanden, den Worten cryptas et
membra singula in Farfa steht in Cluni der Ausdruck omnia altaria et angulos mem-
brorum gegenüber. (Membra heißen die Querhausflügel.) Aber auch in diesem Punkt
kommen die beiden Stellen in Einklang, sobald wir cryptae in der eigentlichen Bedeutung
«verborgene Räume» fassen und wie die anguli membrorum als die Seitenkapellen ver-
stehen. Beide Bezeichnungen sind durchaus zutreffend. Die eine betont nur die Ab-
geschlossenheit der Kapellen — vergl. die Worte secreta und eremos in dem zitierten
Abschnitt der Statut, congr. Clun. —, die andere hebt zugleich ihren Charakter als
Annexe des Querschiffs hervor, wodurch sie in Parallele treten zu den Seitenkapellen
der auf dem gleichen Boden gewachsenen Zisterzienserkirchen. Dieser Auffassung wider-
streitet weder die dritte Stelle CF II 7, S. 144, wonach die von einer Reise zurück-
gekehrten Mönche ihr erstes Gebet in cryptis zu verrichten haben, noch die letzte I 112,
S. 108: In nativitate S. Mariae . . . textes in altare maiori omnes ponant ... In alia
altaria, quae iuxta sunt, unus [cereus accendatur] et sint sericis decorata tarn ista, quam
illa, quae in cripta2* sunt sita. Die altaria, quae iuxta sunt, zerfallen in die drei hinter
dem Hauptaltar (ista) und in illa, quae in cripta sunt sita, diejenigen der Seitenkapellen.
Damit erhält,auch Farfa die sonst nicht bezeugten Seitenkapellen und die normale clu-
niazensische Anlage der Ostpartie.
Einen anderen Namen für die Seitenkapellen erschließt Hager3 aus CH II 28, S. 511:
Lectus eius [des portarius ecclesiae] ante sacristiam iuxta ostium, per quod in sinistra
apside in inferiora ecclesiae intratur, positus est. Unter der linken Apsis könne hier
nur der nördliche Nebenchor verstanden sein; apsis habe hier die Bedeutung Seitenraum,
Abseite. Diese Folgerung ist unausweichlich. Zwar scheint Hager zu übersehen, daß
die Hirsauer Konstitutionen nicht St. Peter im Auge haben, sondern St. Aurelius. Aber
für dieses (s. Abbildung 3) paßt seine Beweisführung erst recht; denn jenes ostium aus
der nördlichen Kapelle in die unteren Teile der Kirche, d. h. in das Querschiff, ist durch
Klaihers glückliche Ausgrabung4 nachgewiesen. Für gewöhnlich wird man übrigens die
Seitenkapellen nach ihren Altären benannt haben. (Fortsetzung in Jahrgang IV, Heft 1.)
1 Den Wortlaut siehe oben S. 275, Anmerkung 1.
2 An der Form Cripta statt des zu erwartenden Plurals wird sich nicht stcfaen, wer das Latein der
CF kennt.
3 Zeitschrift für christliche Kunst 1901, S. 143 f., 182. Hager zeigt dort, daß in Farfa die Sakristei
auf der Nordseite der Kirche lag. Er hätte ohne den Umweg über Hirsau den Nachweis bequemer führen
können durch CF II 24, S. 164: quartum (luminare accendatur) in brachio partis aquilonarii in secrctario
ante altare S. Benedicti.
4 Beilage zur Allg. Zeitung 1891, Nr. 351 (Beilage-Nr. 297) S. 2.