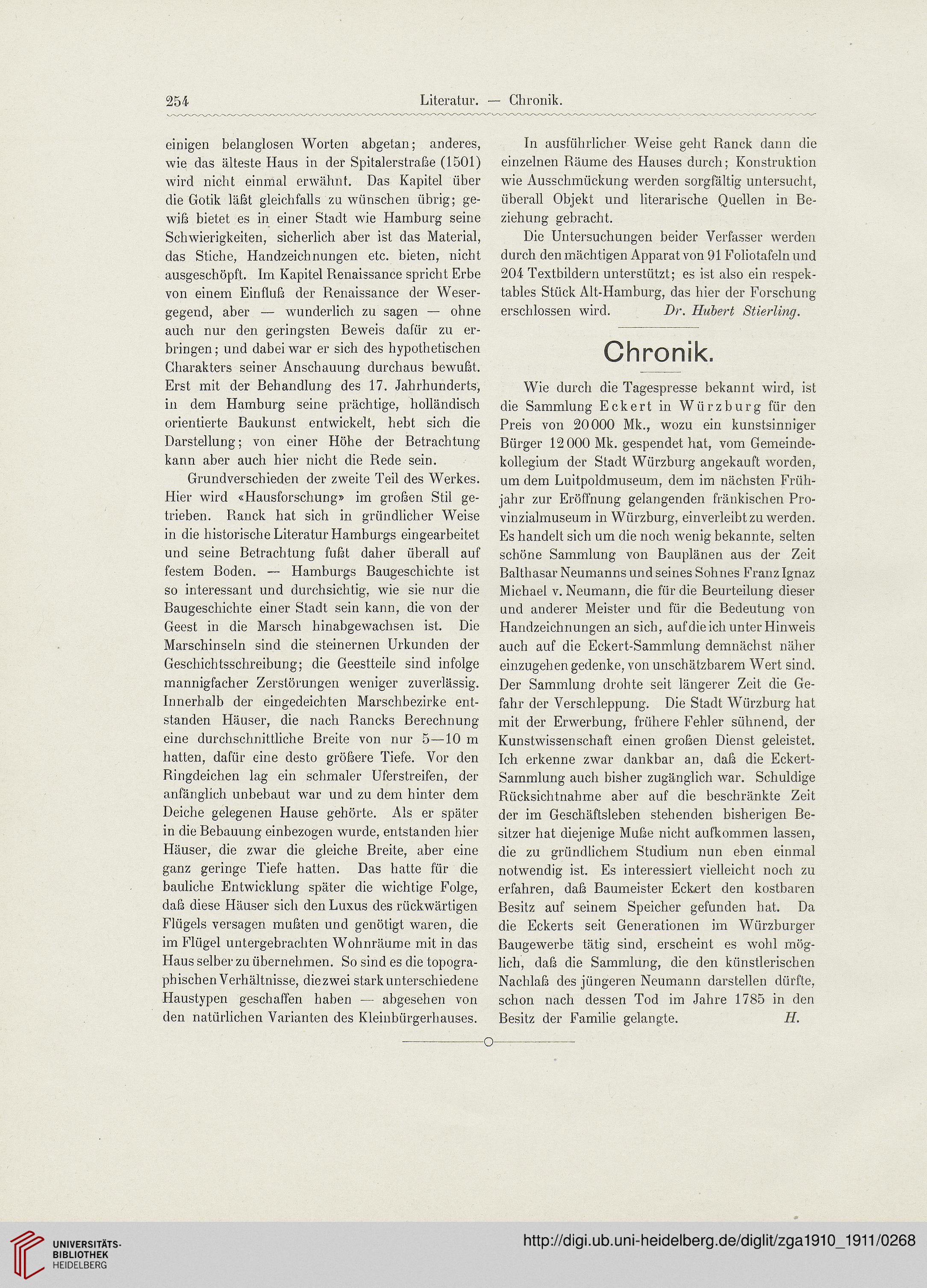254
einigen belanglosen Worten abgetan; anderes,
wie das älteste Haus in der Spitalerstraße (1501)
wird nicht einmal erwähnt. Das Kapitel über
die Gotik läßt gleichfalls zu wünschen übrig; ge-
wiß bietet es in einer Stadt wie Harnburg seine
Schwierigkeiten, sicherlich aber ist das Material,
das Stiche, Handzeichnungen etc. bieten, nicht
ausgeschöpft. Im Kapitel Renaissance spricht Erbe
von einem Einfluß der Renaissance der Weser-
gegend, aber — wunderlich zu sagen — ohne
auch nur den geringsten Beweis dafür zu er-
bringen ; und dabei war er sich des hypothetischen
Charakters seiner Anschauung durchaus bewußt.
Erst mit der Behandlung des 17. Jahrhunderts,
in dem Hamburg seine prächtige, holländisch
orientierte Baukunst entwickelt, hebt sich die
Darstellung; von einer Höhe der Betrachtung
kann aber auch hier nicht die Bede sein.
Grundverschieden der zweite Teil des Werkes.
Hier wird «Hausforschung» im großen Stil ge-
trieben. Ranck hat sich in gründlicher Weise
in die historische Literatur Hamburgs eingearbeitet
und seine Betrachtung fußt daher überall auf
festem Boden. — Hamburgs Baugeschichte ist
so interessant und durchsichtig, wie sie nur die
Baugeschichte einer Stadt sein kann, die von der
Geest in die Marsch hinabgewachsen ist. Die
Marschinseln sind die steinernen Urkunden der
Geschichtsschreibung; die Geestteile sind infolge
mannigfacher Zerstörungen weniger zuverlässig.
Innerhalb der eingedeichten Marschbezirke ent-
standen Häuser, die nach Rancks Berechnung
eine durchschnittliche Breite von nur 5—10 m
hatten, dafür eine desto größere Tiefe. Vor den
Ringdeichen lag ein schmaler Uferstreifen, der
anfänglich unbebaut war und zu dem hinter dem
Deiche gelegenen Hause gehörte. Als er später
in die Bebauung einbezogen wurde, entstanden hier
Häuser, die zwar die gleiche Breite, aber eine
ganz geringe Tiefe hatten. Das hatte für die
bauliche Entwicklung später die wichtige Folge,
daß diese Häuser sich den Luxus des rückwärtigen
Flügels versagen mußten und genötigt waren, die
im Flügel untergebrachten Wohnräume mit in das
Haus selber zu übernehmen. So sind es die topogra-
phischen Verhältnisse, die zwei stark unterschiedene
Haustypen geschaffen haben — abgesehen von
den natürlichen Varianten des Kleinbürgerhauses.
In ausführlicher Weise geht Banck dann die
einzelnen Bäume des Hauses durch; Konstruktion
wie Ausschmückung werden sorgfältig untersucht,
überall Objekt und literarische Quellen in Be-
ziehung gebracht.
Die Untersuchungen beider Verfasser werden
durch den mächtigen Apparat von 91 Foliotafeln und
204 Textbildern unterstützt; es ist also ein respek-
tables Stück Alt-Hamburg, das hier der Forschung
erschlossen wird. Dr. Hubert Stierling.
Chronik.
Wie durch die Tagespresse bekannt wird, ist
die Sammlung Eckert in Würzburg für den
Preis von 20000 Mk., wozu ein kunstsinniger
Bürger 12 000 Mk. gespendet hat, vom Gemeinde-
kollegium der Stadt Würzburg angekauft worden,
um dem Luitpoldmuseum, dem im nächsten Früh-
jahr zur Eröffnung gelangenden fränkischen Pro-
vinzialmuseum in Würzburg, einverleibt zu werden.
Es handelt sich um die noch wenig bekannte, selten
schöne Sammlung von Bauplänen aus der Zeit
Balthasar Neumanns und seines Sohnes Franz Ignaz
Michael v. Neumann, die für die Beurteilung dieser
und anderer Meister und für die Bedeutung von
Handzeichnungen an sich, auf die ich unter Hinweis
auch auf die Eckert-Sammlung demnächst näher
einzugehen gedenke, von unschätzbarem Wert sind.
Der Sammlung drohte seit längerer Zeit die Ge-
fahr der Verschleppung. Die Stadt Würzburg hat
mit der Erwerbung, frühere Fehler sühnend, der
Kunstwissenschaft einen großen Dienst geleistet.
Ich erkenne zwar dankbar an, daß die Eckert-
Sammlung auch bisher zugänglich war. Schuldige
Bücksichtnahme aber auf die beschränkte Zeit
der im Geschäftsleben stehenden bisherigen Be-
sitzer hat diejenige Muße nicht aufkommen lassen,
die zu gründlichem Studium nun eben einmal
notwendig ist. Es interessiert vielleicht noch zu
erfahren, daß Baumeister Eckert den kostbaren
Besitz auf seinem Speicher gefunden hat. Da
die Eckerts seit Generationen im Würzburger
Baugewerbe tätig sind, erscheint es wohl mög-
lich, daß die Sammlung, die den künstlerischen
Nachlaß des jüngeren Neumann darstellen dürfte,
schon nach dessen Tod im Jahre 1785 in den
Besitz der Familie gelangte. H.
einigen belanglosen Worten abgetan; anderes,
wie das älteste Haus in der Spitalerstraße (1501)
wird nicht einmal erwähnt. Das Kapitel über
die Gotik läßt gleichfalls zu wünschen übrig; ge-
wiß bietet es in einer Stadt wie Harnburg seine
Schwierigkeiten, sicherlich aber ist das Material,
das Stiche, Handzeichnungen etc. bieten, nicht
ausgeschöpft. Im Kapitel Renaissance spricht Erbe
von einem Einfluß der Renaissance der Weser-
gegend, aber — wunderlich zu sagen — ohne
auch nur den geringsten Beweis dafür zu er-
bringen ; und dabei war er sich des hypothetischen
Charakters seiner Anschauung durchaus bewußt.
Erst mit der Behandlung des 17. Jahrhunderts,
in dem Hamburg seine prächtige, holländisch
orientierte Baukunst entwickelt, hebt sich die
Darstellung; von einer Höhe der Betrachtung
kann aber auch hier nicht die Bede sein.
Grundverschieden der zweite Teil des Werkes.
Hier wird «Hausforschung» im großen Stil ge-
trieben. Ranck hat sich in gründlicher Weise
in die historische Literatur Hamburgs eingearbeitet
und seine Betrachtung fußt daher überall auf
festem Boden. — Hamburgs Baugeschichte ist
so interessant und durchsichtig, wie sie nur die
Baugeschichte einer Stadt sein kann, die von der
Geest in die Marsch hinabgewachsen ist. Die
Marschinseln sind die steinernen Urkunden der
Geschichtsschreibung; die Geestteile sind infolge
mannigfacher Zerstörungen weniger zuverlässig.
Innerhalb der eingedeichten Marschbezirke ent-
standen Häuser, die nach Rancks Berechnung
eine durchschnittliche Breite von nur 5—10 m
hatten, dafür eine desto größere Tiefe. Vor den
Ringdeichen lag ein schmaler Uferstreifen, der
anfänglich unbebaut war und zu dem hinter dem
Deiche gelegenen Hause gehörte. Als er später
in die Bebauung einbezogen wurde, entstanden hier
Häuser, die zwar die gleiche Breite, aber eine
ganz geringe Tiefe hatten. Das hatte für die
bauliche Entwicklung später die wichtige Folge,
daß diese Häuser sich den Luxus des rückwärtigen
Flügels versagen mußten und genötigt waren, die
im Flügel untergebrachten Wohnräume mit in das
Haus selber zu übernehmen. So sind es die topogra-
phischen Verhältnisse, die zwei stark unterschiedene
Haustypen geschaffen haben — abgesehen von
den natürlichen Varianten des Kleinbürgerhauses.
In ausführlicher Weise geht Banck dann die
einzelnen Bäume des Hauses durch; Konstruktion
wie Ausschmückung werden sorgfältig untersucht,
überall Objekt und literarische Quellen in Be-
ziehung gebracht.
Die Untersuchungen beider Verfasser werden
durch den mächtigen Apparat von 91 Foliotafeln und
204 Textbildern unterstützt; es ist also ein respek-
tables Stück Alt-Hamburg, das hier der Forschung
erschlossen wird. Dr. Hubert Stierling.
Chronik.
Wie durch die Tagespresse bekannt wird, ist
die Sammlung Eckert in Würzburg für den
Preis von 20000 Mk., wozu ein kunstsinniger
Bürger 12 000 Mk. gespendet hat, vom Gemeinde-
kollegium der Stadt Würzburg angekauft worden,
um dem Luitpoldmuseum, dem im nächsten Früh-
jahr zur Eröffnung gelangenden fränkischen Pro-
vinzialmuseum in Würzburg, einverleibt zu werden.
Es handelt sich um die noch wenig bekannte, selten
schöne Sammlung von Bauplänen aus der Zeit
Balthasar Neumanns und seines Sohnes Franz Ignaz
Michael v. Neumann, die für die Beurteilung dieser
und anderer Meister und für die Bedeutung von
Handzeichnungen an sich, auf die ich unter Hinweis
auch auf die Eckert-Sammlung demnächst näher
einzugehen gedenke, von unschätzbarem Wert sind.
Der Sammlung drohte seit längerer Zeit die Ge-
fahr der Verschleppung. Die Stadt Würzburg hat
mit der Erwerbung, frühere Fehler sühnend, der
Kunstwissenschaft einen großen Dienst geleistet.
Ich erkenne zwar dankbar an, daß die Eckert-
Sammlung auch bisher zugänglich war. Schuldige
Bücksichtnahme aber auf die beschränkte Zeit
der im Geschäftsleben stehenden bisherigen Be-
sitzer hat diejenige Muße nicht aufkommen lassen,
die zu gründlichem Studium nun eben einmal
notwendig ist. Es interessiert vielleicht noch zu
erfahren, daß Baumeister Eckert den kostbaren
Besitz auf seinem Speicher gefunden hat. Da
die Eckerts seit Generationen im Würzburger
Baugewerbe tätig sind, erscheint es wohl mög-
lich, daß die Sammlung, die den künstlerischen
Nachlaß des jüngeren Neumann darstellen dürfte,
schon nach dessen Tod im Jahre 1785 in den
Besitz der Familie gelangte. H.