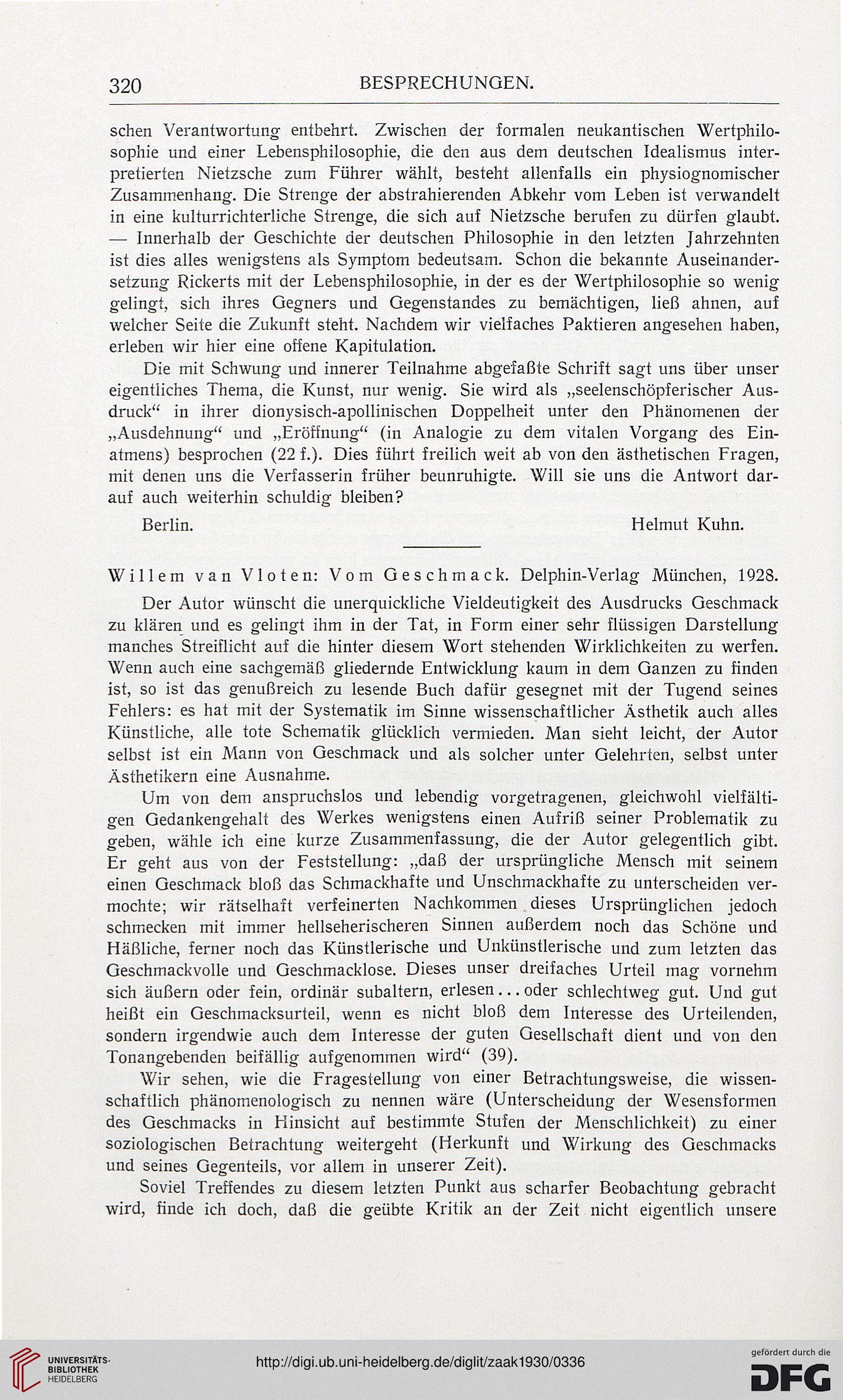320
BESPRECHUNGEN.
sehen Verantwortung- entbehrt. Zwischen der formalen neukantischen Wertphilo-
sophie und einer Lebensphilosophie, die den aus dem deutschen Idealismus inter-
pretierten Nietzsche zum Führer wählt, besteht allenfalls ein physiognomischer
Zusammenhang. Die Strenge der abstrahierenden Abkehr vom Leben ist verwandelt
in eine kulturrichterliche Strenge, die sich auf Nietzsche berufen zu dürfen glaubt.
— Innerhalb der Geschichte der deutschen Philosophie in den letzten Jahrzehnten
ist dies alles wenigstens als Symptom bedeutsam. Schon die bekannte Auseinander-
setzung Rickerts mit der Lebensphilosophie, in der es der Wertphilosophie so wenig
gelingt, sich ihres Gegners und Gegenstandes zu bemächtigen, ließ ahnen, auf
welcher Seite die Zukunft steht. Nachdem wir vielfaches Paktieren angesehen haben,
erleben wir hier eine offene Kapitulation.
Die mit Schwung und innerer Teilnahme abgefaßte Schrift sagt uns über unser
eigentliches Thema, die Kunst, nur wenig. Sie wird als „seelenschöpferischer Aus-
druck" in ihrer dionysisch-apollinischen Doppelheit unter den Phänomenen der
„Ausdehnung" und „Eröffnung" (in Analogie zu dem vitalen Vorgang des Ein-
atmens) besprochen (22 f.). Dies führt freilich weit ab von den ästhetischen Fragen,
mit denen uns die Verfasserin früher beunruhigte. Will sie uns die Antwort dar-
auf auch weiterhin schuldig bleiben?
Berlin. Helmut Kuhn.
Willem van Vloten: Vom Geschmack. Delphin-Verlag München, 1928.
Der Autor wünscht die unerquickliche Vieldeutigkeit des Ausdrucks Geschmack
zu klären und es gelingt ihm in der Tat, in Form einer sehr flüssigen Darstellung
manches Streiflicht auf die hinter diesem Wort stehenden Wirklichkeiten zu werfen.
Wenn auch eine sachgemäß gliedernde Entwicklung kaum in dem Ganzen zu finden
ist, so ist das genußreich zu lesende Buch dafür gesegnet mit der Tugend seines
Fehlers: es hat mit der Systematik im Sinne wissenschaftlicher Ästhetik auch alles
Künstliche, alle tote Schematik glücklich vermieden. Man sieht leicht, der Autor
selbst ist ein Mann von Geschmack und als solcher unter Gelehrten, selbst unter
Ästhetikern eine Ausnahme.
Um von dem anspruchslos und lebendig vorgetragenen, gleichwohl vielfälti-
gen Gedankengehalt des Werkes wenigstens einen Aufriß seiner Problematik zu
geben, wähle ich eine kurze Zusammenfassung, die der Autor gelegentlich gibt.
Er geht aus von der Feststellung: „daß der ursprüngliche Mensch mit seinem
einen Geschmack bloß das Schmackhafte und Unschmackhafte zu unterscheiden ver-
mochte; wir rätselhaft verfeinerten Nachkommen . dieses Ursprünglichen jedoch
schmecken mit immer hellseherischeren Sinnen außerdem noch das Schöne und
Häßliche, ferner noch das Künstlerische und Unkünstlerische und zum letzten das
Geschmackvolle und Geschmacklose. Dieses unser dreifaches Urteil mag vornehm
sich äußern oder fein, ordinär subaltern, erlesen... oder schlechtweg gut. Und gut
heißt ein Geschmacksurteil, wenn es nicht bloß dem Interesse des Urteilenden,
sondern irgendwie auch dem Interesse der guten Gesellschaft dient und von den
Tonangebenden beifällig aufgenommen wird" (39).
Wir sehen, wie die Fragestellung von einer Betrachtungsweise, die wissen-
schaftlich phänomenologisch zu nennen wäre (Unterscheidung der Wesensformen
des Geschmacks in Hinsicht auf bestimmte Stufen der Menschlichkeit) zu einer
soziologischen Betrachtung weitergeht (Herkunft und Wirkung des Geschmacks
und seines Gegenteils, vor allem in unserer Zeit).
Soviel Treffendes zu diesem letzten Punkt aus scharfer Beobachtung gebracht
wird, finde ich doch, daß die geübte Kritik an der Zeit nicht eigentlich unsere
BESPRECHUNGEN.
sehen Verantwortung- entbehrt. Zwischen der formalen neukantischen Wertphilo-
sophie und einer Lebensphilosophie, die den aus dem deutschen Idealismus inter-
pretierten Nietzsche zum Führer wählt, besteht allenfalls ein physiognomischer
Zusammenhang. Die Strenge der abstrahierenden Abkehr vom Leben ist verwandelt
in eine kulturrichterliche Strenge, die sich auf Nietzsche berufen zu dürfen glaubt.
— Innerhalb der Geschichte der deutschen Philosophie in den letzten Jahrzehnten
ist dies alles wenigstens als Symptom bedeutsam. Schon die bekannte Auseinander-
setzung Rickerts mit der Lebensphilosophie, in der es der Wertphilosophie so wenig
gelingt, sich ihres Gegners und Gegenstandes zu bemächtigen, ließ ahnen, auf
welcher Seite die Zukunft steht. Nachdem wir vielfaches Paktieren angesehen haben,
erleben wir hier eine offene Kapitulation.
Die mit Schwung und innerer Teilnahme abgefaßte Schrift sagt uns über unser
eigentliches Thema, die Kunst, nur wenig. Sie wird als „seelenschöpferischer Aus-
druck" in ihrer dionysisch-apollinischen Doppelheit unter den Phänomenen der
„Ausdehnung" und „Eröffnung" (in Analogie zu dem vitalen Vorgang des Ein-
atmens) besprochen (22 f.). Dies führt freilich weit ab von den ästhetischen Fragen,
mit denen uns die Verfasserin früher beunruhigte. Will sie uns die Antwort dar-
auf auch weiterhin schuldig bleiben?
Berlin. Helmut Kuhn.
Willem van Vloten: Vom Geschmack. Delphin-Verlag München, 1928.
Der Autor wünscht die unerquickliche Vieldeutigkeit des Ausdrucks Geschmack
zu klären und es gelingt ihm in der Tat, in Form einer sehr flüssigen Darstellung
manches Streiflicht auf die hinter diesem Wort stehenden Wirklichkeiten zu werfen.
Wenn auch eine sachgemäß gliedernde Entwicklung kaum in dem Ganzen zu finden
ist, so ist das genußreich zu lesende Buch dafür gesegnet mit der Tugend seines
Fehlers: es hat mit der Systematik im Sinne wissenschaftlicher Ästhetik auch alles
Künstliche, alle tote Schematik glücklich vermieden. Man sieht leicht, der Autor
selbst ist ein Mann von Geschmack und als solcher unter Gelehrten, selbst unter
Ästhetikern eine Ausnahme.
Um von dem anspruchslos und lebendig vorgetragenen, gleichwohl vielfälti-
gen Gedankengehalt des Werkes wenigstens einen Aufriß seiner Problematik zu
geben, wähle ich eine kurze Zusammenfassung, die der Autor gelegentlich gibt.
Er geht aus von der Feststellung: „daß der ursprüngliche Mensch mit seinem
einen Geschmack bloß das Schmackhafte und Unschmackhafte zu unterscheiden ver-
mochte; wir rätselhaft verfeinerten Nachkommen . dieses Ursprünglichen jedoch
schmecken mit immer hellseherischeren Sinnen außerdem noch das Schöne und
Häßliche, ferner noch das Künstlerische und Unkünstlerische und zum letzten das
Geschmackvolle und Geschmacklose. Dieses unser dreifaches Urteil mag vornehm
sich äußern oder fein, ordinär subaltern, erlesen... oder schlechtweg gut. Und gut
heißt ein Geschmacksurteil, wenn es nicht bloß dem Interesse des Urteilenden,
sondern irgendwie auch dem Interesse der guten Gesellschaft dient und von den
Tonangebenden beifällig aufgenommen wird" (39).
Wir sehen, wie die Fragestellung von einer Betrachtungsweise, die wissen-
schaftlich phänomenologisch zu nennen wäre (Unterscheidung der Wesensformen
des Geschmacks in Hinsicht auf bestimmte Stufen der Menschlichkeit) zu einer
soziologischen Betrachtung weitergeht (Herkunft und Wirkung des Geschmacks
und seines Gegenteils, vor allem in unserer Zeit).
Soviel Treffendes zu diesem letzten Punkt aus scharfer Beobachtung gebracht
wird, finde ich doch, daß die geübte Kritik an der Zeit nicht eigentlich unsere