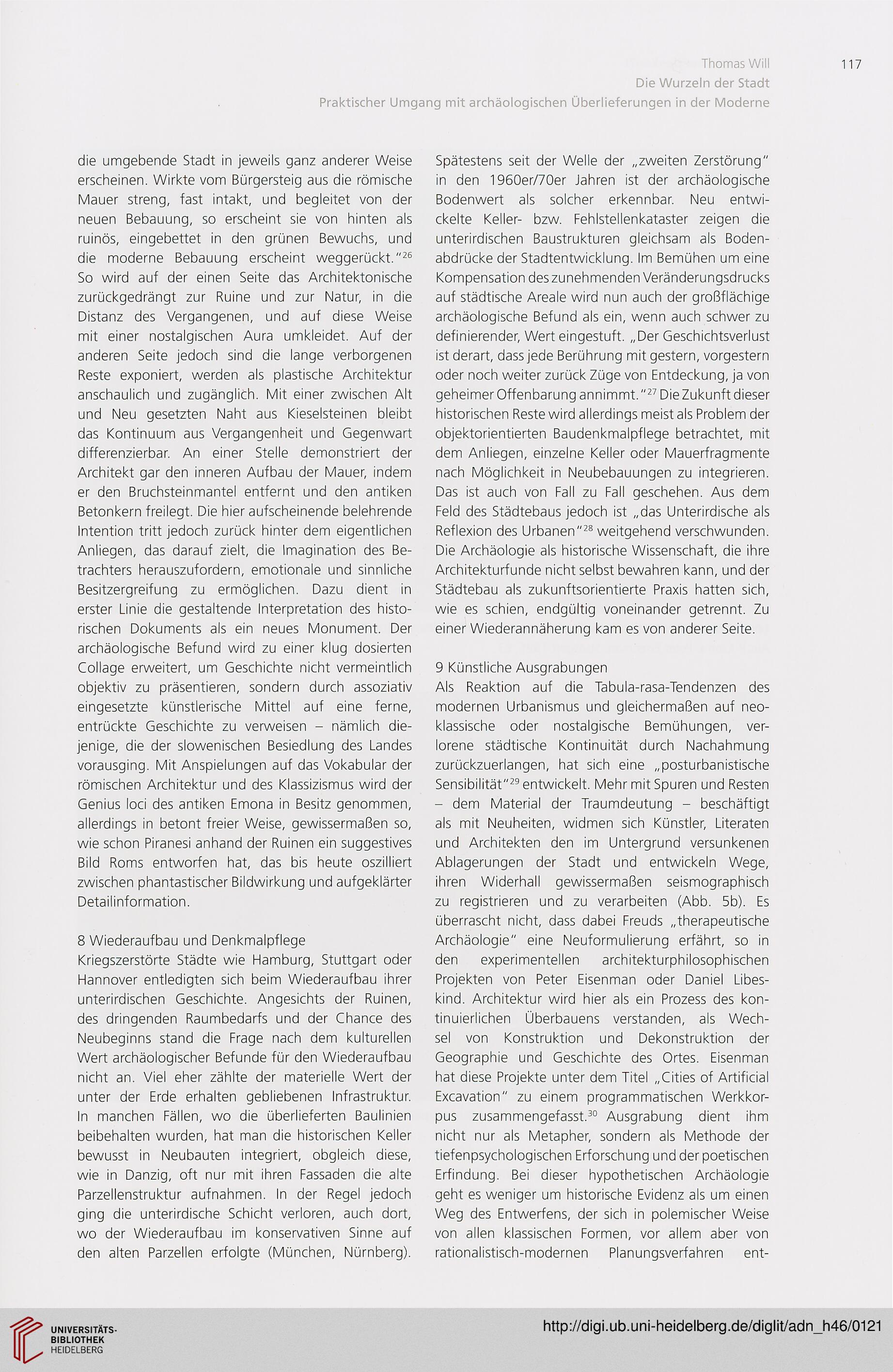Thomas Will
Die Wurzeln der Stadt
Praktischer Umgang mit archäologischen Überlieferungen in der Moderne
die umgebende Stadt in jeweils ganz anderer Weise
erscheinen. Wirkte vom Bürgersteig aus die römische
Mauer streng, fast intakt, und begleitet von der
neuen Bebauung, so erscheint sie von hinten als
ruinös, eingebettet in den grünen Bewuchs, und
die moderne Bebauung erscheint weggerückt."26
So wird auf der einen Seite das Architektonische
zurückgedrängt zur Ruine und zur Natur, in die
Distanz des Vergangenen, und auf diese Weise
mit einer nostalgischen Aura umkleidet. Auf der
anderen Seite jedoch sind die lange verborgenen
Reste exponiert, werden als plastische Architektur
anschaulich und zugänglich. Mit einer zwischen Alt
und Neu gesetzten Naht aus Kieselsteinen bleibt
das Kontinuum aus Vergangenheit und Gegenwart
differenzierbar. An einer Stelle demonstriert der
Architekt gar den inneren Aufbau der Mauer, indem
er den Bruchsteinmantel entfernt und den antiken
Betonkern freilegt. Die hier aufscheinende belehrende
Intention tritt jedoch zurück hinter dem eigentlichen
Anliegen, das darauf zielt, die Imagination des Be-
trachters herauszufordern, emotionale und sinnliche
Besitzergreifung zu ermöglichen. Dazu dient in
erster Linie die gestaltende Interpretation des histo-
rischen Dokuments als ein neues Monument. Der
archäologische Befund wird zu einer klug dosierten
Collage erweitert, um Geschichte nicht vermeintlich
objektiv zu präsentieren, sondern durch assoziativ
eingesetzte künstlerische Mittel auf eine ferne,
entrückte Geschichte zu verweisen - nämlich die-
jenige, die der slowenischen Besiedlung des Landes
vorausging. Mit Anspielungen auf das Vokabular der
römischen Architektur und des Klassizismus wird der
Genius loci des antiken Emona in Besitz genommen,
allerdings in betont freier Weise, gewissermaßen so,
wie schon Piranesi anhand der Ruinen ein suggestives
Bild Roms entworfen hat, das bis heute oszilliert
zwischen phantastischer Bildwirkung und aufgeklärter
Detailinformation.
8 Wiederaufbau und Denkmalpflege
Kriegszerstörte Städte wie Hamburg, Stuttgart oder
Hannover entledigten sich beim Wiederaufbau ihrer
unterirdischen Geschichte. Angesichts der Ruinen,
des dringenden Raumbedarfs und der Chance des
Neubeginns stand die Frage nach dem kulturellen
Wert archäologischer Befunde für den Wiederaufbau
nicht an. Viel eher zählte der materielle Wert der
unter der Erde erhalten gebliebenen Infrastruktur.
In manchen Fällen, wo die überlieferten Baulinien
beibehalten wurden, hat man die historischen Keller
bewusst in Neubauten integriert, obgleich diese,
wie in Danzig, oft nur mit ihren Fassaden die alte
Parzellenstruktur aufnahmen. In der Regel jedoch
ging die unterirdische Schicht verloren, auch dort,
wo der Wiederaufbau im konservativen Sinne auf
den alten Parzellen erfolgte (München, Nürnberg).
Spätestens seit der Welle der „zweiten Zerstörung"
in den 1960er/70er Jahren ist der archäologische
Bodenwert als solcher erkennbar. Neu entwi-
ckelte Keller- bzw. Fehlstellenkataster zeigen die
unterirdischen Baustrukturen gleichsam als Boden-
abdrücke der Stadtentwicklung. Im Bemühen um eine
Kompensation deszunehmenden Veränderungsdrucks
auf städtische Areale wird nun auch der großflächige
archäologische Befund als ein, wenn auch schwer zu
definierender, Wert eingestuft. „Der Geschichtsverlust
ist derart, dass jede Berührung mit gestern, vorgestern
oder noch weiter zurück Züge von Entdeckung, ja von
geheimer Offenbarung annimmt."27 Die Zukunft dieser
historischen Reste wird allerdings meist als Problem der
objektorientierten Baudenkmalpflege betrachtet, mit
dem Anliegen, einzelne Keller oder Mauerfragmente
nach Möglichkeit in Neubebauungen zu integrieren.
Das ist auch von Fall zu Fall geschehen. Aus dem
Feld des Städtebaus jedoch ist „das Unterirdische als
Reflexion des Urbanen"28 weitgehend verschwunden.
Die Archäologie als historische Wissenschaft, die ihre
Architekturfunde nicht selbst bewahren kann, und der
Städtebau als zukunftsorientierte Praxis hatten sich,
wie es schien, endgültig voneinander getrennt. Zu
einer Wiederannäherung kam es von anderer Seite.
9 Künstliche Ausgrabungen
Als Reaktion auf die Tabula-rasa-Tendenzen des
modernen Urbanismus und gleichermaßen auf neo-
klassische oder nostalgische Bemühungen, ver-
lorene städtische Kontinuität durch Nachahmung
zurückzuerlangen, hat sich eine „posturbanistische
Sensibilität"29 entwickelt. Mehr mit Spuren und Resten
- dem Material der Traumdeutung - beschäftigt
als mit Neuheiten, widmen sich Künstler, Literaten
und Architekten den im Untergrund versunkenen
Ablagerungen der Stadt und entwickeln Wege,
ihren Widerhall gewissermaßen seismographisch
zu registrieren und zu verarbeiten (Abb. 5b). Es
überrascht nicht, dass dabei Freuds „therapeutische
Archäologie" eine Neuformulierung erfährt, so in
den experimentellen architekturphilosophischen
Projekten von Peter Eisenman oder Daniel Libes-
kind. Architektur wird hier als ein Prozess des kon-
tinuierlichen Überbauens verstanden, als Wech-
sel von Konstruktion und Dekonstruktion der
Geographie und Geschichte des Ortes. Eisenman
hat diese Projekte unter dem Titel „Cities of Artificial
Excavation" zu einem programmatischen Werkkor-
pus zusammengefasst.30 Ausgrabung dient ihm
nicht nur als Metapher, sondern als Methode der
tiefenpsychologischen Erforschung und der poetischen
Erfindung. Bei dieser hypothetischen Archäologie
geht es weniger um historische Evidenz als um einen
Weg des Entwerfens, der sich in polemischer Weise
von allen klassischen Formen, vor allem aber von
rationalistisch-modernen Planungsverfahren ent-
117
Die Wurzeln der Stadt
Praktischer Umgang mit archäologischen Überlieferungen in der Moderne
die umgebende Stadt in jeweils ganz anderer Weise
erscheinen. Wirkte vom Bürgersteig aus die römische
Mauer streng, fast intakt, und begleitet von der
neuen Bebauung, so erscheint sie von hinten als
ruinös, eingebettet in den grünen Bewuchs, und
die moderne Bebauung erscheint weggerückt."26
So wird auf der einen Seite das Architektonische
zurückgedrängt zur Ruine und zur Natur, in die
Distanz des Vergangenen, und auf diese Weise
mit einer nostalgischen Aura umkleidet. Auf der
anderen Seite jedoch sind die lange verborgenen
Reste exponiert, werden als plastische Architektur
anschaulich und zugänglich. Mit einer zwischen Alt
und Neu gesetzten Naht aus Kieselsteinen bleibt
das Kontinuum aus Vergangenheit und Gegenwart
differenzierbar. An einer Stelle demonstriert der
Architekt gar den inneren Aufbau der Mauer, indem
er den Bruchsteinmantel entfernt und den antiken
Betonkern freilegt. Die hier aufscheinende belehrende
Intention tritt jedoch zurück hinter dem eigentlichen
Anliegen, das darauf zielt, die Imagination des Be-
trachters herauszufordern, emotionale und sinnliche
Besitzergreifung zu ermöglichen. Dazu dient in
erster Linie die gestaltende Interpretation des histo-
rischen Dokuments als ein neues Monument. Der
archäologische Befund wird zu einer klug dosierten
Collage erweitert, um Geschichte nicht vermeintlich
objektiv zu präsentieren, sondern durch assoziativ
eingesetzte künstlerische Mittel auf eine ferne,
entrückte Geschichte zu verweisen - nämlich die-
jenige, die der slowenischen Besiedlung des Landes
vorausging. Mit Anspielungen auf das Vokabular der
römischen Architektur und des Klassizismus wird der
Genius loci des antiken Emona in Besitz genommen,
allerdings in betont freier Weise, gewissermaßen so,
wie schon Piranesi anhand der Ruinen ein suggestives
Bild Roms entworfen hat, das bis heute oszilliert
zwischen phantastischer Bildwirkung und aufgeklärter
Detailinformation.
8 Wiederaufbau und Denkmalpflege
Kriegszerstörte Städte wie Hamburg, Stuttgart oder
Hannover entledigten sich beim Wiederaufbau ihrer
unterirdischen Geschichte. Angesichts der Ruinen,
des dringenden Raumbedarfs und der Chance des
Neubeginns stand die Frage nach dem kulturellen
Wert archäologischer Befunde für den Wiederaufbau
nicht an. Viel eher zählte der materielle Wert der
unter der Erde erhalten gebliebenen Infrastruktur.
In manchen Fällen, wo die überlieferten Baulinien
beibehalten wurden, hat man die historischen Keller
bewusst in Neubauten integriert, obgleich diese,
wie in Danzig, oft nur mit ihren Fassaden die alte
Parzellenstruktur aufnahmen. In der Regel jedoch
ging die unterirdische Schicht verloren, auch dort,
wo der Wiederaufbau im konservativen Sinne auf
den alten Parzellen erfolgte (München, Nürnberg).
Spätestens seit der Welle der „zweiten Zerstörung"
in den 1960er/70er Jahren ist der archäologische
Bodenwert als solcher erkennbar. Neu entwi-
ckelte Keller- bzw. Fehlstellenkataster zeigen die
unterirdischen Baustrukturen gleichsam als Boden-
abdrücke der Stadtentwicklung. Im Bemühen um eine
Kompensation deszunehmenden Veränderungsdrucks
auf städtische Areale wird nun auch der großflächige
archäologische Befund als ein, wenn auch schwer zu
definierender, Wert eingestuft. „Der Geschichtsverlust
ist derart, dass jede Berührung mit gestern, vorgestern
oder noch weiter zurück Züge von Entdeckung, ja von
geheimer Offenbarung annimmt."27 Die Zukunft dieser
historischen Reste wird allerdings meist als Problem der
objektorientierten Baudenkmalpflege betrachtet, mit
dem Anliegen, einzelne Keller oder Mauerfragmente
nach Möglichkeit in Neubebauungen zu integrieren.
Das ist auch von Fall zu Fall geschehen. Aus dem
Feld des Städtebaus jedoch ist „das Unterirdische als
Reflexion des Urbanen"28 weitgehend verschwunden.
Die Archäologie als historische Wissenschaft, die ihre
Architekturfunde nicht selbst bewahren kann, und der
Städtebau als zukunftsorientierte Praxis hatten sich,
wie es schien, endgültig voneinander getrennt. Zu
einer Wiederannäherung kam es von anderer Seite.
9 Künstliche Ausgrabungen
Als Reaktion auf die Tabula-rasa-Tendenzen des
modernen Urbanismus und gleichermaßen auf neo-
klassische oder nostalgische Bemühungen, ver-
lorene städtische Kontinuität durch Nachahmung
zurückzuerlangen, hat sich eine „posturbanistische
Sensibilität"29 entwickelt. Mehr mit Spuren und Resten
- dem Material der Traumdeutung - beschäftigt
als mit Neuheiten, widmen sich Künstler, Literaten
und Architekten den im Untergrund versunkenen
Ablagerungen der Stadt und entwickeln Wege,
ihren Widerhall gewissermaßen seismographisch
zu registrieren und zu verarbeiten (Abb. 5b). Es
überrascht nicht, dass dabei Freuds „therapeutische
Archäologie" eine Neuformulierung erfährt, so in
den experimentellen architekturphilosophischen
Projekten von Peter Eisenman oder Daniel Libes-
kind. Architektur wird hier als ein Prozess des kon-
tinuierlichen Überbauens verstanden, als Wech-
sel von Konstruktion und Dekonstruktion der
Geographie und Geschichte des Ortes. Eisenman
hat diese Projekte unter dem Titel „Cities of Artificial
Excavation" zu einem programmatischen Werkkor-
pus zusammengefasst.30 Ausgrabung dient ihm
nicht nur als Metapher, sondern als Methode der
tiefenpsychologischen Erforschung und der poetischen
Erfindung. Bei dieser hypothetischen Archäologie
geht es weniger um historische Evidenz als um einen
Weg des Entwerfens, der sich in polemischer Weise
von allen klassischen Formen, vor allem aber von
rationalistisch-modernen Planungsverfahren ent-
117