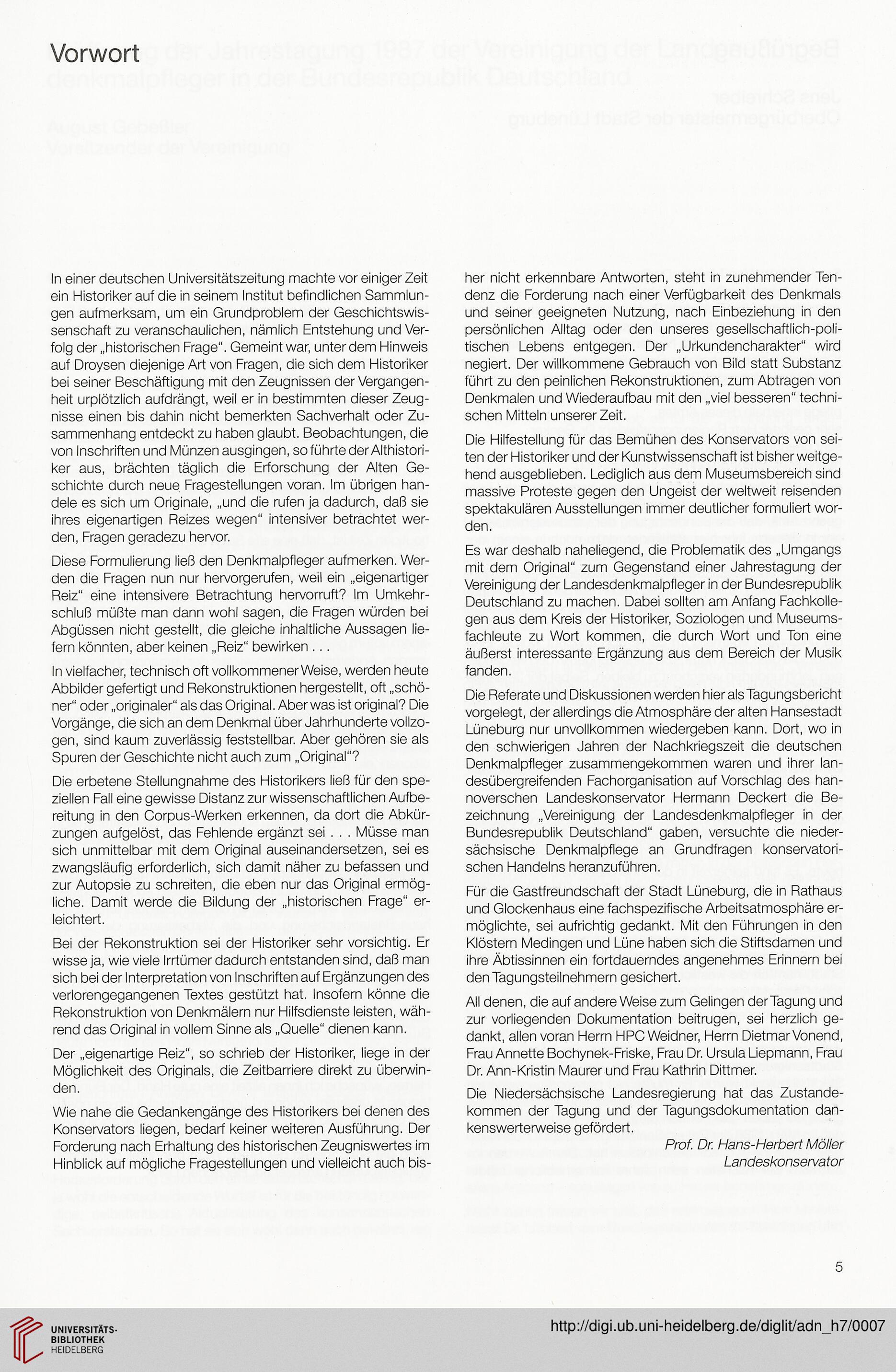Vorwort
In einer deutschen Universitätszeitung machte vor einiger Zeit
ein Historiker auf die in seinem Institut befindlichen Sammlun-
gen aufmerksam, um ein Grundproblem der Geschichtswis-
senschaft zu veranschaulichen, nämlich Entstehung und Ver-
folg der „historischen Frage“. Gemeint war, unter dem Hinweis
auf Droysen diejenige Art von Fragen, die sich dem Historiker
bei seiner Beschäftigung mit den Zeugnissen der Vergangen-
heit urplötzlich aufdrängt, weil er in bestimmten dieser Zeug-
nisse einen bis dahin nicht bemerkten Sachverhalt oder Zu-
sammenhang entdeckt zu haben glaubt. Beobachtungen, die
von Inschriften und Münzen ausgingen, so führte der Althistori-
ker aus, brächten täglich die Erforschung der Alten Ge-
schichte durch neue Fragestellungen voran. Im übrigen han-
dele es sich um Originale, „und die rufen ja dadurch, daß sie
ihres eigenartigen Reizes wegen“ intensiver betrachtet wer-
den, Fragen geradezu hervor.
Diese Formulierung ließ den Denkmalpfleger aufmerken. Wer-
den die Fragen nun nur hervorgerufen, weil ein „eigenartiger
Reiz“ eine intensivere Betrachtung hervorruft? Im Umkehr-
schluß müßte man dann wohl sagen, die Fragen würden bei
Abgüssen nicht gestellt, die gleiche inhaltliche Aussagen lie-
fern könnten, aber keinen „Reiz“ bewirken ...
In vielfacher, technisch oft vollkommener Weise, werden heute
Abbilder gefertigt und Rekonstruktionen hergestellt, oft „schö-
ner“ oder „originaler“ als das Original. Aber was ist original? Die
Vorgänge, die sich an dem Denkmal über Jahrhunderte vollzo-
gen, sind kaum zuverlässig feststellbar. Aber gehören sie als
Spuren der Geschichte nicht auch zum „Original“?
Die erbetene Stellungnahme des Historikers ließ für den spe-
ziellen Fall eine gewisse Distanz zur wissenschaftlichen Aufbe-
reitung in den Corpus-Werken erkennen, da dort die Abkür-
zungen aufgelöst, das Fehlende ergänzt sei . . . Müsse man
sich unmittelbar mit dem Original auseinandersetzen, sei es
zwangsläufig erforderlich, sich damit näher zu befassen und
zur Autopsie zu schreiten, die eben nur das Original ermög-
liche. Damit werde die Bildung der „historischen Frage“ er-
leichtert.
Bei der Rekonstruktion sei der Historiker sehr vorsichtig. Er
wisse ja, wie viele Irrtümer dadurch entstanden sind, daß man
sich bei der Interpretation von Inschriften auf Ergänzungen des
verlorengegangenen Textes gestützt hat. Insofern könne die
Rekonstruktion von Denkmälern nur Hilfsdienste leisten, wäh-
rend das Original in vollem Sinne als „Quelle“ dienen kann.
Der „eigenartige Reiz“, so schrieb der Historiker, liege in der
Möglichkeit des Originals, die Zeitbarriere direkt zu überwin-
den.
Wie nahe die Gedankengänge des Historikers bei denen des
Konservators liegen, bedarf keiner weiteren Ausführung. Der
Forderung nach Erhaltung des historischen Zeugniswertes im
Hinblick auf mögliche Fragestellungen und vielleicht auch bis-
her nicht erkennbare Antworten, steht in zunehmender Ten-
denz die Forderung nach einer Verfügbarkeit des Denkmals
und seiner geeigneten Nutzung, nach Einbeziehung in den
persönlichen Alltag oder den unseres gesellschaftlich-poli-
tischen Lebens entgegen. Der „Urkundencharakter“ wird
negiert. Der willkommene Gebrauch von Bild statt Substanz
führt zu den peinlichen Rekonstruktionen, zum Abtragen von
Denkmalen und Wiederaufbau mit den „viel besseren“ techni-
schen Mitteln unserer Zeit.
Die Hilfestellung für das Bemühen des Konservators von sel-
ten der Historiker und der Kunstwissenschaft ist bisher weitge-
hend ausgeblieben. Lediglich aus dem Museumsbereich sind
massive Proteste gegen den Ungeist der weltweit reisenden
spektakulären Ausstellungen immer deutlicher formuliert wor-
den.
Es war deshalb naheliegend, die Problematik des „Umgangs
mit dem Original" zum Gegenstand einer Jahrestagung der
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland zu machen. Dabei sollten am Anfang Fachkolle-
gen aus dem Kreis der Historiker, Soziologen und Museums-
fachleute zu Wort kommen, die durch Wort und Ton eine
äußerst interessante Ergänzung aus dem Bereich der Musik
fanden.
Die Referate und Diskussionen werden hier als Tagungsbericht
vorgelegt, der allerdings die Atmosphäre der alten Hansestadt
Lüneburg nur unvollkommen wiedergeben kann. Dort, wo in
den schwierigen Jahren der Nachkriegszeit die deutschen
Denkmalpfleger zusammengekommen waren und ihrer lan-
desübergreifenden Fachorganisation auf Vorschlag des han-
noverschen Landeskonservator Hermann Deckert die Be-
zeichnung „Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der
Bundesrepublik Deutschland“ gaben, versuchte die nieder-
sächsische Denkmalpflege an Grundfragen konservatori-
schen Handelns heranzuführen.
Für die Gastfreundschaft der Stadt Lüneburg, die in Rathaus
und Glockenhaus eine fachspezifische Arbeitsatmosphäre er-
möglichte, sei aufrichtig gedankt. Mit den Führungen in den
Klöstern Medingen und Lüne haben sich die Stiftsdamen und
ihre Äbtissinnen ein fortdauerndes angenehmes Erinnern bei
den Tagungsteilnehmern gesichert.
All denen, die auf andere Weise zum Gelingen derTagung und
zur vorliegenden Dokumentation beitrugen, sei herzlich ge-
dankt, allen voran Herrn HPC Weidner, Herrn Dietmar Vonend,
Frau Annette Bochynek-Friske, Frau Dr. Ursula Liepmann, Frau
Dr. Ann-Kristin Maurer und Frau Kathrin Dittmer.
Die Niedersächsische Landesregierung hat das Zustande-
kommen der Tagung und der Tagungsdokumentation dan-
kenswerterweise gefördert.
Prof. Dr. Hans-Herbert Möller
Landeskonservator
5
In einer deutschen Universitätszeitung machte vor einiger Zeit
ein Historiker auf die in seinem Institut befindlichen Sammlun-
gen aufmerksam, um ein Grundproblem der Geschichtswis-
senschaft zu veranschaulichen, nämlich Entstehung und Ver-
folg der „historischen Frage“. Gemeint war, unter dem Hinweis
auf Droysen diejenige Art von Fragen, die sich dem Historiker
bei seiner Beschäftigung mit den Zeugnissen der Vergangen-
heit urplötzlich aufdrängt, weil er in bestimmten dieser Zeug-
nisse einen bis dahin nicht bemerkten Sachverhalt oder Zu-
sammenhang entdeckt zu haben glaubt. Beobachtungen, die
von Inschriften und Münzen ausgingen, so führte der Althistori-
ker aus, brächten täglich die Erforschung der Alten Ge-
schichte durch neue Fragestellungen voran. Im übrigen han-
dele es sich um Originale, „und die rufen ja dadurch, daß sie
ihres eigenartigen Reizes wegen“ intensiver betrachtet wer-
den, Fragen geradezu hervor.
Diese Formulierung ließ den Denkmalpfleger aufmerken. Wer-
den die Fragen nun nur hervorgerufen, weil ein „eigenartiger
Reiz“ eine intensivere Betrachtung hervorruft? Im Umkehr-
schluß müßte man dann wohl sagen, die Fragen würden bei
Abgüssen nicht gestellt, die gleiche inhaltliche Aussagen lie-
fern könnten, aber keinen „Reiz“ bewirken ...
In vielfacher, technisch oft vollkommener Weise, werden heute
Abbilder gefertigt und Rekonstruktionen hergestellt, oft „schö-
ner“ oder „originaler“ als das Original. Aber was ist original? Die
Vorgänge, die sich an dem Denkmal über Jahrhunderte vollzo-
gen, sind kaum zuverlässig feststellbar. Aber gehören sie als
Spuren der Geschichte nicht auch zum „Original“?
Die erbetene Stellungnahme des Historikers ließ für den spe-
ziellen Fall eine gewisse Distanz zur wissenschaftlichen Aufbe-
reitung in den Corpus-Werken erkennen, da dort die Abkür-
zungen aufgelöst, das Fehlende ergänzt sei . . . Müsse man
sich unmittelbar mit dem Original auseinandersetzen, sei es
zwangsläufig erforderlich, sich damit näher zu befassen und
zur Autopsie zu schreiten, die eben nur das Original ermög-
liche. Damit werde die Bildung der „historischen Frage“ er-
leichtert.
Bei der Rekonstruktion sei der Historiker sehr vorsichtig. Er
wisse ja, wie viele Irrtümer dadurch entstanden sind, daß man
sich bei der Interpretation von Inschriften auf Ergänzungen des
verlorengegangenen Textes gestützt hat. Insofern könne die
Rekonstruktion von Denkmälern nur Hilfsdienste leisten, wäh-
rend das Original in vollem Sinne als „Quelle“ dienen kann.
Der „eigenartige Reiz“, so schrieb der Historiker, liege in der
Möglichkeit des Originals, die Zeitbarriere direkt zu überwin-
den.
Wie nahe die Gedankengänge des Historikers bei denen des
Konservators liegen, bedarf keiner weiteren Ausführung. Der
Forderung nach Erhaltung des historischen Zeugniswertes im
Hinblick auf mögliche Fragestellungen und vielleicht auch bis-
her nicht erkennbare Antworten, steht in zunehmender Ten-
denz die Forderung nach einer Verfügbarkeit des Denkmals
und seiner geeigneten Nutzung, nach Einbeziehung in den
persönlichen Alltag oder den unseres gesellschaftlich-poli-
tischen Lebens entgegen. Der „Urkundencharakter“ wird
negiert. Der willkommene Gebrauch von Bild statt Substanz
führt zu den peinlichen Rekonstruktionen, zum Abtragen von
Denkmalen und Wiederaufbau mit den „viel besseren“ techni-
schen Mitteln unserer Zeit.
Die Hilfestellung für das Bemühen des Konservators von sel-
ten der Historiker und der Kunstwissenschaft ist bisher weitge-
hend ausgeblieben. Lediglich aus dem Museumsbereich sind
massive Proteste gegen den Ungeist der weltweit reisenden
spektakulären Ausstellungen immer deutlicher formuliert wor-
den.
Es war deshalb naheliegend, die Problematik des „Umgangs
mit dem Original" zum Gegenstand einer Jahrestagung der
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland zu machen. Dabei sollten am Anfang Fachkolle-
gen aus dem Kreis der Historiker, Soziologen und Museums-
fachleute zu Wort kommen, die durch Wort und Ton eine
äußerst interessante Ergänzung aus dem Bereich der Musik
fanden.
Die Referate und Diskussionen werden hier als Tagungsbericht
vorgelegt, der allerdings die Atmosphäre der alten Hansestadt
Lüneburg nur unvollkommen wiedergeben kann. Dort, wo in
den schwierigen Jahren der Nachkriegszeit die deutschen
Denkmalpfleger zusammengekommen waren und ihrer lan-
desübergreifenden Fachorganisation auf Vorschlag des han-
noverschen Landeskonservator Hermann Deckert die Be-
zeichnung „Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der
Bundesrepublik Deutschland“ gaben, versuchte die nieder-
sächsische Denkmalpflege an Grundfragen konservatori-
schen Handelns heranzuführen.
Für die Gastfreundschaft der Stadt Lüneburg, die in Rathaus
und Glockenhaus eine fachspezifische Arbeitsatmosphäre er-
möglichte, sei aufrichtig gedankt. Mit den Führungen in den
Klöstern Medingen und Lüne haben sich die Stiftsdamen und
ihre Äbtissinnen ein fortdauerndes angenehmes Erinnern bei
den Tagungsteilnehmern gesichert.
All denen, die auf andere Weise zum Gelingen derTagung und
zur vorliegenden Dokumentation beitrugen, sei herzlich ge-
dankt, allen voran Herrn HPC Weidner, Herrn Dietmar Vonend,
Frau Annette Bochynek-Friske, Frau Dr. Ursula Liepmann, Frau
Dr. Ann-Kristin Maurer und Frau Kathrin Dittmer.
Die Niedersächsische Landesregierung hat das Zustande-
kommen der Tagung und der Tagungsdokumentation dan-
kenswerterweise gefördert.
Prof. Dr. Hans-Herbert Möller
Landeskonservator
5