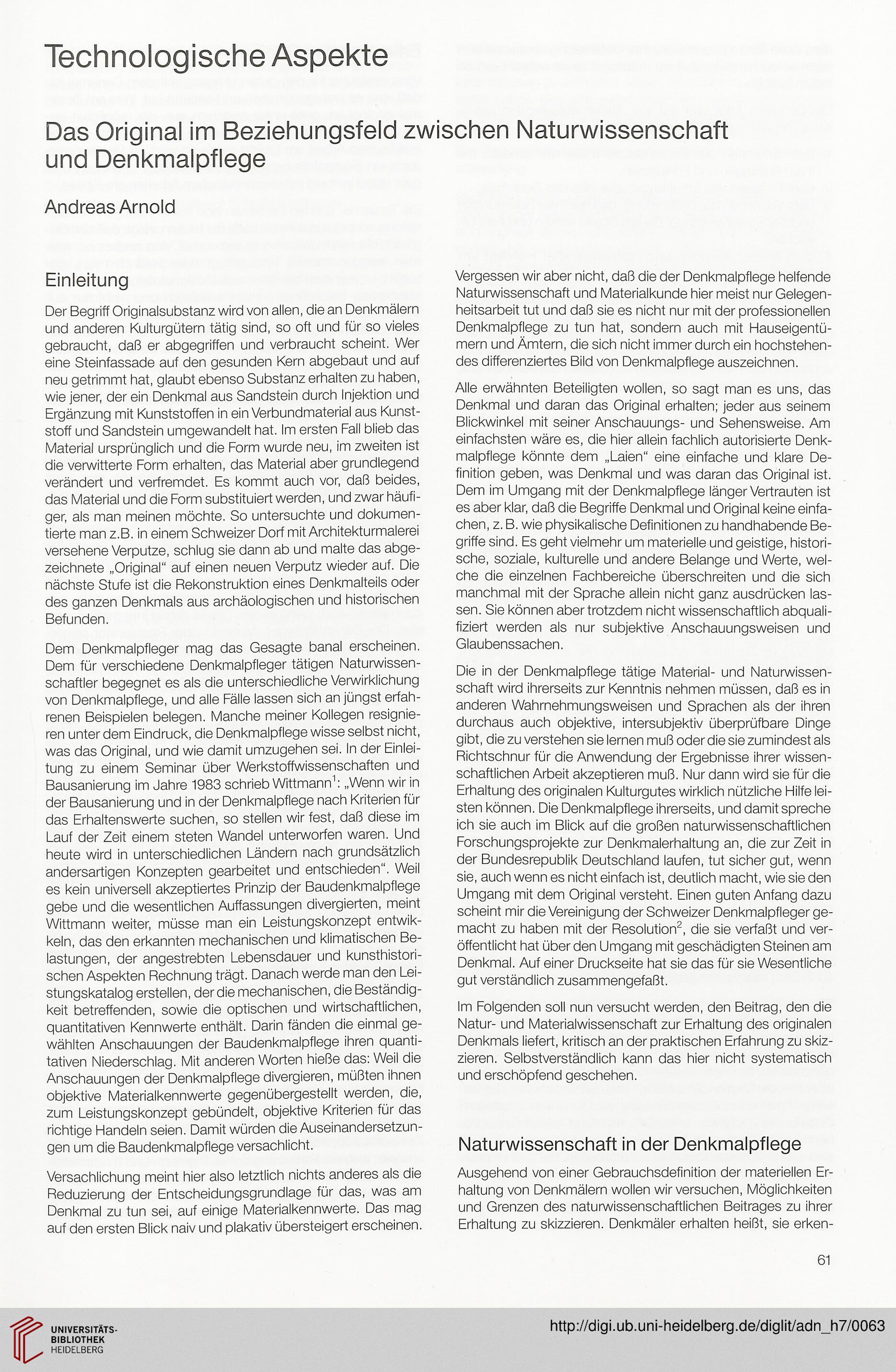Technologische Aspekte
Das Original im Beziehungsfeld zwischen Naturwissenschaft
und Denkmalpflege
Andreas Arnold
Einleitung
Der Begriff Originalsubstanz wird von allen, die an Denkmälern
und anderen Kulturgütern tätig sind, so oft und für so vieles
gebraucht, daß er abgegriffen und verbraucht scheint. Wer
eine Steinfassade auf den gesunden Kern abgebaut und auf
neu getrimmt hat, glaubt ebenso Substanz erhalten zu haben,
wie jener, der ein Denkmal aus Sandstein durch Injektion und
Ergänzung mit Kunststoffen in ein Verbundmaterial aus Kunst-
stoff und Sandstein umgewandelt hat. Im ersten Fall blieb das
Material ursprünglich und die Form wurde neu, im zweiten ist
die verwitterte Form erhalten, das Material aber grundlegend
verändert und verfremdet. Es kommt auch vor, daß beides,
das Material und die Form substituiert werden, und zwar häufi-
ger, als man meinen möchte. So untersuchte und dokumen-
tierte man z.B. in einem Schweizer Dorf mit Architekturmalerei
versehene Verputze, schlug sie dann ab und malte das abge-
zeichnete „Original" auf einen neuen Verputz wieder auf. Die
nächste Stufe ist die Rekonstruktion eines Denkmalteils oder
des ganzen Denkmals aus archäologischen und historischen
Befunden.
Dem Denkmalpfleger mag das Gesagte banal erscheinen.
Dem für verschiedene Denkmalpfleger tätigen Naturwissen-
schaftler begegnet es als die unterschiedliche Verwirklichung
von Denkmalpflege, und alle Fälle lassen sich an jüngst erfah-
renen Beispielen belegen. Manche meiner Kollegen resignie-
ren unter dem Eindruck, die Denkmalpflege wisse selbst nicht,
was das Original, und wie damit umzugehen sei. In der Einlei-
tung zu einem Seminar über Werkstoffwissenschaften und
Bausanierung im Jahre 1983 schrieb Wittmann1: „Wenn wir in
der Bausanierung und in der Denkmalpflege nach Kriterien für
das Erhaltenswerte suchen, so stellen wir fest, daß diese im
Lauf der Zeit einem steten Wandel unterworfen waren. Und
heute wird in unterschiedlichen Ländern nach grundsätzlich
andersartigen Konzepten gearbeitet und entschieden". Weil
es kein universell akzeptiertes Prinzip der Baudenkmalpflege
gebe und die wesentlichen Auffassungen divergierten, meint
Wittmann weiter, müsse man ein Leistungskonzept entwik-
keln, das den erkannten mechanischen und klimatischen Be-
lastungen, der angestrebten Lebensdauer und kunsthistori-
schen Aspekten Rechnung trägt. Danach werde man den Lei-
stungskatalog erstellen, der die mechanischen, die Beständig-
keit betreffenden, sowie die optischen und wirtschaftlichen,
quantitativen Kennwerte enthält. Darin fänden die einmal ge-
wählten Anschauungen der Baudenkmalpflege ihren quanti-
tativen Niederschlag. Mit anderen Worten hieße das: Weil die
Anschauungen der Denkmalpflege divergieren, müßten ihnen
objektive Materialkennwerte gegenübergestellt werden, die,
zum Leistungskonzept gebündelt, objektive Kriterien für das
richtige Handeln seien. Damit würden die Auseinandersetzun-
gen um die Baudenkmalpflege versachlicht.
Versachlichung meint hier also letztlich nichts anderes als die
Reduzierung der Entscheidungsgrundlage für das, was am
Denkmal zu tun sei, auf einige Materialkennwerte. Das mag
auf den ersten Blick naiv und plakativ übersteigert erscheinen.
Vergessen wir aber nicht, daß die der Denkmalpflege helfende
Naturwissenschaft und Materialkunde hier meist nur Gelegen-
heitsarbeit tut und daß sie es nicht nur mit der professionellen
Denkmalpflege zu tun hat, sondern auch mit Hauseigentü-
mern und Ämtern, die sich nicht immer durch ein hochstehen-
des differenziertes Bild von Denkmalpflege auszeichnen.
Alle erwähnten Beteiligten wollen, so sagt man es uns, das
Denkmal und daran das Original erhalten; jeder aus seinem
Blickwinkel mit seiner Anschauungs- und Sehensweise. Am
einfachsten wäre es, die hier allein fachlich autorisierte Denk-
malpflege könnte dem „Laien" eine einfache und klare De-
finition geben, was Denkmal und was daran das Original ist.
Dem im Umgang mit der Denkmalpflege länger Vertrauten ist
es aber klar, daß die Begriffe Denkmal und Original keine einfa-
chen, z. B. wie physikalische Definitionen zu handhabende Be-
griffe sind. Es geht vielmehr um materielle und geistige, histori-
sche, soziale, kulturelle und andere Belange und Werte, wel-
che die einzelnen Fachbereiche überschreiten und die sich
manchmal mit der Sprache allein nicht ganz ausdrücken las-
sen. Sie können aber trotzdem nicht wissenschaftlich abquali-
fiziert werden als nur subjektive Anschauungsweisen und
Glaubenssachen.
Die in der Denkmalpflege tätige Material- und Naturwissen-
schaft wird ihrerseits zur Kenntnis nehmen müssen, daß es in
anderen Wahrnehmungsweisen und Sprachen als der ihren
durchaus auch objektive, intersubjektiv überprüfbare Dinge
gibt, die zu verstehen sie lernen muß oder die sie zumindest als
Richtschnur für die Anwendung der Ergebnisse ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit akzeptieren muß. Nur dann wird sie für die
Erhaltung des originalen Kulturgutes wirklich nützliche Hilfe lei-
sten können. Die Denkmalpflege ihrerseits, und damit spreche
ich sie auch im Blick auf die großen naturwissenschaftlichen
Forschungsprojekte zur Denkmalerhaltung an, die zur Zeit in
der Bundesrepublik Deutschland laufen, tut sicher gut, wenn
sie, auch wenn es nicht einfach ist, deutlich macht, wie sie den
Umgang mit dem Original versteht. Einen guten Anfang dazu
scheint mir die Vereinigung der Schweizer Denkmalpfleger ge-
macht zu haben mit der Resolution2, die sie verfaßt und ver-
öffentlicht hat über den Umgang mit geschädigten Steinen am
Denkmal. Auf einer Druckseite hat sie das für sie Wesentliche
gut verständlich zusammengefaßt.
Im Folgenden soll nun versucht werden, den Beitrag, den die
Natur- und Materialwissenschaft zur Erhaltung des originalen
Denkmals liefert, kritisch an der praktischen Erfahrung zu skiz-
zieren. Selbstverständlich kann das hier nicht systematisch
und erschöpfend geschehen.
Naturwissenschaft in der Denkmalpflege
Ausgehend von einer Gebrauchsdefinition der materiellen Er-
haltung von Denkmälern wollen wir versuchen, Möglichkeiten
und Grenzen des naturwissenschaftlichen Beitrages zu ihrer
Erhaltung zu skizzieren. Denkmäler erhalten heißt, sie erken-
61
Das Original im Beziehungsfeld zwischen Naturwissenschaft
und Denkmalpflege
Andreas Arnold
Einleitung
Der Begriff Originalsubstanz wird von allen, die an Denkmälern
und anderen Kulturgütern tätig sind, so oft und für so vieles
gebraucht, daß er abgegriffen und verbraucht scheint. Wer
eine Steinfassade auf den gesunden Kern abgebaut und auf
neu getrimmt hat, glaubt ebenso Substanz erhalten zu haben,
wie jener, der ein Denkmal aus Sandstein durch Injektion und
Ergänzung mit Kunststoffen in ein Verbundmaterial aus Kunst-
stoff und Sandstein umgewandelt hat. Im ersten Fall blieb das
Material ursprünglich und die Form wurde neu, im zweiten ist
die verwitterte Form erhalten, das Material aber grundlegend
verändert und verfremdet. Es kommt auch vor, daß beides,
das Material und die Form substituiert werden, und zwar häufi-
ger, als man meinen möchte. So untersuchte und dokumen-
tierte man z.B. in einem Schweizer Dorf mit Architekturmalerei
versehene Verputze, schlug sie dann ab und malte das abge-
zeichnete „Original" auf einen neuen Verputz wieder auf. Die
nächste Stufe ist die Rekonstruktion eines Denkmalteils oder
des ganzen Denkmals aus archäologischen und historischen
Befunden.
Dem Denkmalpfleger mag das Gesagte banal erscheinen.
Dem für verschiedene Denkmalpfleger tätigen Naturwissen-
schaftler begegnet es als die unterschiedliche Verwirklichung
von Denkmalpflege, und alle Fälle lassen sich an jüngst erfah-
renen Beispielen belegen. Manche meiner Kollegen resignie-
ren unter dem Eindruck, die Denkmalpflege wisse selbst nicht,
was das Original, und wie damit umzugehen sei. In der Einlei-
tung zu einem Seminar über Werkstoffwissenschaften und
Bausanierung im Jahre 1983 schrieb Wittmann1: „Wenn wir in
der Bausanierung und in der Denkmalpflege nach Kriterien für
das Erhaltenswerte suchen, so stellen wir fest, daß diese im
Lauf der Zeit einem steten Wandel unterworfen waren. Und
heute wird in unterschiedlichen Ländern nach grundsätzlich
andersartigen Konzepten gearbeitet und entschieden". Weil
es kein universell akzeptiertes Prinzip der Baudenkmalpflege
gebe und die wesentlichen Auffassungen divergierten, meint
Wittmann weiter, müsse man ein Leistungskonzept entwik-
keln, das den erkannten mechanischen und klimatischen Be-
lastungen, der angestrebten Lebensdauer und kunsthistori-
schen Aspekten Rechnung trägt. Danach werde man den Lei-
stungskatalog erstellen, der die mechanischen, die Beständig-
keit betreffenden, sowie die optischen und wirtschaftlichen,
quantitativen Kennwerte enthält. Darin fänden die einmal ge-
wählten Anschauungen der Baudenkmalpflege ihren quanti-
tativen Niederschlag. Mit anderen Worten hieße das: Weil die
Anschauungen der Denkmalpflege divergieren, müßten ihnen
objektive Materialkennwerte gegenübergestellt werden, die,
zum Leistungskonzept gebündelt, objektive Kriterien für das
richtige Handeln seien. Damit würden die Auseinandersetzun-
gen um die Baudenkmalpflege versachlicht.
Versachlichung meint hier also letztlich nichts anderes als die
Reduzierung der Entscheidungsgrundlage für das, was am
Denkmal zu tun sei, auf einige Materialkennwerte. Das mag
auf den ersten Blick naiv und plakativ übersteigert erscheinen.
Vergessen wir aber nicht, daß die der Denkmalpflege helfende
Naturwissenschaft und Materialkunde hier meist nur Gelegen-
heitsarbeit tut und daß sie es nicht nur mit der professionellen
Denkmalpflege zu tun hat, sondern auch mit Hauseigentü-
mern und Ämtern, die sich nicht immer durch ein hochstehen-
des differenziertes Bild von Denkmalpflege auszeichnen.
Alle erwähnten Beteiligten wollen, so sagt man es uns, das
Denkmal und daran das Original erhalten; jeder aus seinem
Blickwinkel mit seiner Anschauungs- und Sehensweise. Am
einfachsten wäre es, die hier allein fachlich autorisierte Denk-
malpflege könnte dem „Laien" eine einfache und klare De-
finition geben, was Denkmal und was daran das Original ist.
Dem im Umgang mit der Denkmalpflege länger Vertrauten ist
es aber klar, daß die Begriffe Denkmal und Original keine einfa-
chen, z. B. wie physikalische Definitionen zu handhabende Be-
griffe sind. Es geht vielmehr um materielle und geistige, histori-
sche, soziale, kulturelle und andere Belange und Werte, wel-
che die einzelnen Fachbereiche überschreiten und die sich
manchmal mit der Sprache allein nicht ganz ausdrücken las-
sen. Sie können aber trotzdem nicht wissenschaftlich abquali-
fiziert werden als nur subjektive Anschauungsweisen und
Glaubenssachen.
Die in der Denkmalpflege tätige Material- und Naturwissen-
schaft wird ihrerseits zur Kenntnis nehmen müssen, daß es in
anderen Wahrnehmungsweisen und Sprachen als der ihren
durchaus auch objektive, intersubjektiv überprüfbare Dinge
gibt, die zu verstehen sie lernen muß oder die sie zumindest als
Richtschnur für die Anwendung der Ergebnisse ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit akzeptieren muß. Nur dann wird sie für die
Erhaltung des originalen Kulturgutes wirklich nützliche Hilfe lei-
sten können. Die Denkmalpflege ihrerseits, und damit spreche
ich sie auch im Blick auf die großen naturwissenschaftlichen
Forschungsprojekte zur Denkmalerhaltung an, die zur Zeit in
der Bundesrepublik Deutschland laufen, tut sicher gut, wenn
sie, auch wenn es nicht einfach ist, deutlich macht, wie sie den
Umgang mit dem Original versteht. Einen guten Anfang dazu
scheint mir die Vereinigung der Schweizer Denkmalpfleger ge-
macht zu haben mit der Resolution2, die sie verfaßt und ver-
öffentlicht hat über den Umgang mit geschädigten Steinen am
Denkmal. Auf einer Druckseite hat sie das für sie Wesentliche
gut verständlich zusammengefaßt.
Im Folgenden soll nun versucht werden, den Beitrag, den die
Natur- und Materialwissenschaft zur Erhaltung des originalen
Denkmals liefert, kritisch an der praktischen Erfahrung zu skiz-
zieren. Selbstverständlich kann das hier nicht systematisch
und erschöpfend geschehen.
Naturwissenschaft in der Denkmalpflege
Ausgehend von einer Gebrauchsdefinition der materiellen Er-
haltung von Denkmälern wollen wir versuchen, Möglichkeiten
und Grenzen des naturwissenschaftlichen Beitrages zu ihrer
Erhaltung zu skizzieren. Denkmäler erhalten heißt, sie erken-
61