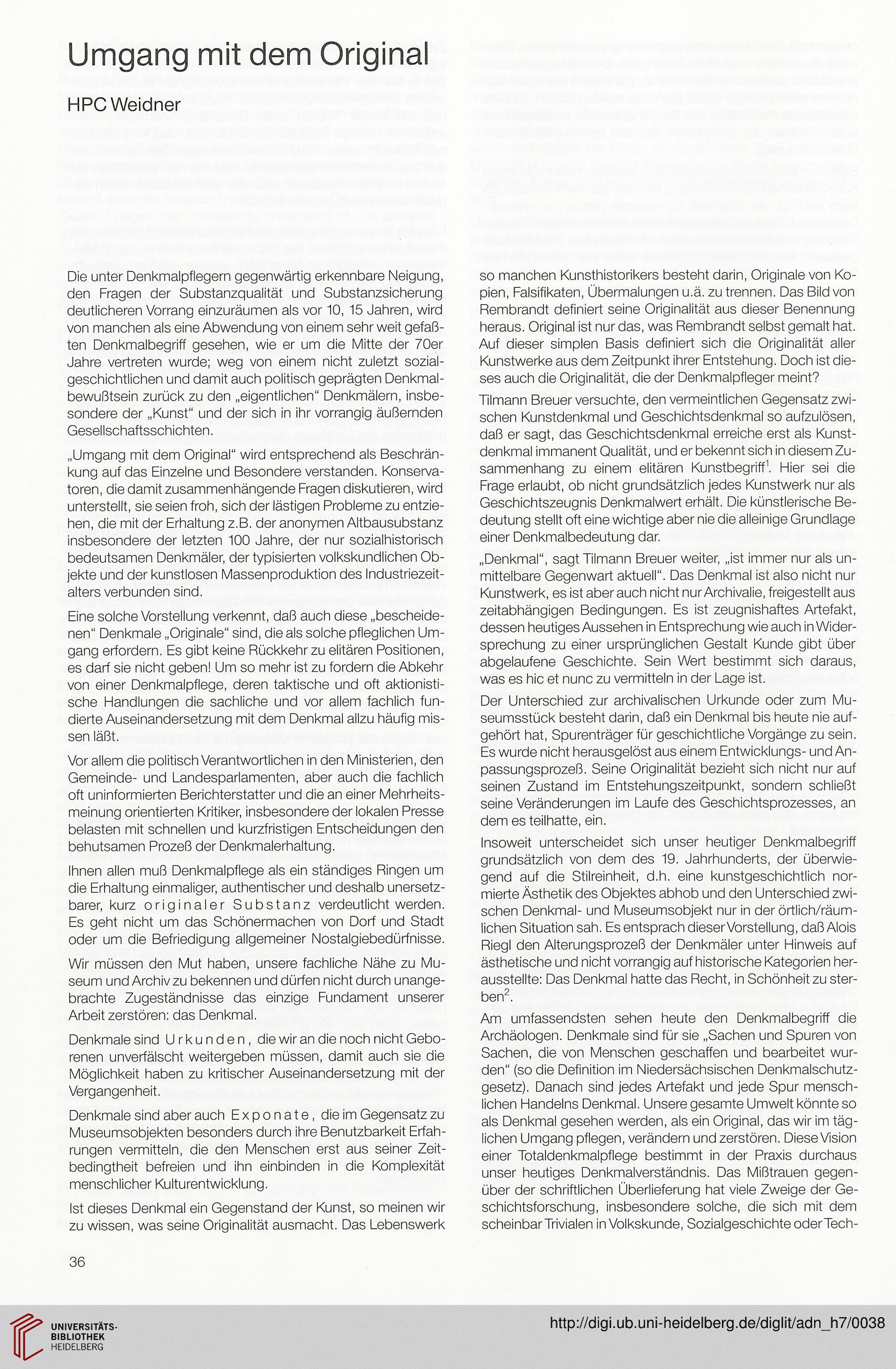Umgang mit dem Original
HPC Weidner
Die unter Denkmalpflegern gegenwärtig erkennbare Neigung,
den Fragen der Substanzqualität und Substanzsicherung
deutlicheren Vorrang einzuräumen als vor 10, 15 Jahren, wird
von manchen als eine Abwendung von einem sehr weit gefaß-
ten Denkmalbegriff gesehen, wie er um die Mitte der 70er
Jahre vertreten wurde; weg von einem nicht zuletzt sozial-
geschichtlichen und damit auch politisch geprägten Denkmal-
bewußtsein zurück zu den „eigentlichen“ Denkmälern, insbe-
sondere der „Kunst“ und der sich in ihr vorrangig äußernden
Gesellschaftsschichten.
„Umgang mit dem Original“ wird entsprechend als Beschrän-
kung auf das Einzelne und Besondere verstanden. Konserva-
toren, die damit zusammenhängende Fragen diskutieren, wird
unterstellt, sie seien froh, sich der lästigen Probleme zu entzie-
hen, die mit der Erhaltung z.B. der anonymen Altbausubstanz
insbesondere der letzten 100 Jahre, der nur sozialhistorisch
bedeutsamen Denkmäler, der typisierten volkskundlichen Ob-
jekte und der kunstlosen Massenproduktion des Industriezeit-
alters verbunden sind.
Eine solche Vorstellung verkennt, daß auch diese „bescheide-
nen“ Denkmale „Originale“ sind, die als solche pfleglichen Um-
gang erfordern. Es gibt keine Rückkehr zu elitären Positionen,
es darf sie nicht geben! Um so mehr ist zu fordern die Abkehr
von einer Denkmalpflege, deren taktische und oft aktionisti-
sche Handlungen die sachliche und vor allem fachlich fun-
dierte Auseinandersetzung mit dem Denkmal allzu häufig mis-
sen läßt.
Vor allem die politisch Verantwortlichen in den Ministerien, den
Gemeinde- und Landesparlamenten, aber auch die fachlich
oft uninformierten Berichterstatter und die an einer Mehrheits-
meinung orientierten Kritiker, insbesondere der lokalen Presse
belasten mit schnellen und kurzfristigen Entscheidungen den
behutsamen Prozeß der Denkmalerhaltung.
Ihnen allen muß Denkmalpflege als ein ständiges Ringen um
die Erhaltung einmaliger, authentischer und deshalb unersetz-
barer, kurz originaler Substanz verdeutlicht werden.
Es geht nicht um das Schönermachen von Dorf und Stadt
oder um die Befriedigung allgemeiner Nostalgiebedürfnisse.
Wir müssen den Mut haben, unsere fachliche Nähe zu Mu-
seum und Archiv zu bekennen und dürfen nicht durch unange-
brachte Zugeständnisse das einzige Fundament unserer
Arbeit zerstören: das Denkmal.
Denkmale sind Urkunden, die wir an die noch nicht Gebo-
renen unverfälscht weitergeben müssen, damit auch sie die
Möglichkeit haben zu kritischer Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit.
Denkmale sind aber auch Exponate, die im Gegensatz zu
Museumsobjekten besonders durch ihre Benutzbarkeit Erfah-
rungen vermitteln, die den Menschen erst aus seiner Zeit-
bedingtheit befreien und ihn einbinden in die Komplexität
menschlicher Kulturentwicklung.
Ist dieses Denkmal ein Gegenstand der Kunst, so meinen wir
zu wissen, was seine Originalität ausmacht. Das Lebenswerk
so manchen Kunsthistorikers besteht darin, Originale von Ko-
pien, Falsifikaten, Übermalungen u.ä. zu trennen. Das Bild von
Rembrandt definiert seine Originalität aus dieser Benennung
heraus. Original ist nur das, was Rembrandt selbst gemalt hat.
Auf dieser simplen Basis definiert sich die Originalität aller
Kunstwerke aus dem Zeitpunkt ihrer Entstehung. Doch ist die-
ses auch die Originalität, die der Denkmalpfleger meint?
Tilmann Breuer versuchte, den vermeintlichen Gegensatz zwi-
schen Kunstdenkmal und Geschichtsdenkmal so aufzulösen,
daß er sagt, das Geschichtsdenkmal erreiche erst als Kunst-
denkmal immanent Qualität, und er bekennt sich in diesem Zu-
sammenhang zu einem elitären Kunstbegriff1. Hier sei die
Frage erlaubt, ob nicht grundsätzlich jedes Kunstwerk nur als
Geschichtszeugnis Denkmalwert erhält. Die künstlerische Be-
deutung stellt oft eine wichtige aber nie die alleinige Grundlage
einer Denkmalbedeutung dar.
„Denkmal“, sagt Tilmann Breuer weiter, „ist immer nur als un-
mittelbare Gegenwart aktuell“. Das Denkmal ist also nicht nur
Kunstwerk, es ist aber auch nicht nur Archivalie, freigestellt aus
zeitabhängigen Bedingungen. Es ist zeugnishaftes Artefakt,
dessen heutiges Aussehen in Entsprechung wie auch inWider-
sprechung zu einer ursprünglichen Gestalt Kunde gibt über
abgelaufene Geschichte. Sein Wert bestimmt sich daraus,
was es hic et nunc zu vermitteln in der Lage ist.
Der Unterschied zur archivalischen Urkunde oder zum Mu-
seumsstück besteht darin, daß ein Denkmal bis heute nie auf-
gehört hat, Spurenträger für geschichtliche Vorgänge zu sein.
Es wurde nicht herausgelöst aus einem Entwicklungs- und An-
passungsprozeß. Seine Originalität bezieht sich nicht nur auf
seinen Zustand im Entstehungszeitpunkt, sondern schließt
seine Veränderungen im Laufe des Geschichtsprozesses, an
dem es teilhatte, ein.
Insoweit unterscheidet sich unser heutiger Denkmalbegriff
grundsätzlich von dem des 19. Jahrhunderts, der überwie-
gend auf die Stilreinheit, d.h. eine kunstgeschichtlich nor-
mierte Ästhetik des Objektes abhob und den Unterschied zwi-
schen Denkmal- und Museumsobjekt nur in der örtlich/räum-
lichen Situation sah. Es entsprach dieser Vorstellung, daß Alois
Riegl den Alterungsprozeß der Denkmäler unter Hinweis auf
ästhetische und nicht vorrangig auf historische Kategorien her-
ausstellte: Das Denkmal hatte das Recht, in Schönheit zu ster-
ben2.
Am umfassendsten sehen heute den Denkmalbegriff die
Archäologen. Denkmale sind für sie „Sachen und Spuren von
Sachen, die von Menschen geschaffen und bearbeitet wur-
den“ (so die Definition im Niedersächsischen Denkmalschutz-
gesetz). Danach sind jedes Artefakt und jede Spur mensch-
lichen Handelns Denkmal. Unsere gesamte Umwelt könnte so
als Denkmal gesehen werden, als ein Original, das wir im täg-
lichen Umgang pflegen, verändern und zerstören. Diese Vision
einer Totaldenkmalpflege bestimmt in der Praxis durchaus
unser heutiges Denkmalverständnis. Das Mißtrauen gegen-
über der schriftlichen Überlieferung hat viele Zweige der Ge-
schichtsforschung, insbesondere solche, die sich mit dem
scheinbar Trivialen in Volkskunde, Sozialgeschichte oderTech-
36
HPC Weidner
Die unter Denkmalpflegern gegenwärtig erkennbare Neigung,
den Fragen der Substanzqualität und Substanzsicherung
deutlicheren Vorrang einzuräumen als vor 10, 15 Jahren, wird
von manchen als eine Abwendung von einem sehr weit gefaß-
ten Denkmalbegriff gesehen, wie er um die Mitte der 70er
Jahre vertreten wurde; weg von einem nicht zuletzt sozial-
geschichtlichen und damit auch politisch geprägten Denkmal-
bewußtsein zurück zu den „eigentlichen“ Denkmälern, insbe-
sondere der „Kunst“ und der sich in ihr vorrangig äußernden
Gesellschaftsschichten.
„Umgang mit dem Original“ wird entsprechend als Beschrän-
kung auf das Einzelne und Besondere verstanden. Konserva-
toren, die damit zusammenhängende Fragen diskutieren, wird
unterstellt, sie seien froh, sich der lästigen Probleme zu entzie-
hen, die mit der Erhaltung z.B. der anonymen Altbausubstanz
insbesondere der letzten 100 Jahre, der nur sozialhistorisch
bedeutsamen Denkmäler, der typisierten volkskundlichen Ob-
jekte und der kunstlosen Massenproduktion des Industriezeit-
alters verbunden sind.
Eine solche Vorstellung verkennt, daß auch diese „bescheide-
nen“ Denkmale „Originale“ sind, die als solche pfleglichen Um-
gang erfordern. Es gibt keine Rückkehr zu elitären Positionen,
es darf sie nicht geben! Um so mehr ist zu fordern die Abkehr
von einer Denkmalpflege, deren taktische und oft aktionisti-
sche Handlungen die sachliche und vor allem fachlich fun-
dierte Auseinandersetzung mit dem Denkmal allzu häufig mis-
sen läßt.
Vor allem die politisch Verantwortlichen in den Ministerien, den
Gemeinde- und Landesparlamenten, aber auch die fachlich
oft uninformierten Berichterstatter und die an einer Mehrheits-
meinung orientierten Kritiker, insbesondere der lokalen Presse
belasten mit schnellen und kurzfristigen Entscheidungen den
behutsamen Prozeß der Denkmalerhaltung.
Ihnen allen muß Denkmalpflege als ein ständiges Ringen um
die Erhaltung einmaliger, authentischer und deshalb unersetz-
barer, kurz originaler Substanz verdeutlicht werden.
Es geht nicht um das Schönermachen von Dorf und Stadt
oder um die Befriedigung allgemeiner Nostalgiebedürfnisse.
Wir müssen den Mut haben, unsere fachliche Nähe zu Mu-
seum und Archiv zu bekennen und dürfen nicht durch unange-
brachte Zugeständnisse das einzige Fundament unserer
Arbeit zerstören: das Denkmal.
Denkmale sind Urkunden, die wir an die noch nicht Gebo-
renen unverfälscht weitergeben müssen, damit auch sie die
Möglichkeit haben zu kritischer Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit.
Denkmale sind aber auch Exponate, die im Gegensatz zu
Museumsobjekten besonders durch ihre Benutzbarkeit Erfah-
rungen vermitteln, die den Menschen erst aus seiner Zeit-
bedingtheit befreien und ihn einbinden in die Komplexität
menschlicher Kulturentwicklung.
Ist dieses Denkmal ein Gegenstand der Kunst, so meinen wir
zu wissen, was seine Originalität ausmacht. Das Lebenswerk
so manchen Kunsthistorikers besteht darin, Originale von Ko-
pien, Falsifikaten, Übermalungen u.ä. zu trennen. Das Bild von
Rembrandt definiert seine Originalität aus dieser Benennung
heraus. Original ist nur das, was Rembrandt selbst gemalt hat.
Auf dieser simplen Basis definiert sich die Originalität aller
Kunstwerke aus dem Zeitpunkt ihrer Entstehung. Doch ist die-
ses auch die Originalität, die der Denkmalpfleger meint?
Tilmann Breuer versuchte, den vermeintlichen Gegensatz zwi-
schen Kunstdenkmal und Geschichtsdenkmal so aufzulösen,
daß er sagt, das Geschichtsdenkmal erreiche erst als Kunst-
denkmal immanent Qualität, und er bekennt sich in diesem Zu-
sammenhang zu einem elitären Kunstbegriff1. Hier sei die
Frage erlaubt, ob nicht grundsätzlich jedes Kunstwerk nur als
Geschichtszeugnis Denkmalwert erhält. Die künstlerische Be-
deutung stellt oft eine wichtige aber nie die alleinige Grundlage
einer Denkmalbedeutung dar.
„Denkmal“, sagt Tilmann Breuer weiter, „ist immer nur als un-
mittelbare Gegenwart aktuell“. Das Denkmal ist also nicht nur
Kunstwerk, es ist aber auch nicht nur Archivalie, freigestellt aus
zeitabhängigen Bedingungen. Es ist zeugnishaftes Artefakt,
dessen heutiges Aussehen in Entsprechung wie auch inWider-
sprechung zu einer ursprünglichen Gestalt Kunde gibt über
abgelaufene Geschichte. Sein Wert bestimmt sich daraus,
was es hic et nunc zu vermitteln in der Lage ist.
Der Unterschied zur archivalischen Urkunde oder zum Mu-
seumsstück besteht darin, daß ein Denkmal bis heute nie auf-
gehört hat, Spurenträger für geschichtliche Vorgänge zu sein.
Es wurde nicht herausgelöst aus einem Entwicklungs- und An-
passungsprozeß. Seine Originalität bezieht sich nicht nur auf
seinen Zustand im Entstehungszeitpunkt, sondern schließt
seine Veränderungen im Laufe des Geschichtsprozesses, an
dem es teilhatte, ein.
Insoweit unterscheidet sich unser heutiger Denkmalbegriff
grundsätzlich von dem des 19. Jahrhunderts, der überwie-
gend auf die Stilreinheit, d.h. eine kunstgeschichtlich nor-
mierte Ästhetik des Objektes abhob und den Unterschied zwi-
schen Denkmal- und Museumsobjekt nur in der örtlich/räum-
lichen Situation sah. Es entsprach dieser Vorstellung, daß Alois
Riegl den Alterungsprozeß der Denkmäler unter Hinweis auf
ästhetische und nicht vorrangig auf historische Kategorien her-
ausstellte: Das Denkmal hatte das Recht, in Schönheit zu ster-
ben2.
Am umfassendsten sehen heute den Denkmalbegriff die
Archäologen. Denkmale sind für sie „Sachen und Spuren von
Sachen, die von Menschen geschaffen und bearbeitet wur-
den“ (so die Definition im Niedersächsischen Denkmalschutz-
gesetz). Danach sind jedes Artefakt und jede Spur mensch-
lichen Handelns Denkmal. Unsere gesamte Umwelt könnte so
als Denkmal gesehen werden, als ein Original, das wir im täg-
lichen Umgang pflegen, verändern und zerstören. Diese Vision
einer Totaldenkmalpflege bestimmt in der Praxis durchaus
unser heutiges Denkmalverständnis. Das Mißtrauen gegen-
über der schriftlichen Überlieferung hat viele Zweige der Ge-
schichtsforschung, insbesondere solche, die sich mit dem
scheinbar Trivialen in Volkskunde, Sozialgeschichte oderTech-
36