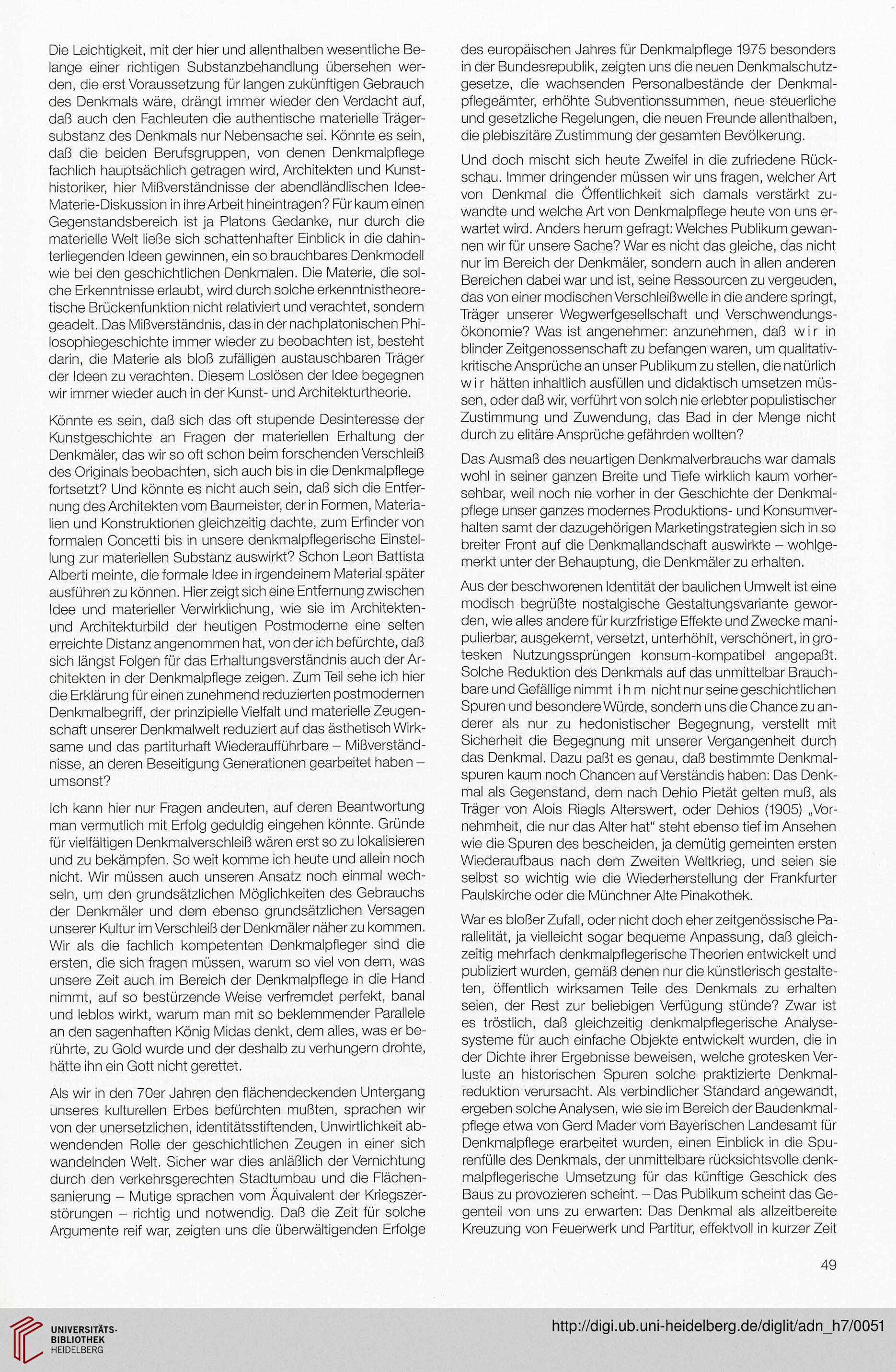Die Leichtigkeit, mit der hier und allenthalben wesentliche Be-
lange einer richtigen Substanzbehandlung übersehen wer-
den, die erst Voraussetzung für langen zukünftigen Gebrauch
des Denkmals wäre, drängt immer wieder den Verdacht auf,
daß auch den Fachleuten die authentische materielle Träger-
substanz des Denkmals nur Nebensache sei. Könnte es sein,
daß die beiden Berufsgruppen, von denen Denkmalpflege
fachlich hauptsächlich getragen wird, Architekten und Kunst-
historiker, hier Mißverständnisse der abendländischen Idee-
Materie-Diskussion in ihre Arbeit hineintragen? Für kaum einen
Gegenstandsbereich ist ja Platons Gedanke, nur durch die
materielle Welt ließe sich schattenhafter Einblick in die dahin-
terliegenden Ideen gewinnen, ein so brauchbares Denkmodell
wie bei den geschichtlichen Denkmalen. Die Materie, die sol-
che Erkenntnisse erlaubt, wird durch solche erkenntnistheore-
tische Brückenfunktion nicht relativiert und verachtet, sondern
geadelt. Das Mißverständnis, das in der nachplatonischen Phi-
losophiegeschichte immer wieder zu beobachten ist, besteht
darin, die Materie als bloß zufälligen austauschbaren Träger
der Ideen zu verachten. Diesem Loslösen der Idee begegnen
wir immer wieder auch in der Kunst- und Architekturtheorie.
Könnte es sein, daß sich das oft stupende Desinteresse der
Kunstgeschichte an Fragen der materiellen Erhaltung der
Denkmäler, das wir so oft schon beim forschenden Verschleiß
des Originals beobachten, sich auch bis in die Denkmalpflege
fortsetzt? Und könnte es nicht auch sein, daß sich die Entfer-
nung des Architekten vom Baumeister, der in Formen, Materia-
lien und Konstruktionen gleichzeitig dachte, zum Erfinder von
formalen Concetti bis in unsere denkmalpflegerische Einstel-
lung zur materiellen Substanz auswirkt? Schon Leon Battista
Alberti meinte, die formale Idee in irgendeinem Material später
ausführen zu können. Hier zeigt sich eine Entfernung zwischen
Idee und materieller Verwirklichung, wie sie im Architekten-
und Architekturbild der heutigen Postmoderne eine selten
erreichte Distanz angenommen hat, von der ich befürchte, daß
sich längst Folgen für das Erhaltungsverständnis auch der Ar-
chitekten in der Denkmalpflege zeigen. Zum Teil sehe ich hier
die Erklärung für einen zunehmend reduzierten postmodernen
Denkmalbegriff, der prinzipielle Vielfalt und materielle Zeugen-
schaft unserer Denkmalwelt reduziert auf das ästhetisch Wirk-
same und das partiturhaft Wiederaufführbare - Mißverständ-
nisse, an deren Beseitigung Generationen gearbeitet haben-
umsonst?
Ich kann hier nur Fragen andeuten, auf deren Beantwortung
man vermutlich mit Erfolg geduldig eingehen könnte. Gründe
für vielfältigen Denkmalverschleiß wären erst so zu lokalisieren
und zu bekämpfen. So weit komme ich heute und allein noch
nicht. Wir müssen auch unseren Ansatz noch einmal wech-
seln, um den grundsätzlichen Möglichkeiten des Gebrauchs
der Denkmäler und dem ebenso grundsätzlichen Versagen
unserer Kultur im Verschleiß der Denkmäler näher zu kommen.
Wir als die fachlich kompetenten Denkmalpfleger sind die
ersten, die sich fragen müssen, warum so viel von dem, was
unsere Zeit auch im Bereich der Denkmalpflege in die Hand
nimmt, auf so bestürzende Weise verfremdet perfekt, banal
und leblos wirkt, warum man mit so beklemmender Parallele
an den sagenhaften König Midas denkt, dem alles, was er be-
rührte, zu Gold wurde und der deshalb zu verhungern drohte,
hätte ihn ein Gott nicht gerettet.
Als wir in den 70er Jahren den flächendeckenden Untergang
unseres kulturellen Erbes befürchten mußten, sprachen wir
von der unersetzlichen, identitätsstiftenden, Unwirtlichkeit ab-
wendenden Rolle der geschichtlichen Zeugen in einer sich
wandelnden Welt. Sicher war dies anläßlich der Vernichtung
durch den verkehrsgerechten Stadtumbau und die Flächen-
sanierung - Mutige sprachen vom Äquivalent der Kriegszer-
störungen - richtig und notwendig. Daß die Zeit für solche
Argumente reif war, zeigten uns die überwältigenden Erfolge
des europäischen Jahres für Denkmalpflege 1975 besonders
in der Bundesrepublik, zeigten uns die neuen Denkmalschutz-
gesetze, die wachsenden Personalbestände der Denkmal-
pflegeämter, erhöhte Subventionssummen, neue steuerliche
und gesetzliche Regelungen, die neuen Freunde allenthalben,
die plebiszitäre Zustimmung der gesamten Bevölkerung.
Und doch mischt sich heute Zweifel in die zufriedene Rück-
schau. Immer dringender müssen wir uns fragen, welcher Art
von Denkmal die Öffentlichkeit sich damals verstärkt zu-
wandte und welche Art von Denkmalpflege heute von uns er-
wartet wird. Anders herum gefragt: Welches Publikum gewan-
nen wir für unsere Sache? War es nicht das gleiche, das nicht
nur im Bereich der Denkmäler, sondern auch in allen anderen
Bereichen dabei war und ist, seine Ressourcen zu vergeuden,
das von einer modischen Verschleißwelle in die andere springt,
Träger unserer Wegwerfgesellschaft und Verschwendungs-
ökonomie? Was ist angenehmer: anzunehmen, daß w i r in
blinder Zeitgenossenschaft zu befangen waren, um qualitativ-
kritische Ansprüche an unser Publikum zu stellen, die natürlich
w i r hätten inhaltlich ausfüllen und didaktisch umsetzen müs-
sen, oder daß wir, verführt von solch nie erlebter populistischer
Zustimmung und Zuwendung, das Bad in der Menge nicht
durch zu elitäre Ansprüche gefährden wollten?
Das Ausmaß des neuartigen Denkmalverbrauchs war damals
wohl in seiner ganzen Breite und Tiefe wirklich kaum vorher-
sehbar, weil noch nie vorher in der Geschichte der Denkmal-
pflege unser ganzes modernes Produktions- und Konsumver-
halten samt der dazugehörigen Marketingstrategien sich in so
breiter Front auf die Denkmallandschaft auswirkte - wohlge-
merkt unter der Behauptung, die Denkmäler zu erhalten.
Aus der beschworenen Identität der baulichen Umwelt ist eine
modisch begrüßte nostalgische Gestaltungsvariante gewor-
den, wie alles andere für kurzfristige Effekte und Zwecke mani-
pulierbar, ausgekernt, versetzt, unterhöhlt, verschönert, in gro-
tesken Nutzungssprüngen konsum-kompatibel angepaßt.
Solche Reduktion des Denkmals auf das unmittelbar Brauch-
bare und Gefällige nimmt ihm nicht nur seine geschichtlichen
Spuren und besondere Würde, sondern uns die Chance zu an-
derer als nur zu hedonistischer Begegnung, verstellt mit
Sicherheit die Begegnung mit unserer Vergangenheit durch
das Denkmal. Dazu paßt es genau, daß bestimmte Denkmal-
spuren kaum noch Chancen aufVerständis haben: Das Denk-
mal als Gegenstand, dem nach Dehio Pietät gelten muß, als
Träger von Alois Riegls Alterswert, oder Dehios (1905) „Vor-
nehmheit, die nur das Alter hat“ steht ebenso tief im Ansehen
wie die Spuren des bescheiden, ja demütig gemeinten ersten
Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, und seien sie
selbst so wichtig wie die Wiederherstellung der Frankfurter
Paulskirche oder die Münchner Alte Pinakothek.
War es bloßer Zufall, oder nicht doch eher zeitgenössische Pa-
rallelität, ja vielleicht sogar bequeme Anpassung, daß gleich-
zeitig mehrfach denkmalpflegerische Theorien entwickelt und
publiziert wurden, gemäß denen nur die künstlerisch gestalte-
ten, öffentlich wirksamen Teile des Denkmals zu erhalten
seien, der Rest zur beliebigen Verfügung stünde? Zwar ist
es tröstlich, daß gleichzeitig denkmalpflegerische Analyse-
systeme für auch einfache Objekte entwickelt wurden, die in
der Dichte ihrer Ergebnisse beweisen, welche grotesken Ver-
luste an historischen Spuren solche praktizierte Denkmal-
reduktion verursacht. Als verbindlicher Standard angewandt,
ergeben solche Analysen, wie sie im Bereich der Baudenkmal-
pflege etwa von Gerd Mader vom Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege erarbeitet wurden, einen Einblick in die Spu-
renfülle des Denkmals, der unmittelbare rücksichtsvolle denk-
malpflegerische Umsetzung für das künftige Geschick des
Baus zu provozieren scheint. - Das Publikum scheint das Ge-
genteil von uns zu erwarten: Das Denkmal als allzeitbereite
Kreuzung von Feuerwerk und Partitur, effektvoll in kurzer Zeit
49
lange einer richtigen Substanzbehandlung übersehen wer-
den, die erst Voraussetzung für langen zukünftigen Gebrauch
des Denkmals wäre, drängt immer wieder den Verdacht auf,
daß auch den Fachleuten die authentische materielle Träger-
substanz des Denkmals nur Nebensache sei. Könnte es sein,
daß die beiden Berufsgruppen, von denen Denkmalpflege
fachlich hauptsächlich getragen wird, Architekten und Kunst-
historiker, hier Mißverständnisse der abendländischen Idee-
Materie-Diskussion in ihre Arbeit hineintragen? Für kaum einen
Gegenstandsbereich ist ja Platons Gedanke, nur durch die
materielle Welt ließe sich schattenhafter Einblick in die dahin-
terliegenden Ideen gewinnen, ein so brauchbares Denkmodell
wie bei den geschichtlichen Denkmalen. Die Materie, die sol-
che Erkenntnisse erlaubt, wird durch solche erkenntnistheore-
tische Brückenfunktion nicht relativiert und verachtet, sondern
geadelt. Das Mißverständnis, das in der nachplatonischen Phi-
losophiegeschichte immer wieder zu beobachten ist, besteht
darin, die Materie als bloß zufälligen austauschbaren Träger
der Ideen zu verachten. Diesem Loslösen der Idee begegnen
wir immer wieder auch in der Kunst- und Architekturtheorie.
Könnte es sein, daß sich das oft stupende Desinteresse der
Kunstgeschichte an Fragen der materiellen Erhaltung der
Denkmäler, das wir so oft schon beim forschenden Verschleiß
des Originals beobachten, sich auch bis in die Denkmalpflege
fortsetzt? Und könnte es nicht auch sein, daß sich die Entfer-
nung des Architekten vom Baumeister, der in Formen, Materia-
lien und Konstruktionen gleichzeitig dachte, zum Erfinder von
formalen Concetti bis in unsere denkmalpflegerische Einstel-
lung zur materiellen Substanz auswirkt? Schon Leon Battista
Alberti meinte, die formale Idee in irgendeinem Material später
ausführen zu können. Hier zeigt sich eine Entfernung zwischen
Idee und materieller Verwirklichung, wie sie im Architekten-
und Architekturbild der heutigen Postmoderne eine selten
erreichte Distanz angenommen hat, von der ich befürchte, daß
sich längst Folgen für das Erhaltungsverständnis auch der Ar-
chitekten in der Denkmalpflege zeigen. Zum Teil sehe ich hier
die Erklärung für einen zunehmend reduzierten postmodernen
Denkmalbegriff, der prinzipielle Vielfalt und materielle Zeugen-
schaft unserer Denkmalwelt reduziert auf das ästhetisch Wirk-
same und das partiturhaft Wiederaufführbare - Mißverständ-
nisse, an deren Beseitigung Generationen gearbeitet haben-
umsonst?
Ich kann hier nur Fragen andeuten, auf deren Beantwortung
man vermutlich mit Erfolg geduldig eingehen könnte. Gründe
für vielfältigen Denkmalverschleiß wären erst so zu lokalisieren
und zu bekämpfen. So weit komme ich heute und allein noch
nicht. Wir müssen auch unseren Ansatz noch einmal wech-
seln, um den grundsätzlichen Möglichkeiten des Gebrauchs
der Denkmäler und dem ebenso grundsätzlichen Versagen
unserer Kultur im Verschleiß der Denkmäler näher zu kommen.
Wir als die fachlich kompetenten Denkmalpfleger sind die
ersten, die sich fragen müssen, warum so viel von dem, was
unsere Zeit auch im Bereich der Denkmalpflege in die Hand
nimmt, auf so bestürzende Weise verfremdet perfekt, banal
und leblos wirkt, warum man mit so beklemmender Parallele
an den sagenhaften König Midas denkt, dem alles, was er be-
rührte, zu Gold wurde und der deshalb zu verhungern drohte,
hätte ihn ein Gott nicht gerettet.
Als wir in den 70er Jahren den flächendeckenden Untergang
unseres kulturellen Erbes befürchten mußten, sprachen wir
von der unersetzlichen, identitätsstiftenden, Unwirtlichkeit ab-
wendenden Rolle der geschichtlichen Zeugen in einer sich
wandelnden Welt. Sicher war dies anläßlich der Vernichtung
durch den verkehrsgerechten Stadtumbau und die Flächen-
sanierung - Mutige sprachen vom Äquivalent der Kriegszer-
störungen - richtig und notwendig. Daß die Zeit für solche
Argumente reif war, zeigten uns die überwältigenden Erfolge
des europäischen Jahres für Denkmalpflege 1975 besonders
in der Bundesrepublik, zeigten uns die neuen Denkmalschutz-
gesetze, die wachsenden Personalbestände der Denkmal-
pflegeämter, erhöhte Subventionssummen, neue steuerliche
und gesetzliche Regelungen, die neuen Freunde allenthalben,
die plebiszitäre Zustimmung der gesamten Bevölkerung.
Und doch mischt sich heute Zweifel in die zufriedene Rück-
schau. Immer dringender müssen wir uns fragen, welcher Art
von Denkmal die Öffentlichkeit sich damals verstärkt zu-
wandte und welche Art von Denkmalpflege heute von uns er-
wartet wird. Anders herum gefragt: Welches Publikum gewan-
nen wir für unsere Sache? War es nicht das gleiche, das nicht
nur im Bereich der Denkmäler, sondern auch in allen anderen
Bereichen dabei war und ist, seine Ressourcen zu vergeuden,
das von einer modischen Verschleißwelle in die andere springt,
Träger unserer Wegwerfgesellschaft und Verschwendungs-
ökonomie? Was ist angenehmer: anzunehmen, daß w i r in
blinder Zeitgenossenschaft zu befangen waren, um qualitativ-
kritische Ansprüche an unser Publikum zu stellen, die natürlich
w i r hätten inhaltlich ausfüllen und didaktisch umsetzen müs-
sen, oder daß wir, verführt von solch nie erlebter populistischer
Zustimmung und Zuwendung, das Bad in der Menge nicht
durch zu elitäre Ansprüche gefährden wollten?
Das Ausmaß des neuartigen Denkmalverbrauchs war damals
wohl in seiner ganzen Breite und Tiefe wirklich kaum vorher-
sehbar, weil noch nie vorher in der Geschichte der Denkmal-
pflege unser ganzes modernes Produktions- und Konsumver-
halten samt der dazugehörigen Marketingstrategien sich in so
breiter Front auf die Denkmallandschaft auswirkte - wohlge-
merkt unter der Behauptung, die Denkmäler zu erhalten.
Aus der beschworenen Identität der baulichen Umwelt ist eine
modisch begrüßte nostalgische Gestaltungsvariante gewor-
den, wie alles andere für kurzfristige Effekte und Zwecke mani-
pulierbar, ausgekernt, versetzt, unterhöhlt, verschönert, in gro-
tesken Nutzungssprüngen konsum-kompatibel angepaßt.
Solche Reduktion des Denkmals auf das unmittelbar Brauch-
bare und Gefällige nimmt ihm nicht nur seine geschichtlichen
Spuren und besondere Würde, sondern uns die Chance zu an-
derer als nur zu hedonistischer Begegnung, verstellt mit
Sicherheit die Begegnung mit unserer Vergangenheit durch
das Denkmal. Dazu paßt es genau, daß bestimmte Denkmal-
spuren kaum noch Chancen aufVerständis haben: Das Denk-
mal als Gegenstand, dem nach Dehio Pietät gelten muß, als
Träger von Alois Riegls Alterswert, oder Dehios (1905) „Vor-
nehmheit, die nur das Alter hat“ steht ebenso tief im Ansehen
wie die Spuren des bescheiden, ja demütig gemeinten ersten
Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, und seien sie
selbst so wichtig wie die Wiederherstellung der Frankfurter
Paulskirche oder die Münchner Alte Pinakothek.
War es bloßer Zufall, oder nicht doch eher zeitgenössische Pa-
rallelität, ja vielleicht sogar bequeme Anpassung, daß gleich-
zeitig mehrfach denkmalpflegerische Theorien entwickelt und
publiziert wurden, gemäß denen nur die künstlerisch gestalte-
ten, öffentlich wirksamen Teile des Denkmals zu erhalten
seien, der Rest zur beliebigen Verfügung stünde? Zwar ist
es tröstlich, daß gleichzeitig denkmalpflegerische Analyse-
systeme für auch einfache Objekte entwickelt wurden, die in
der Dichte ihrer Ergebnisse beweisen, welche grotesken Ver-
luste an historischen Spuren solche praktizierte Denkmal-
reduktion verursacht. Als verbindlicher Standard angewandt,
ergeben solche Analysen, wie sie im Bereich der Baudenkmal-
pflege etwa von Gerd Mader vom Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege erarbeitet wurden, einen Einblick in die Spu-
renfülle des Denkmals, der unmittelbare rücksichtsvolle denk-
malpflegerische Umsetzung für das künftige Geschick des
Baus zu provozieren scheint. - Das Publikum scheint das Ge-
genteil von uns zu erwarten: Das Denkmal als allzeitbereite
Kreuzung von Feuerwerk und Partitur, effektvoll in kurzer Zeit
49