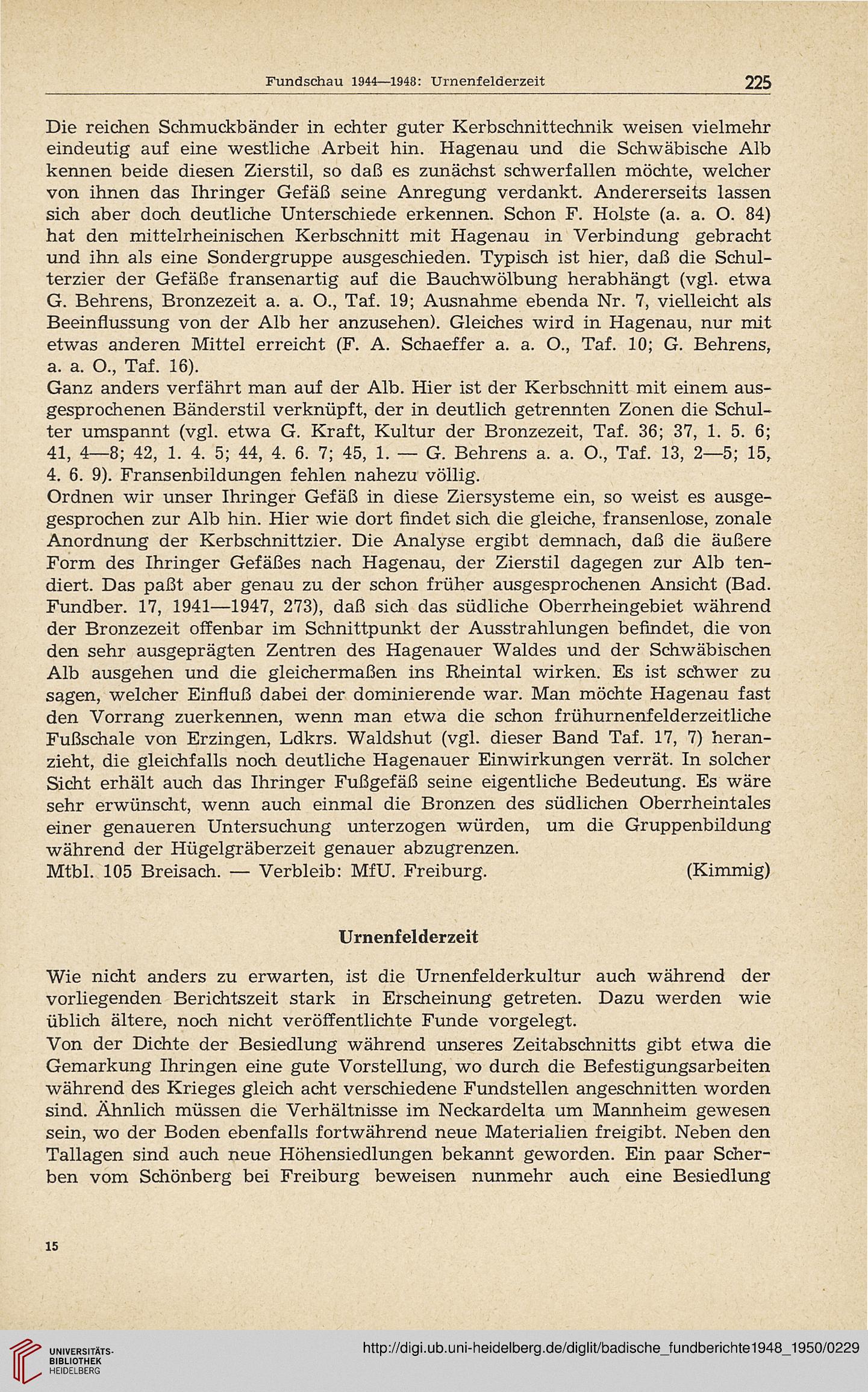Fundschau 1944—1948: Urnenfelderzeit
225
Die reichen Schmuckbänder in echter guter Kerbschnittechnik weisen vielmehr
eindeutig auf eine westliche Arbeit hin. Hagenau und die Schwäbische Alb
kennen beide diesen Zierstil, so daß es zunächst schwerfallen möchte, welcher
von ihnen das Ihringer Gefäß seine Anregung verdankt. Andererseits lassen
sich aber doch deutliche Unterschiede erkennen. Schon F. Holste (a. a. O. 84)
hat den mittelrheinischen Kerbschnitt mit Hagenau in Verbindung gebracht
und ihn als eine Sondergruppe ausgeschieden. Typisch ist hier, daß die Schul-
terzier der Gefäße fransenartig auf die Bauchwölbung herabhängt (vgl. etwa
G. Behrens, Bronzezeit a. a. O., Taf. 19; Ausnahme ebenda Nr. 7, vielleicht als
Beeinflussung von der Alb her anzusehen). Gleiches wird in Hagenau, nur mit
etwas anderen Mittel erreicht (F. A. Schaeffer a. a. O., Taf. 10; G. Behrens,
a. a. O., Taf. 16).
Ganz anders verfährt man auf der Alb. Hier ist der Kerbschnitt mit einem aus-
gesprochenen Bänderstil verknüpft, der in deutlich getrennten Zonen die Schul-
ter umspannt (vgl. etwa G. Kraft, Kultur der Bronzezeit, Taf. 36; 37, 1. 5. 6;
41, 4—8; 42, 1. 4. 5; 44, 4. 6. 7; 45, 1. — G. Behrens a. a. O., Taf. 13, 2—5; 15,
4. 6. 9). Fransenbildungen fehlen nahezu völlig.
Ordnen wir unser Ihringer Gefäß in diese Ziersysteme ein, so weist es ausge-
gesprochen zur Alb hin. Hier wie dort findet sich die gleiche, fransenlose, zonale
Anordnung der Kerbschnittzier. Die Analyse ergibt demnach, daß die äußere
Form des Ihringer Gefäßes nach Hagenau, der Zierstil dagegen zur Alb ten-
diert. Das paßt aber genau zu der schon früher ausgesprochenen Ansicht (Bad.
Fundber. 17, 1941—1947, 273), daß sich das südliche Oberrheingebiet während
der Bronzezeit offenbar im Schnittpunkt der Ausstrahlungen befindet, die von
den sehr ausgeprägten Zentren des Hagenauer Waldes und der Schwäbischen
Alb ausgehen und die gleichermaßen ins Rheintal wirken. Es ist schwer zu
sagen, welcher Einfluß dabei der dominierende war. Man möchte Hagenau fast
den Vorrang zuerkennen, wenn man etwa die schon frühurnenfelderzeitliche
Fußschale von Erzingen, Ldkrs. Waldshut (vgl. dieser Band Taf. 17, 7) heran-
zieht, die gleichfalls noch deutliche Hagenauer Einwirkungen verrät. In solcher
Sicht erhält auch das Ihringer Fußgefäß seine eigentliche Bedeutung. Es wäre
sehr erwünscht, wenn auch einmal die Bronzen des südlichen Oberrheintales
einer genaueren Untersuchung unterzogen würden, um die Gruppenbildung
während der Hügelgräberzeit genauer abzugrenzen.
Mtbl. 105 Breisach. — Verbleib: MfU. Freiburg. (Kimmig)
Urnenfelderzeit
Wie nicht anders zu erwarten, ist die Urnenfelderkultur auch während der
vorliegenden Berichtszeit stark in Erscheinung getreten. Dazu werden wie
üblich ältere, noch nicht veröffentlichte Funde vorgelegt.
Von der Dichte der Besiedlung während unseres Zeitabschnitts gibt etwa die
Gemarkung Ihringen eine gute Vorstellung, wo durch die Befestigungsarbeiten
während des Krieges gleich acht verschiedene Fundstellen angeschnitten worden
sind. Ähnlich müssen die Verhältnisse im Neckardelta um Mannheim gewesen
sein, wo der Boden ebenfalls fortwährend neue Materialien freigibt. Neben den
Tallagen sind auch neue Höhensiedlungen bekannt geworden. Ein paar Scher-
ben vom Schönberg bei Freiburg beweisen nunmehr auch eine Besiedlung
15
225
Die reichen Schmuckbänder in echter guter Kerbschnittechnik weisen vielmehr
eindeutig auf eine westliche Arbeit hin. Hagenau und die Schwäbische Alb
kennen beide diesen Zierstil, so daß es zunächst schwerfallen möchte, welcher
von ihnen das Ihringer Gefäß seine Anregung verdankt. Andererseits lassen
sich aber doch deutliche Unterschiede erkennen. Schon F. Holste (a. a. O. 84)
hat den mittelrheinischen Kerbschnitt mit Hagenau in Verbindung gebracht
und ihn als eine Sondergruppe ausgeschieden. Typisch ist hier, daß die Schul-
terzier der Gefäße fransenartig auf die Bauchwölbung herabhängt (vgl. etwa
G. Behrens, Bronzezeit a. a. O., Taf. 19; Ausnahme ebenda Nr. 7, vielleicht als
Beeinflussung von der Alb her anzusehen). Gleiches wird in Hagenau, nur mit
etwas anderen Mittel erreicht (F. A. Schaeffer a. a. O., Taf. 10; G. Behrens,
a. a. O., Taf. 16).
Ganz anders verfährt man auf der Alb. Hier ist der Kerbschnitt mit einem aus-
gesprochenen Bänderstil verknüpft, der in deutlich getrennten Zonen die Schul-
ter umspannt (vgl. etwa G. Kraft, Kultur der Bronzezeit, Taf. 36; 37, 1. 5. 6;
41, 4—8; 42, 1. 4. 5; 44, 4. 6. 7; 45, 1. — G. Behrens a. a. O., Taf. 13, 2—5; 15,
4. 6. 9). Fransenbildungen fehlen nahezu völlig.
Ordnen wir unser Ihringer Gefäß in diese Ziersysteme ein, so weist es ausge-
gesprochen zur Alb hin. Hier wie dort findet sich die gleiche, fransenlose, zonale
Anordnung der Kerbschnittzier. Die Analyse ergibt demnach, daß die äußere
Form des Ihringer Gefäßes nach Hagenau, der Zierstil dagegen zur Alb ten-
diert. Das paßt aber genau zu der schon früher ausgesprochenen Ansicht (Bad.
Fundber. 17, 1941—1947, 273), daß sich das südliche Oberrheingebiet während
der Bronzezeit offenbar im Schnittpunkt der Ausstrahlungen befindet, die von
den sehr ausgeprägten Zentren des Hagenauer Waldes und der Schwäbischen
Alb ausgehen und die gleichermaßen ins Rheintal wirken. Es ist schwer zu
sagen, welcher Einfluß dabei der dominierende war. Man möchte Hagenau fast
den Vorrang zuerkennen, wenn man etwa die schon frühurnenfelderzeitliche
Fußschale von Erzingen, Ldkrs. Waldshut (vgl. dieser Band Taf. 17, 7) heran-
zieht, die gleichfalls noch deutliche Hagenauer Einwirkungen verrät. In solcher
Sicht erhält auch das Ihringer Fußgefäß seine eigentliche Bedeutung. Es wäre
sehr erwünscht, wenn auch einmal die Bronzen des südlichen Oberrheintales
einer genaueren Untersuchung unterzogen würden, um die Gruppenbildung
während der Hügelgräberzeit genauer abzugrenzen.
Mtbl. 105 Breisach. — Verbleib: MfU. Freiburg. (Kimmig)
Urnenfelderzeit
Wie nicht anders zu erwarten, ist die Urnenfelderkultur auch während der
vorliegenden Berichtszeit stark in Erscheinung getreten. Dazu werden wie
üblich ältere, noch nicht veröffentlichte Funde vorgelegt.
Von der Dichte der Besiedlung während unseres Zeitabschnitts gibt etwa die
Gemarkung Ihringen eine gute Vorstellung, wo durch die Befestigungsarbeiten
während des Krieges gleich acht verschiedene Fundstellen angeschnitten worden
sind. Ähnlich müssen die Verhältnisse im Neckardelta um Mannheim gewesen
sein, wo der Boden ebenfalls fortwährend neue Materialien freigibt. Neben den
Tallagen sind auch neue Höhensiedlungen bekannt geworden. Ein paar Scher-
ben vom Schönberg bei Freiburg beweisen nunmehr auch eine Besiedlung
15