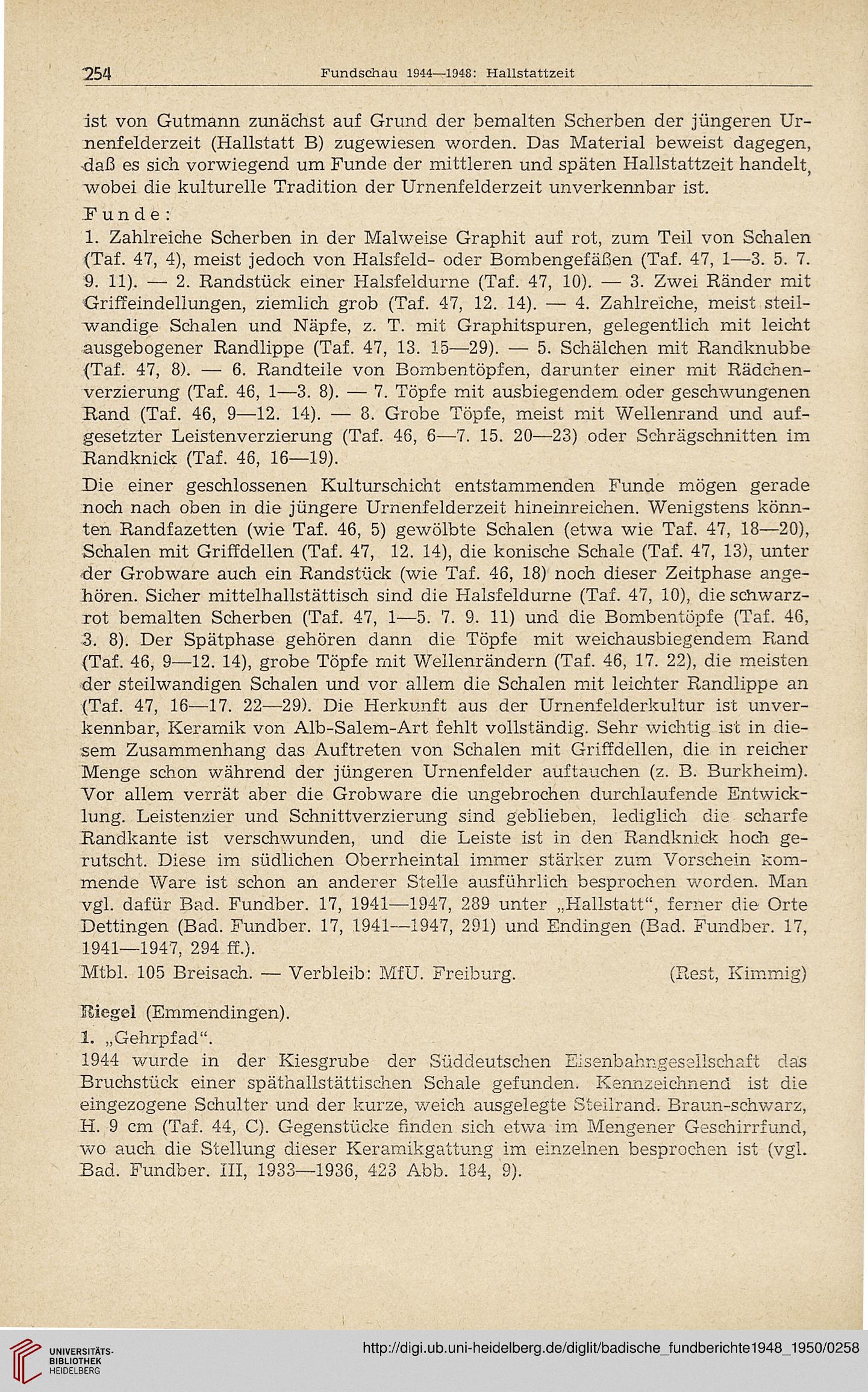254
Fundschau 1944—1948: Hallstattzeit
ist von Gutmann zunächst auf Grund der bemalten Scherben der jüngeren Ur-
nenfelderzeit (Hallstatt B) zugewiesen worden. Das Material beweist dagegen,
daß es sich vorwiegend um Funde der mittleren und späten Hallstattzeit handelt,
wobei die kulturelle Tradition der Urnenfelderzeit unverkennbar ist.
Bunde:
1. Zahlreiche Scherben in der Malweise Graphit auf rot, zum Teil von Schalen
(Taf. 47, 4), meist jedoch von Halsfeld- oder Bombengefäßen (Taf. 47, 1—3. 5. 7.
9. 11). — 2. Randstück einer Halsfeldurne (Taf. 47, 10). — 3. Zwei Ränder mit
Griffeindellungen, ziemlich grob (Taf. 47, 12. 14). — 4. Zahlreiche, meist steil-
wandige Schalen und Näpfe, z. T. mit Graphitspuren, gelegentlich mit leicht
ausgebogener Randlippe (Taf. 47, 13. 15—29). — 5. Schälchen mit Randknubbe
(Taf. 47, 8). — 6. Randteile von Bombentöpfen, darunter einer mit Rädchen-
verzierung (Taf. 46, 1—3. 8). — 7. Töpfe mit ausbiegendem oder geschwungenen
Rand (Taf. 46, 9—12. 14). — 8. Grobe Töpfe, meist mit Wellenrand und auf-
gesetzter Leistenverzierung (Taf. 46, 6—7. 15. 20—23) oder Schrägschnitten im
Randknick (Taf. 46, 16—19).
Die einer geschlossenen Kulturschicht entstammenden Funde mögen gerade
noch nach oben in die jüngere Urnenfelderzeit hineinreichen. Wenigstens könn-
ten Randfazetten (wie Taf. 46, 5) gewölbte Schalen (etwa wie Taf. 47, 18—20),
Schalen mit Griffdellen (Taf. 47, 12. 14), die konische Schale (Taf. 47, 13), unter
der Grobware auch ein Randstück (wie Taf. 46, 18) noch dieser Zeitphase ange-
hören. Sicher mittelhallstättisch sind die Halsfeldurne (Taf. 47, 10), die schwarz-
rot bemalten Scherben (Taf. 47, 1—5. 7. 9. 11) und die Bombentöpfe (Taf. 46,
3. 8). Der Spätphase gehören dann die Töpfe mit weichausbiegendem Rand
(Taf. 46, 9—12. 14), grobe Töpfe mit Wellenrändern (Taf. 46, 17. 22), die meisten
der steilwandigen Schalen und vor allem die Schalen mit leichter Randlippe an
(Taf. 47, 16—17. 22—29). Die Herkunft aus der Urnenfelderkultur ist unver-
kennbar, Keramik von Alb-Salem-Art fehlt vollständig. Sehr wichtig ist in die-
sem Zusammenhang das Auftreten von Schalen mit Griffdellen, die in reicher
Menge schon während der jüngeren Urnenfelder auftauchen (z. B. Burkheim).
Vor allem verrät aber die Grobware die ungebrochen durchlaufende Entwick-
lung. Leistenzier und Schnittverzierung sind geblieben, lediglich die scharfe
Randkante ist verschwunden, und die Leiste ist in den Randknick hoch ge-
rutscht. Diese im südlichen Oberrheintal immer stärker zum Vorschein kom-
mende Ware ist schon an anderer Stelle ausführlich besprochen worden. Man
vgl. dafür Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 289 unter „Hallstatt“, ferner die Orte
Dettingen (Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 291) und Endingen (Bad. Fundber. 17,
1941—1947, 294 ff.).
Mtbl. 105 Breisach. — Verbleib: MfU. Freiburg. (Rest, Kimmig)
Riegel (Emmendingen).
1. „Gehrpfad“.
1944 wurde in der Kiesgrube der Süddeutschen Eisenbahngesellschaft das
Bruchstück einer späthallstättischen Schale gefunden. Kennzeichnend ist die
eingezogene Schulter und der kurze, weich ausgelegte Steilrand. Braun-schwarz,
H. 9 cm (Taf. 44, C). Gegenstücke finden sich etwa im Mengener Geschirrfund,
wo auch die Stellung dieser Keramikgattung im einzelnen besprochen ist (vgl.
Bad. Fundber. III, 1933—1936, 423 Abb. 184, 9).
Fundschau 1944—1948: Hallstattzeit
ist von Gutmann zunächst auf Grund der bemalten Scherben der jüngeren Ur-
nenfelderzeit (Hallstatt B) zugewiesen worden. Das Material beweist dagegen,
daß es sich vorwiegend um Funde der mittleren und späten Hallstattzeit handelt,
wobei die kulturelle Tradition der Urnenfelderzeit unverkennbar ist.
Bunde:
1. Zahlreiche Scherben in der Malweise Graphit auf rot, zum Teil von Schalen
(Taf. 47, 4), meist jedoch von Halsfeld- oder Bombengefäßen (Taf. 47, 1—3. 5. 7.
9. 11). — 2. Randstück einer Halsfeldurne (Taf. 47, 10). — 3. Zwei Ränder mit
Griffeindellungen, ziemlich grob (Taf. 47, 12. 14). — 4. Zahlreiche, meist steil-
wandige Schalen und Näpfe, z. T. mit Graphitspuren, gelegentlich mit leicht
ausgebogener Randlippe (Taf. 47, 13. 15—29). — 5. Schälchen mit Randknubbe
(Taf. 47, 8). — 6. Randteile von Bombentöpfen, darunter einer mit Rädchen-
verzierung (Taf. 46, 1—3. 8). — 7. Töpfe mit ausbiegendem oder geschwungenen
Rand (Taf. 46, 9—12. 14). — 8. Grobe Töpfe, meist mit Wellenrand und auf-
gesetzter Leistenverzierung (Taf. 46, 6—7. 15. 20—23) oder Schrägschnitten im
Randknick (Taf. 46, 16—19).
Die einer geschlossenen Kulturschicht entstammenden Funde mögen gerade
noch nach oben in die jüngere Urnenfelderzeit hineinreichen. Wenigstens könn-
ten Randfazetten (wie Taf. 46, 5) gewölbte Schalen (etwa wie Taf. 47, 18—20),
Schalen mit Griffdellen (Taf. 47, 12. 14), die konische Schale (Taf. 47, 13), unter
der Grobware auch ein Randstück (wie Taf. 46, 18) noch dieser Zeitphase ange-
hören. Sicher mittelhallstättisch sind die Halsfeldurne (Taf. 47, 10), die schwarz-
rot bemalten Scherben (Taf. 47, 1—5. 7. 9. 11) und die Bombentöpfe (Taf. 46,
3. 8). Der Spätphase gehören dann die Töpfe mit weichausbiegendem Rand
(Taf. 46, 9—12. 14), grobe Töpfe mit Wellenrändern (Taf. 46, 17. 22), die meisten
der steilwandigen Schalen und vor allem die Schalen mit leichter Randlippe an
(Taf. 47, 16—17. 22—29). Die Herkunft aus der Urnenfelderkultur ist unver-
kennbar, Keramik von Alb-Salem-Art fehlt vollständig. Sehr wichtig ist in die-
sem Zusammenhang das Auftreten von Schalen mit Griffdellen, die in reicher
Menge schon während der jüngeren Urnenfelder auftauchen (z. B. Burkheim).
Vor allem verrät aber die Grobware die ungebrochen durchlaufende Entwick-
lung. Leistenzier und Schnittverzierung sind geblieben, lediglich die scharfe
Randkante ist verschwunden, und die Leiste ist in den Randknick hoch ge-
rutscht. Diese im südlichen Oberrheintal immer stärker zum Vorschein kom-
mende Ware ist schon an anderer Stelle ausführlich besprochen worden. Man
vgl. dafür Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 289 unter „Hallstatt“, ferner die Orte
Dettingen (Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 291) und Endingen (Bad. Fundber. 17,
1941—1947, 294 ff.).
Mtbl. 105 Breisach. — Verbleib: MfU. Freiburg. (Rest, Kimmig)
Riegel (Emmendingen).
1. „Gehrpfad“.
1944 wurde in der Kiesgrube der Süddeutschen Eisenbahngesellschaft das
Bruchstück einer späthallstättischen Schale gefunden. Kennzeichnend ist die
eingezogene Schulter und der kurze, weich ausgelegte Steilrand. Braun-schwarz,
H. 9 cm (Taf. 44, C). Gegenstücke finden sich etwa im Mengener Geschirrfund,
wo auch die Stellung dieser Keramikgattung im einzelnen besprochen ist (vgl.
Bad. Fundber. III, 1933—1936, 423 Abb. 184, 9).