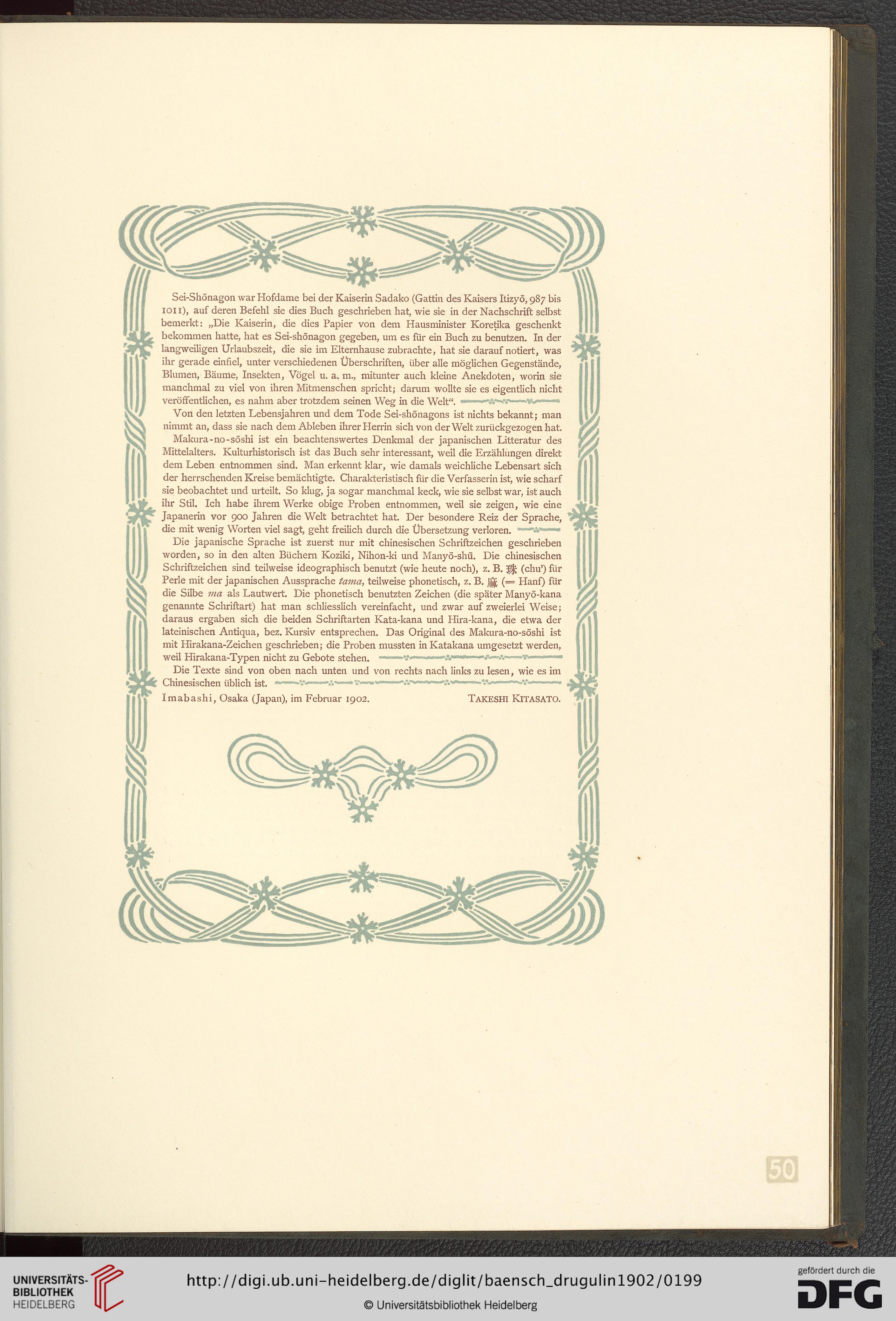Sei-Shönagon war Hofdame bei der Kaiserin Sadako (Gattin des Kaisers Itizyö, 987 bis
ion), auf deren Befehl sie dies Buch geschrieben hat, wie sie in der Nachschrift selbst
bemerkt: „Die Kaiserin, die dies Papier von dem Haus minister Koretika geschenkt
bekommen hatte, hat es Sei-shönagon gegeben, um es für ein Buch zu benutzen. In der
langweiligen Urlaubszeit, die sie im Elternhause zubrachte, hat sie darauf notiert, was
ihr gerade einfiel, unter verschiedenen Überschriften, über alle möglichen Gegenstände,
Blumen, Bäume, Insekten, Vögel u. a. m., mitunter auch kleine Anekdoten, worin sie
manchmal zu viel von ihren Mitmenschen spricht; darum wollte sie es eigentlich nicht
veröffentlichen, es nahm aber trotzdem seinen Weg in die Welt". - **'
Von den letzten Lebensjahren und dem Tode Sei-shönagons ist nichts bekannt; man
nimmt an, dass sie nach dem Ableben ihrer Herrin sich von der Welt zurückgezogen hat.
Makura-no-söshi ist ein beachtenswertes Denkmal der japanischen Litteratur des
Mittelalters. Kulturhistorisch ist das Buch sehr interessant, weil die Erzählungen direkt
dem Leben entnommen sind. Man erkennt klar, wie damals weichliche Lebensart sich
der herrschenden Kreise bemächtigte. Charakteristisch für die Verfasserin ist, wie scharf
sie beobachtet und urteilt. So klug, ja sogar manchmal keck, wie sie selbst war, ist auch
ihr Stil. Ich habe ihrem Werke obige Proben entnommen, weil sie zeigen, wie eine
Japanerin vor 900 Jahren die Welt betrachtet hat. Der besondere Reiz der Sprache,
die mit wenig Worten viel sagt, geht freilich durch die Übersetzung verloren. *-***&*"-"*
Die japanische Sprache ist zuerst nur mit chinesischen Schriftzeichen geschrieben
worden, so in den alten Büchern Koziki, Nihon-ki und Manyö-shü. Die chinesischen
Schriftzeichen sind teilweise ideographisch benutzt (wie heute noch), z. B. 3% (chu') für
Perle mit der japanischen Aussprache Aw?;?, teilweise phonetisch, z. B. ^ (— Hanf) für
die Silbe 7//% als Lautwert. Die phonetisch benutzten Zeichen (die später Manyö-kana
genannte Schriftart) hat man schliesslich vereinfacht, und zwar auf zweierlei Weise;
daraus ergaben sich die beiden Schriftarten Kata-kana und Hira-kana, die etwa der
lateinischen Antiqua, bez. Kursiv entsprechen. Das Original des Makura-no-söshi ist
mit Hirakana-Zeichen geschrieben; die Proben mussten in Katakana umgesetzt werden,
weil Hirakana-Typen nicht zu Gebote stehen. - *- <*A""^ v* . - «*
Die Texte sind von oben nach unten und von rechts nach links zu lesen, wie es im
Chinesischen üblich ist. **—A-*— ? — v———
Imabashi, Osaka (Japan), im Februar 1902. TAKESHI KlTASATO.