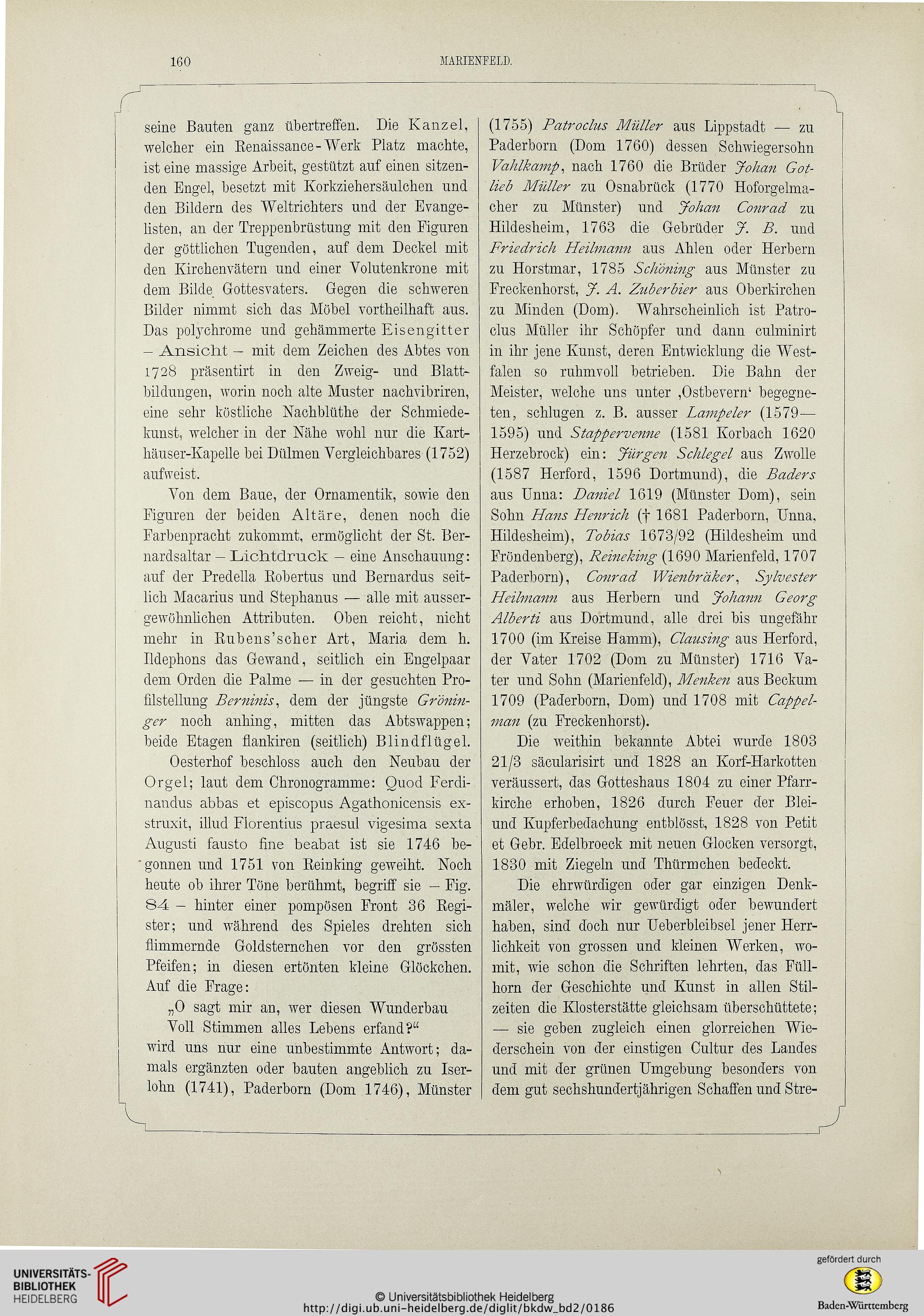160
MARIENFELD.
seine Bauten ganz übertreffen. Die Kanzel,
welcher ein Renaissance-Werk Platz machte,
ist eine massige Arbeit, gestützt auf einen sitzen-
den Engel, besetzt mit Korkziehers äulchen und
den Bildern des Weltrichters und der Evange-
listen, an der Treppenbrüstung mit den Figuren
der göttlichen Tugenden, auf dem Deckel mit
den Kirchenvätern und einer Volutenkrone mit
dem Bilde Gottesvaters. Gegen die schweren
Bilder nimmt sich das Möbel vortheilhaft aus.
Das polychrome und gehämmerte Eisengitter
- Ansicht - mit dem Zeichen des Abtes von
1728 präsentirt in den Zweig- und Blatt-
bildungen, worin noch alte Muster nachvibriren,
eine sehr köstliche Nachblüthe der Schmiede-
kunst, welcher in der Nähe wohl nur die Kart-
häuser-Kapelle bei Dülmen Vergleichbares (1752)
aufweist.
Von dem Baue, der Ornamentik, sowie den
Figuren der beiden Altäre, denen noch die
Farbenpracht zukommt, ermöglicht der St. Ber-
nardsaltar — Lichtdruck — eine Anschauung:
auf der Predella Bobertus und Bernardus seit-
lich Macarius und Stephanus — alle mit ausser-
gewölmlichen Attributen. Oben reicht, nicht
mehr in Rubens’scher Art, Maria dem h.
Ildephons das Gewand, seitlich ein Engelpaar
dem Orden die Palme — in der gesuchten Pro-
filstellung Berninis, dem der jüngste Gr'önin-
ger noch anhing, mitten das Abtswappen;
beide Etagen flankiren (seitlich) Blindflügel.
Oesterhof beschloss auch den Neubau der
Orgel; laut dem Chronogramme: Ouod Fercli-
nandus abbas et episcopus Agathonicensis ex-
struxit, illud Florentius praesul vigesima sexta
Augusti fausto fine beabat ist sie 1746 be-
gonnen und 1751 von Reinking geweiht. Noch
heute ob ihrer Töne berühmt, begriff sie — Fig.
84 - hinter einer pompösen Front 36 Regi-
ster; und während des Spieles drehten sich
flimmernde Goldsternchen vor den grössten
Pfeifen; in diesen ertönten kleine Glöckchen.
Auf die Frage:
„0 sagt mir an, wer diesen Wunderbau
Voll Stimmen alles Lebens erfand?“
wird uns nur eine unbestimmte Antwort; da-
mals ergänzten oder bauten angeblich zu Iser-
lohn (1741), Paderborn (Dom 1746), Münster
(1755) Patroclus Müller aus Lippstadt — zu
Paderborn (Dom 1760) dessen Schwiegersohn
Vahlkamp, nach 1760 die Brüder Johan Got-
lieb Müller zu Osnabrück (1770 Hoforgelma-
cher zu Münster) und Johan Coyirad zu
Hildesheim, 1763 die Gebrüder J. B. und
Friedrich Heilmann aus Ahlen oder Herbern
zu Horstmar, 1785 Schöning aus Münster zu
Freckenhorst, J. A. Zuberbier aus Oberkirchen
zu Minden (Dom). Wahrscheinlich ist Patro-
clus Müller ihr Schöpfer und dann culminirt
in ihr jene Kunst, deren Entwicklung die West-
falen so ruhmvoll betrieben. Die Bahn der
Meister, welche uns unter ,Ostbevern4 begegne-
ten, schlugen z. B. ausser Lampeler (1579—
1595) und Stapperve7ine (1581 Korbach 1620
Herzebrock) ein: Jürgen Schlegel aus Zwolle
(1587 Herford, 1596 Dortmund), die Baders
aus Unna: Daniel 1619 (Münster Dom), sein
Sohn Hans Henrich (f 1681 Paderborn, Unna,
Hildesheim), Tobias 1673/92 (Hildesheim und
Fröndenberg), Reineking (1690 Marienfeld, 1707
Paderborn), Conrad Wienbräker, Sylvester
Heilmann aus Herbern und Johann Georg
Alberti aus Dortmund, alle drei bis ungefähr
1700 (im Kreise Hamm), Clausing aus Herford,
der Vater 1702 (Dom zu Münster) 1716 Va-
ter und Sohn (Marienfeld), Menken aus Beckum
1709 (Paderborn, Dom) und 1708 mit Cappel-
man (zu Freckenhorst).
Die weithin bekannte Abtei wurde 1803
21/3 säcularisirt und 1828 an Korf-Harkotten
veräussert, das Gotteshaus 1804 zu einer Pfarr-
kirche erhoben, 1826 durch Feuer der Blei-
uncl Kupferbedachung entblösst, 1828 von Petit
et Gebr. Edelbroeck mit neuen Glocken versorgt,
1830 mit Ziegeln und Thürmchen bedeckt.
Die ehrwürdigen oder gar einzigen Denk-
mäler, welche wir gewürdigt oder bewundert
haben, sind doch nur Ueberbleibsel jener Herr-
lichkeit von grossen und kleinen Werken, wo-
mit, wie schon die Schriften lehrten, das Füll-
horn der Geschichte und Kunst in allen Stil-
zeiten die Klosterstätte gleichsam überschüttete;
— sie geben zugleich einen glorreichen Wie-
derschein von der einstigen Cultur des Landes
und mit der grünen Umgebung besonders von
dem gut sechshundertjährigen Schaffen und Stre-
MARIENFELD.
seine Bauten ganz übertreffen. Die Kanzel,
welcher ein Renaissance-Werk Platz machte,
ist eine massige Arbeit, gestützt auf einen sitzen-
den Engel, besetzt mit Korkziehers äulchen und
den Bildern des Weltrichters und der Evange-
listen, an der Treppenbrüstung mit den Figuren
der göttlichen Tugenden, auf dem Deckel mit
den Kirchenvätern und einer Volutenkrone mit
dem Bilde Gottesvaters. Gegen die schweren
Bilder nimmt sich das Möbel vortheilhaft aus.
Das polychrome und gehämmerte Eisengitter
- Ansicht - mit dem Zeichen des Abtes von
1728 präsentirt in den Zweig- und Blatt-
bildungen, worin noch alte Muster nachvibriren,
eine sehr köstliche Nachblüthe der Schmiede-
kunst, welcher in der Nähe wohl nur die Kart-
häuser-Kapelle bei Dülmen Vergleichbares (1752)
aufweist.
Von dem Baue, der Ornamentik, sowie den
Figuren der beiden Altäre, denen noch die
Farbenpracht zukommt, ermöglicht der St. Ber-
nardsaltar — Lichtdruck — eine Anschauung:
auf der Predella Bobertus und Bernardus seit-
lich Macarius und Stephanus — alle mit ausser-
gewölmlichen Attributen. Oben reicht, nicht
mehr in Rubens’scher Art, Maria dem h.
Ildephons das Gewand, seitlich ein Engelpaar
dem Orden die Palme — in der gesuchten Pro-
filstellung Berninis, dem der jüngste Gr'önin-
ger noch anhing, mitten das Abtswappen;
beide Etagen flankiren (seitlich) Blindflügel.
Oesterhof beschloss auch den Neubau der
Orgel; laut dem Chronogramme: Ouod Fercli-
nandus abbas et episcopus Agathonicensis ex-
struxit, illud Florentius praesul vigesima sexta
Augusti fausto fine beabat ist sie 1746 be-
gonnen und 1751 von Reinking geweiht. Noch
heute ob ihrer Töne berühmt, begriff sie — Fig.
84 - hinter einer pompösen Front 36 Regi-
ster; und während des Spieles drehten sich
flimmernde Goldsternchen vor den grössten
Pfeifen; in diesen ertönten kleine Glöckchen.
Auf die Frage:
„0 sagt mir an, wer diesen Wunderbau
Voll Stimmen alles Lebens erfand?“
wird uns nur eine unbestimmte Antwort; da-
mals ergänzten oder bauten angeblich zu Iser-
lohn (1741), Paderborn (Dom 1746), Münster
(1755) Patroclus Müller aus Lippstadt — zu
Paderborn (Dom 1760) dessen Schwiegersohn
Vahlkamp, nach 1760 die Brüder Johan Got-
lieb Müller zu Osnabrück (1770 Hoforgelma-
cher zu Münster) und Johan Coyirad zu
Hildesheim, 1763 die Gebrüder J. B. und
Friedrich Heilmann aus Ahlen oder Herbern
zu Horstmar, 1785 Schöning aus Münster zu
Freckenhorst, J. A. Zuberbier aus Oberkirchen
zu Minden (Dom). Wahrscheinlich ist Patro-
clus Müller ihr Schöpfer und dann culminirt
in ihr jene Kunst, deren Entwicklung die West-
falen so ruhmvoll betrieben. Die Bahn der
Meister, welche uns unter ,Ostbevern4 begegne-
ten, schlugen z. B. ausser Lampeler (1579—
1595) und Stapperve7ine (1581 Korbach 1620
Herzebrock) ein: Jürgen Schlegel aus Zwolle
(1587 Herford, 1596 Dortmund), die Baders
aus Unna: Daniel 1619 (Münster Dom), sein
Sohn Hans Henrich (f 1681 Paderborn, Unna,
Hildesheim), Tobias 1673/92 (Hildesheim und
Fröndenberg), Reineking (1690 Marienfeld, 1707
Paderborn), Conrad Wienbräker, Sylvester
Heilmann aus Herbern und Johann Georg
Alberti aus Dortmund, alle drei bis ungefähr
1700 (im Kreise Hamm), Clausing aus Herford,
der Vater 1702 (Dom zu Münster) 1716 Va-
ter und Sohn (Marienfeld), Menken aus Beckum
1709 (Paderborn, Dom) und 1708 mit Cappel-
man (zu Freckenhorst).
Die weithin bekannte Abtei wurde 1803
21/3 säcularisirt und 1828 an Korf-Harkotten
veräussert, das Gotteshaus 1804 zu einer Pfarr-
kirche erhoben, 1826 durch Feuer der Blei-
uncl Kupferbedachung entblösst, 1828 von Petit
et Gebr. Edelbroeck mit neuen Glocken versorgt,
1830 mit Ziegeln und Thürmchen bedeckt.
Die ehrwürdigen oder gar einzigen Denk-
mäler, welche wir gewürdigt oder bewundert
haben, sind doch nur Ueberbleibsel jener Herr-
lichkeit von grossen und kleinen Werken, wo-
mit, wie schon die Schriften lehrten, das Füll-
horn der Geschichte und Kunst in allen Stil-
zeiten die Klosterstätte gleichsam überschüttete;
— sie geben zugleich einen glorreichen Wie-
derschein von der einstigen Cultur des Landes
und mit der grünen Umgebung besonders von
dem gut sechshundertjährigen Schaffen und Stre-