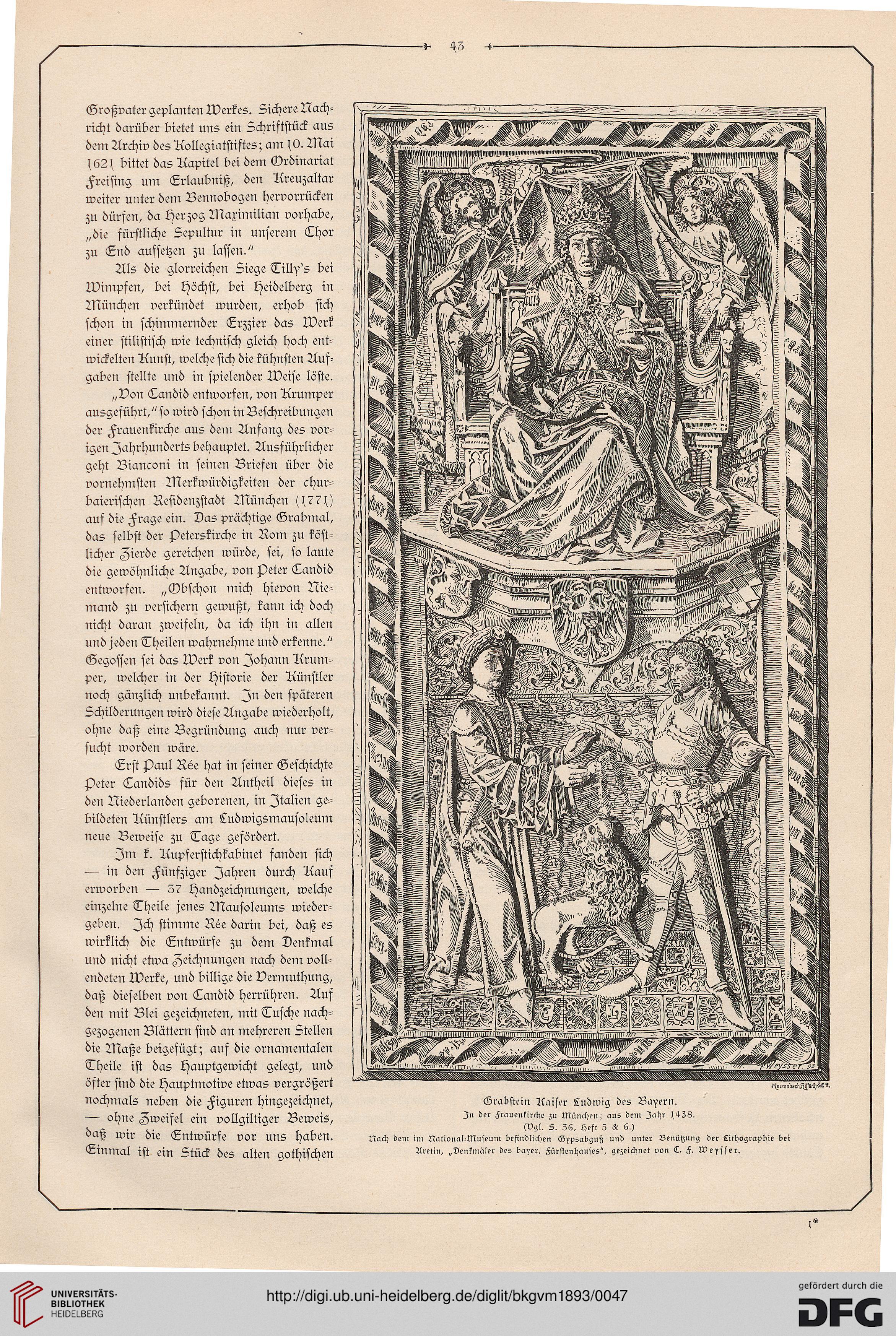4- % 5 4'
\
\
Großvater geplanten Werkes. Sichere Nach-
richt darüber bietet uns ein Schriftstück aus
denr Archiv desAollegiatstiftes; am W. Mai
\62\ bittet das Aapitel bei dem Ordinariat
Freising um Erlaubniß, den Areuzaltar
weiter unter dem Bennobogen hervorrücken
zu dürfen, da Herzog Maximilian vorhabe,
„die fürstliche Sepultur in unserem Thor
zu End auffetzen zu lassen."
Als die glorreichen Siege Tilly's bei
Wimpfen, bei höchst, bei Heidelberg in
München verkündet wurden, erhob sich
schon in schiinmernder Erzzier das Werk
einer stilistisch wie technisch gleich hoch ent-
wickelten Ärmst, welche sich die kühnsten Aus-
gaben stellte und in spielender Weise löste.
„Von Eandid entworfen, von Arumper
ausgeführt," so wird schon in Beschreibungen
der Frauenkirche aus den, Anfang des vor-
igen Jahrhunderts behauptet. Ausführlicher
geht Bianconi in seinen Briefen über die
vornehnrsten Merkwürdigkeiten der chur
baierischen Residenzstadt München (\77{)
auf die Frage ein. Das prächtige Grabmal,
das selbst der Peterskirche irr Rom zu köst-
licher Zierde gereichen würde, sei, so laute
die gewöhnliche Angabe, von Peter Landid
entworfen. „Obschon mich hievon Nie-
mand zu versichern gewußt, kann ich doch
nicht daran zweifeln, da ich ihn in allen
und jeden Theilen wahrnehme und erkenne."
Gegossen sei das Werk von Johann Arum-
per, welcher in der Historie der Aünstler
noch gänzlich unbekannt. Zn den späteren
Schilderungen wird diese Angabe wiederholt,
ohne daß eine Begründung auch nur ver-
sucht worden wäre.
Erst Paul Ree hat in seiner Geschichte
Peter Eandids für den Antheil dieses in
den Niederlanden geborenen, in Ztalien ge-
bildeten Aünstlers am Ludwigsmausoleum
neue Beweise zu Tage gefördert.
Zm k. Aupferstichkabinet fanden sich
— in den Fünfziger Zähren durch Aauf
erworben — 57 Handzeichnungen, welche
einzelne Thcile jenes Mausoleums wieder-
geben. Zch stimme Ree darin bei, daß es
wirklich die Entwürfe zu dein Denkmal
und nicht etwa Zeichnungen nach dein voll-
endeten Werke, und billige die Vermuthung,
daß dieselbeii von Taiidid herrühren. Auf
deii mit Blei gezeichneten, mit Tusche nach-
gezogenen Blättern sind an mehreren Stellen
die Maße beigesügt; auf die ornamentalen
Theile ist das Hauptgewicht gelegt, und
öfter siiid die Hauptmotive etwas vergrößert
nochiiials neben die Figuren hingezeichnet,
— ohne Zweifel ein vollgilliger Beweis,
daß wir die Entwürfe vor uns haben.
Einiiial ist ein Stück des alten gothischen
Grabstein Kiiifcr Ludwig des Bayern.
In der Frauenkirche zu München; aus dem Jahr (438.
(vgl. 5. 36, Heft 5 & 6.)
Nach deni im National-Museuni befindlichen Gyp->abguß und unter Benützung der Lithographie bei
Aretin, „Denkmäler des bayer. Fürstenhauses", gezeichnet von C. F. Meysser.
1