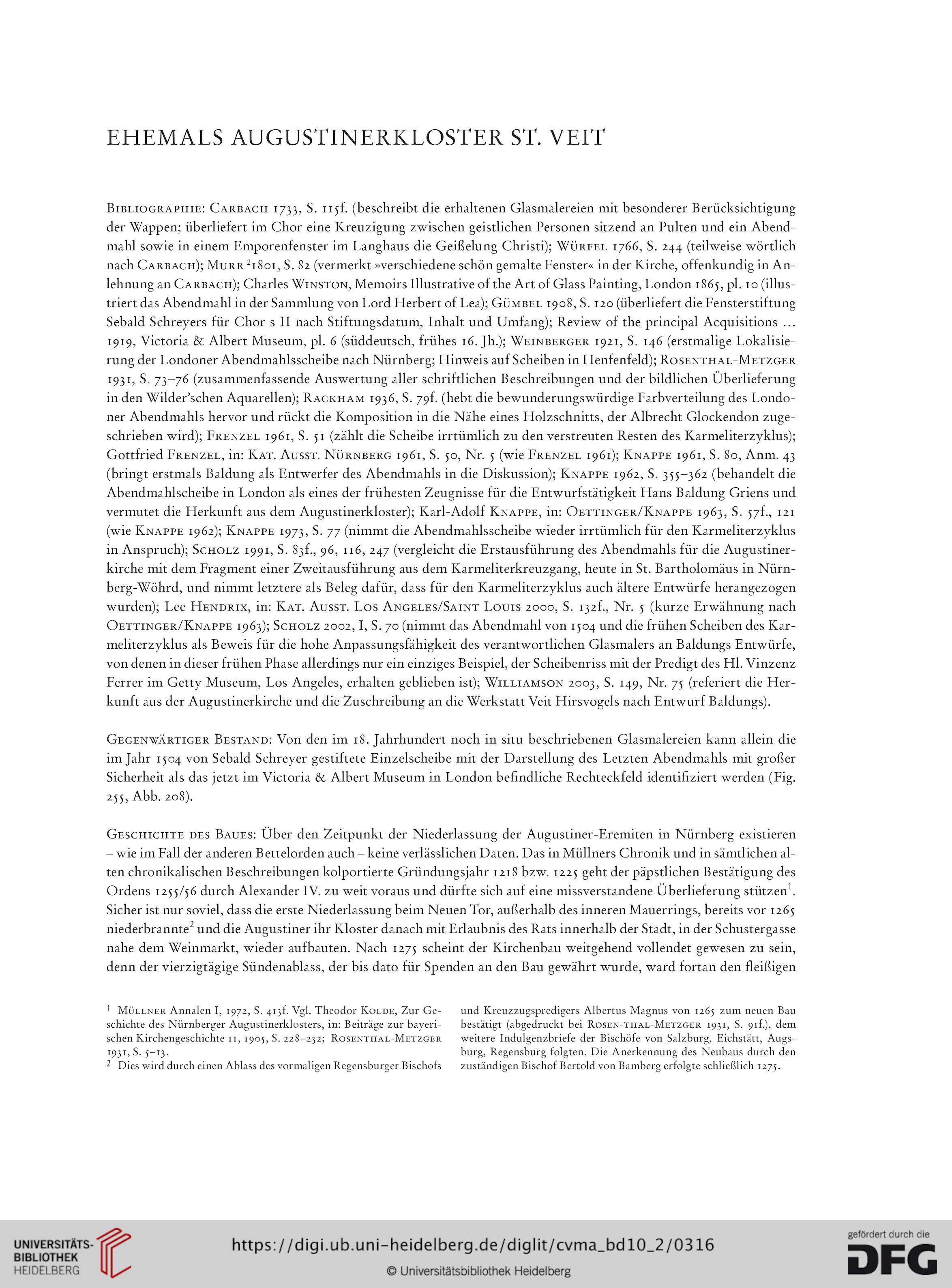EHEMALS AUGUSTINERKLOSTER ST. VEIT
Bibliographie: Carbach 1733, S. 115L (beschreibt die erhaltenen Glasmalereien mit besonderer Berücksichtigung
der Wappen; überliefert im Chor eine Kreuzigung zwischen geistlichen Personen sitzend an Pulten und ein Abend-
mahl sowie in einem Emporenfenster im Langhaus die Geißelung Christi); Würfel 1766, S. 244 (teilweise wörtlich
nach Carbach); Murr 2i8oi, S. 82 (vermerkt »verschiedene schön gemalte Fenster« in der Kirche, offenkundig in An-
lehnung an Carbach); Charles Winston, Memoirs Illustrative of the Art of Glass Painting, London 1865, pl. 10 (illus-
triert das Abendmahl in der Sammlung von Lord Herbert of Lea); Gümbel 1908, S. 120 (überliefert die Fensterstiftung
Sebald Schreyers für Chor s II nach Stiftungsdatum, Inhalt und Umfang); Review of the principal Acquisitions ...
1919, Victoria & Albert Museum, pl. 6 (süddeutsch, frühes 16. Jh.); Weinberger 1921, S. 146 (erstmalige Lokalisie-
rung der Londoner Abendmahlsscheibe nach Nürnberg; Hinweis auf Scheiben in Henfenfeld); Rosenthal-Metzger
1931, S. 73-76 (zusammenfassende Auswertung aller schriftlichen Beschreibungen und der bildlichen Überlieferung
in den Wilder’schen Aquarellen); Rackham 1936, S. 79L (hebt die bewunderungswürdige Farbverteilung des Londo-
ner Abendmahls hervor und rückt die Komposition in die Nähe eines Holzschnitts, der Albrecht Glockendon zuge-
schrieben wird); Frenzel 1961, S. 51 (zählt die Scheibe irrtümlich zu den verstreuten Resten des Karmeliterzyklus);
Gottfried Frenzel, in: Kat. Ausst. Nürnberg 1961, S. 50, Nr. 5 (wie Frenzel 1961); Knappe 1961, S. 80, Anm. 43
(bringt erstmals Baldung als Entwerfer des Abendmahls in die Diskussion); Knappe 1962, S. 355-362 (behandelt die
Abendmahlscheibe in London als eines der frühesten Zeugnisse für die Entwurfstätigkeit Hans Baldung Griens und
vermutet die Herkunft aus dem Augustinerkloster); Karl-Adolf Knappe, in: Oettinger/Knappe 1963, S. 57E, 121
(wie Knappe 1962); Knappe 1973, S. 77 (nimmt die Abendmahlsscheibe wieder irrtümlich für den Karmeliterzyklus
in Anspruch); Scholz 1991, S. 83E, 96, 116, 247 (vergleicht die Erstausführung des Abendmahls für die Augustiner-
kirche mit dem Fragment einer Zweitausführung aus dem Karmeliterkreuzgang, heute in St. Bartholomäus in Nürn-
berg-Wöhrd, und nimmt letztere als Beleg dafür, dass für den Karmeliterzyklus auch ältere Entwürfe herangezogen
wurden); Lee Hendrix, in: Kat. Ausst. Los Angeles/Saint Louis 2000, S. 132L, Nr. 5 (kurze Erwähnung nach
Oettinger/Knappe 1963); Scholz 2002,1, S. 70 (nimmt das Abendmahl von 1504 und die frühen Scheiben des Kar-
meliterzyklus als Beweis für die hohe Anpassungsfähigkeit des verantwortlichen Glasmalers an Baldungs Entwürfe,
von denen in dieser frühen Phase allerdings nur ein einziges Beispiel, der Scheibenriss mit der Predigt des Hl. Vinzenz
Ferrer im Getty Museum, Los Angeles, erhalten geblieben ist); Williamson 2003, S. 149, Nr. 75 (referiert die Her-
kunft aus der Augustinerkirche und die Zuschreibung an die Werkstatt Veit Hirsvogels nach Entwurf Baldungs).
Gegenwärtiger Bestand: Von den im 18. Jahrhundert noch in situ beschriebenen Glasmalereien kann allein die
im Jahr 1504 von Sebald Schreyer gestiftete Einzelscheibe mit der Darstellung des Letzten Abendmahls mit großer
Sicherheit als das jetzt im Victoria & Albert Museum in London befindliche Rechteckfeld identifiziert werden (Fig.
255, Abb. 208).
Geschichte des Baues: Über den Zeitpunkt der Niederlassung der Augustiner-Eremiten in Nürnberg existieren
- wie im Fall der anderen Bettelorden auch - keine verlässlichen Daten. Das in Müllners Chronik und in sämtlichen al-
ten chronikalischen Beschreibungen kolportierte Gründungsjahr 1218 bzw. 1225 geht der päpstlichen Bestätigung des
Ordens 1255/56 durch Alexander IV. zu weit voraus und dürfte sich auf eine missverstandene Überlieferung stützen1.
Sicher ist nur soviel, dass die erste Niederlassung beim Neuen Tor, außerhalb des inneren Mauerrings, bereits vor 1265
niederbrannte2 und die Augustiner ihr Kloster danach mit Erlaubnis des Rats innerhalb der Stadt, in der Schustergasse
nahe dem Weinmarkt, wieder aufbauten. Nach 1275 scheint der Kirchenbau weitgehend vollendet gewesen zu sein,
denn der vierzigtägige Sündenablass, der bis dato für Spenden an den Bau gewährt wurde, ward fortan den fleißigen
1 Müllner Annalen I, 1972, S. 413L Vgl. Theodor Kolde, Zur Ge-
schichte des Nürnberger Augustinerklosters, in: Beiträge zur bayeri-
schen Kirchengeschichte 11, 1905, S. 228-232; Rosenthal-Metzger
1931, S. 5-13.
2 Dies wird durch einen Ablass des vormaligen Regensburger Bischofs
und Kreuzzugspredigers Albertus Magnus von 1265 zum neuen Bau
bestätigt (abgedruckt bei Rosen-thal-Metzger 1931, S. 91L), dem
weitere Indulgenzbriefe der Bischöfe von Salzburg, Eichstätt, Augs-
burg, Regensburg folgten. Die Anerkennung des Neubaus durch den
zuständigen Bischof Bertold von Bamberg erfolgte schließlich 1275.
Bibliographie: Carbach 1733, S. 115L (beschreibt die erhaltenen Glasmalereien mit besonderer Berücksichtigung
der Wappen; überliefert im Chor eine Kreuzigung zwischen geistlichen Personen sitzend an Pulten und ein Abend-
mahl sowie in einem Emporenfenster im Langhaus die Geißelung Christi); Würfel 1766, S. 244 (teilweise wörtlich
nach Carbach); Murr 2i8oi, S. 82 (vermerkt »verschiedene schön gemalte Fenster« in der Kirche, offenkundig in An-
lehnung an Carbach); Charles Winston, Memoirs Illustrative of the Art of Glass Painting, London 1865, pl. 10 (illus-
triert das Abendmahl in der Sammlung von Lord Herbert of Lea); Gümbel 1908, S. 120 (überliefert die Fensterstiftung
Sebald Schreyers für Chor s II nach Stiftungsdatum, Inhalt und Umfang); Review of the principal Acquisitions ...
1919, Victoria & Albert Museum, pl. 6 (süddeutsch, frühes 16. Jh.); Weinberger 1921, S. 146 (erstmalige Lokalisie-
rung der Londoner Abendmahlsscheibe nach Nürnberg; Hinweis auf Scheiben in Henfenfeld); Rosenthal-Metzger
1931, S. 73-76 (zusammenfassende Auswertung aller schriftlichen Beschreibungen und der bildlichen Überlieferung
in den Wilder’schen Aquarellen); Rackham 1936, S. 79L (hebt die bewunderungswürdige Farbverteilung des Londo-
ner Abendmahls hervor und rückt die Komposition in die Nähe eines Holzschnitts, der Albrecht Glockendon zuge-
schrieben wird); Frenzel 1961, S. 51 (zählt die Scheibe irrtümlich zu den verstreuten Resten des Karmeliterzyklus);
Gottfried Frenzel, in: Kat. Ausst. Nürnberg 1961, S. 50, Nr. 5 (wie Frenzel 1961); Knappe 1961, S. 80, Anm. 43
(bringt erstmals Baldung als Entwerfer des Abendmahls in die Diskussion); Knappe 1962, S. 355-362 (behandelt die
Abendmahlscheibe in London als eines der frühesten Zeugnisse für die Entwurfstätigkeit Hans Baldung Griens und
vermutet die Herkunft aus dem Augustinerkloster); Karl-Adolf Knappe, in: Oettinger/Knappe 1963, S. 57E, 121
(wie Knappe 1962); Knappe 1973, S. 77 (nimmt die Abendmahlsscheibe wieder irrtümlich für den Karmeliterzyklus
in Anspruch); Scholz 1991, S. 83E, 96, 116, 247 (vergleicht die Erstausführung des Abendmahls für die Augustiner-
kirche mit dem Fragment einer Zweitausführung aus dem Karmeliterkreuzgang, heute in St. Bartholomäus in Nürn-
berg-Wöhrd, und nimmt letztere als Beleg dafür, dass für den Karmeliterzyklus auch ältere Entwürfe herangezogen
wurden); Lee Hendrix, in: Kat. Ausst. Los Angeles/Saint Louis 2000, S. 132L, Nr. 5 (kurze Erwähnung nach
Oettinger/Knappe 1963); Scholz 2002,1, S. 70 (nimmt das Abendmahl von 1504 und die frühen Scheiben des Kar-
meliterzyklus als Beweis für die hohe Anpassungsfähigkeit des verantwortlichen Glasmalers an Baldungs Entwürfe,
von denen in dieser frühen Phase allerdings nur ein einziges Beispiel, der Scheibenriss mit der Predigt des Hl. Vinzenz
Ferrer im Getty Museum, Los Angeles, erhalten geblieben ist); Williamson 2003, S. 149, Nr. 75 (referiert die Her-
kunft aus der Augustinerkirche und die Zuschreibung an die Werkstatt Veit Hirsvogels nach Entwurf Baldungs).
Gegenwärtiger Bestand: Von den im 18. Jahrhundert noch in situ beschriebenen Glasmalereien kann allein die
im Jahr 1504 von Sebald Schreyer gestiftete Einzelscheibe mit der Darstellung des Letzten Abendmahls mit großer
Sicherheit als das jetzt im Victoria & Albert Museum in London befindliche Rechteckfeld identifiziert werden (Fig.
255, Abb. 208).
Geschichte des Baues: Über den Zeitpunkt der Niederlassung der Augustiner-Eremiten in Nürnberg existieren
- wie im Fall der anderen Bettelorden auch - keine verlässlichen Daten. Das in Müllners Chronik und in sämtlichen al-
ten chronikalischen Beschreibungen kolportierte Gründungsjahr 1218 bzw. 1225 geht der päpstlichen Bestätigung des
Ordens 1255/56 durch Alexander IV. zu weit voraus und dürfte sich auf eine missverstandene Überlieferung stützen1.
Sicher ist nur soviel, dass die erste Niederlassung beim Neuen Tor, außerhalb des inneren Mauerrings, bereits vor 1265
niederbrannte2 und die Augustiner ihr Kloster danach mit Erlaubnis des Rats innerhalb der Stadt, in der Schustergasse
nahe dem Weinmarkt, wieder aufbauten. Nach 1275 scheint der Kirchenbau weitgehend vollendet gewesen zu sein,
denn der vierzigtägige Sündenablass, der bis dato für Spenden an den Bau gewährt wurde, ward fortan den fleißigen
1 Müllner Annalen I, 1972, S. 413L Vgl. Theodor Kolde, Zur Ge-
schichte des Nürnberger Augustinerklosters, in: Beiträge zur bayeri-
schen Kirchengeschichte 11, 1905, S. 228-232; Rosenthal-Metzger
1931, S. 5-13.
2 Dies wird durch einen Ablass des vormaligen Regensburger Bischofs
und Kreuzzugspredigers Albertus Magnus von 1265 zum neuen Bau
bestätigt (abgedruckt bei Rosen-thal-Metzger 1931, S. 91L), dem
weitere Indulgenzbriefe der Bischöfe von Salzburg, Eichstätt, Augs-
burg, Regensburg folgten. Die Anerkennung des Neubaus durch den
zuständigen Bischof Bertold von Bamberg erfolgte schließlich 1275.