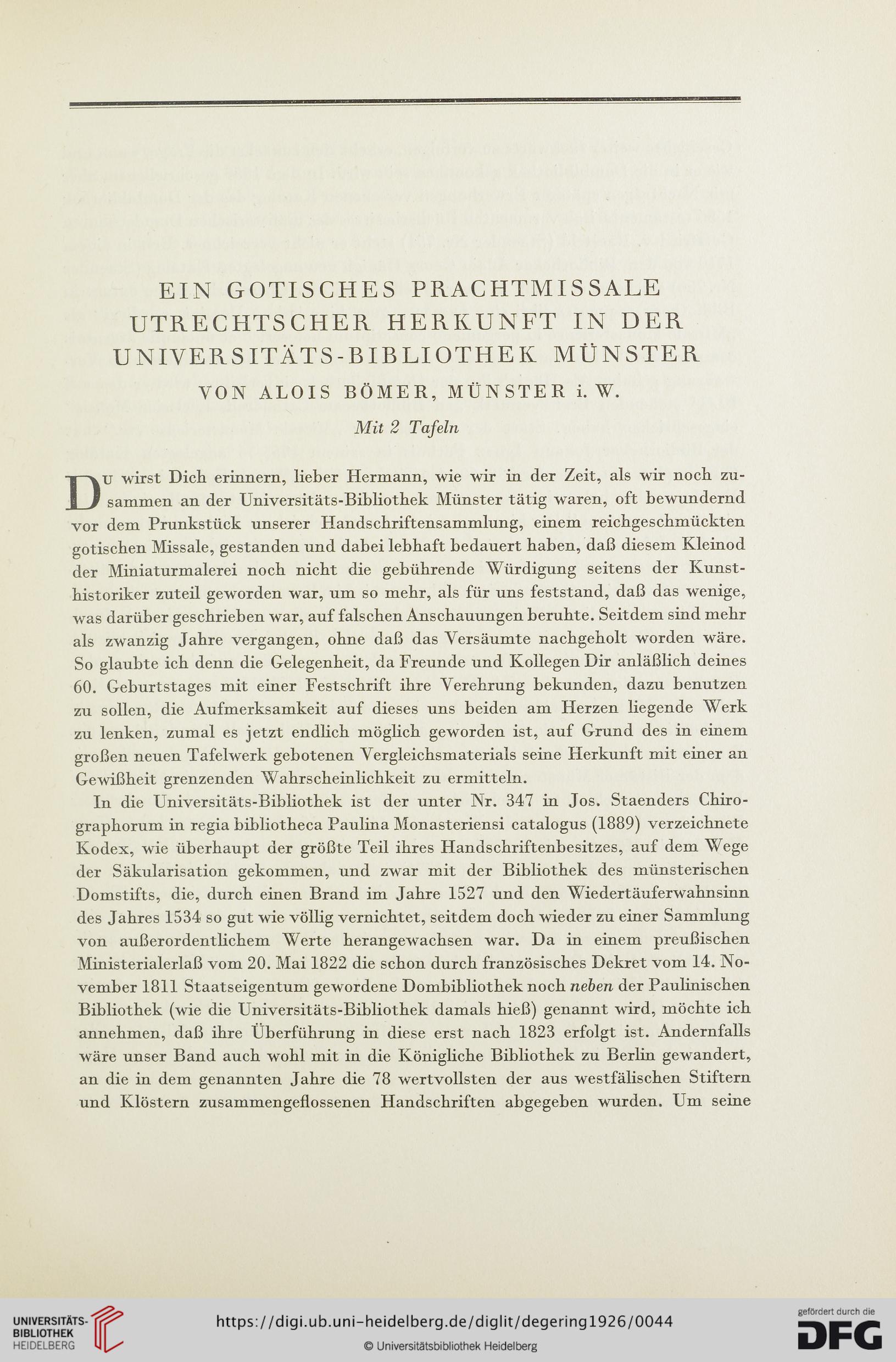EIN GOTISCHES PRAC HTM IS S ALE
UTRECHTSCHER HERKUNFT IN DER
UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK MÜNSTER
VON ALOIS BÖMER, MÜNSTER i. W.
Mit 2 Tafeln
DU wirst Dich erinnern, lieber Hermann, wie wir in der Zeit, als wir noch zu-
sammen an der Universitäts-Bibliothek Münster tätig waren, oft bewundernd
vor dem Prunkstück unserer Handschriftensammlung, einem reichgeschmückten
gotischen Missale, gestanden und dabei lebhaft bedauert haben, daß diesem Kleinod
der Miniaturmalerei noch nicht die gebührende Würdigung seitens der Kunst-
historiker zuteil geworden war, um so mehr, als für uns feststand, daß das wenige,
was darüber geschrieben war, auf falschen Anschauungen beruhte. Seitdem sind mehr
als zwanzig Jahre vergangen, ohne daß das Versäumte nachgeholt worden wäre.
So glaubte ich denn die Gelegenheit, da Freunde und Kollegen Dir anläßlich deines
60. Geburtstages mit einer Festschrift ihre Verehrung bekunden, dazu benutzen
zu sollen, die Aufmerksamkeit auf dieses uns beiden am Herzen liegende Werk
zu lenken, zumal es jetzt endlich möglich geworden ist, auf Grund des in einem
großen neuen Tafelwerk gebotenen Vergleichsmaterials seine Herkunft mit einer an
Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zu ermitteln.
In die Universitäts-Bibliothek ist der unter Nr. 347 in Jos. Staenders Chiro-
graphorum in regia bibliotheca Paulina Monasteriensi catalogus (1889) verzeichnete
Kodex, wie überhaupt der größte Teil ihres Handschriftenbesitzes, auf dem Wege
der Säkularisation gekommen, und zwar mit der Bibliothek des münsterischen
Domstifts, die, durch einen Brand im Jahre 1527 und den Wiedertäuferwahnsinn
des Jahres 1534 so gut wie völlig vernichtet, seitdem doch wieder zu einer Sammlung
von außerordentlichem Werte herangewachsen war. Da in einem preußischen
Ministerialerlaß vom 20. Mai 1822 die schon durch französisches Dekret vom 14. No-
vember 1811 Staatseigentum gewordene Dombibliothek noch neben der Paulinischen
Bibliothek (wie die Universitäts-Bibliothek damals hieß) genannt wird, möchte ich
annehmen, daß ihre Überführung in diese erst nach 1823 erfolgt ist. Andernfalls
wäre unser Band auch wohl mit in die Königliche Bibliothek zu Berlin gewandert,
an die in dem genannten Jahre die 78 wertvollsten der aus westfälischen Stiftern
und Klöstern zusammengeflossenen Handschriften abgegeben wurden. Um seine
UTRECHTSCHER HERKUNFT IN DER
UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK MÜNSTER
VON ALOIS BÖMER, MÜNSTER i. W.
Mit 2 Tafeln
DU wirst Dich erinnern, lieber Hermann, wie wir in der Zeit, als wir noch zu-
sammen an der Universitäts-Bibliothek Münster tätig waren, oft bewundernd
vor dem Prunkstück unserer Handschriftensammlung, einem reichgeschmückten
gotischen Missale, gestanden und dabei lebhaft bedauert haben, daß diesem Kleinod
der Miniaturmalerei noch nicht die gebührende Würdigung seitens der Kunst-
historiker zuteil geworden war, um so mehr, als für uns feststand, daß das wenige,
was darüber geschrieben war, auf falschen Anschauungen beruhte. Seitdem sind mehr
als zwanzig Jahre vergangen, ohne daß das Versäumte nachgeholt worden wäre.
So glaubte ich denn die Gelegenheit, da Freunde und Kollegen Dir anläßlich deines
60. Geburtstages mit einer Festschrift ihre Verehrung bekunden, dazu benutzen
zu sollen, die Aufmerksamkeit auf dieses uns beiden am Herzen liegende Werk
zu lenken, zumal es jetzt endlich möglich geworden ist, auf Grund des in einem
großen neuen Tafelwerk gebotenen Vergleichsmaterials seine Herkunft mit einer an
Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zu ermitteln.
In die Universitäts-Bibliothek ist der unter Nr. 347 in Jos. Staenders Chiro-
graphorum in regia bibliotheca Paulina Monasteriensi catalogus (1889) verzeichnete
Kodex, wie überhaupt der größte Teil ihres Handschriftenbesitzes, auf dem Wege
der Säkularisation gekommen, und zwar mit der Bibliothek des münsterischen
Domstifts, die, durch einen Brand im Jahre 1527 und den Wiedertäuferwahnsinn
des Jahres 1534 so gut wie völlig vernichtet, seitdem doch wieder zu einer Sammlung
von außerordentlichem Werte herangewachsen war. Da in einem preußischen
Ministerialerlaß vom 20. Mai 1822 die schon durch französisches Dekret vom 14. No-
vember 1811 Staatseigentum gewordene Dombibliothek noch neben der Paulinischen
Bibliothek (wie die Universitäts-Bibliothek damals hieß) genannt wird, möchte ich
annehmen, daß ihre Überführung in diese erst nach 1823 erfolgt ist. Andernfalls
wäre unser Band auch wohl mit in die Königliche Bibliothek zu Berlin gewandert,
an die in dem genannten Jahre die 78 wertvollsten der aus westfälischen Stiftern
und Klöstern zusammengeflossenen Handschriften abgegeben wurden. Um seine