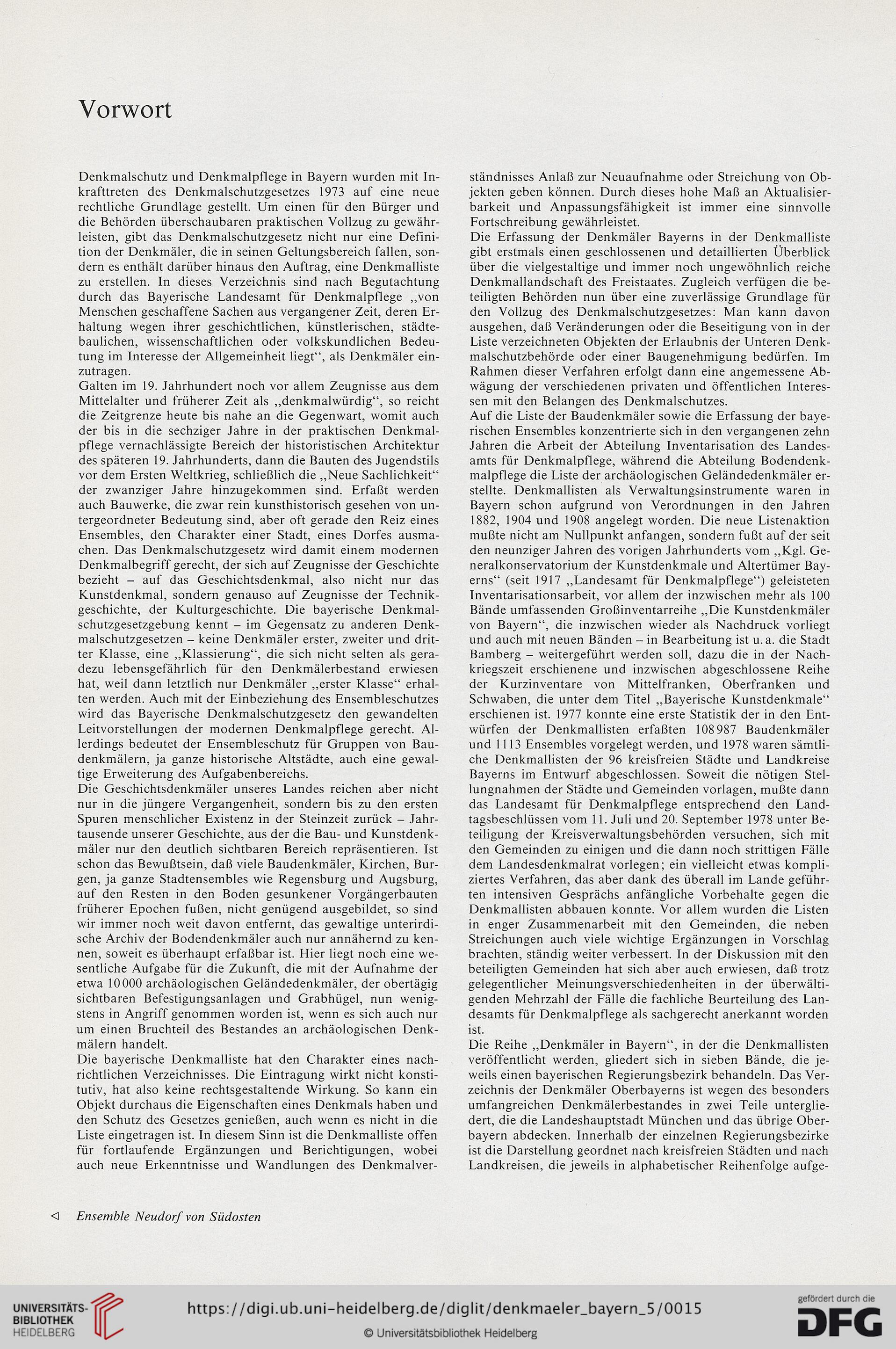Vorwort
Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bayern wurden mit In-
krafttreten des Denkmalschutzgesetzes 1973 auf eine neue
rechtliche Grundlage gestellt. Um einen für den Bürger und
die Behörden überschaubaren praktischen Vollzug zu gewähr-
leisten, gibt das Denkmalschutzgesetz nicht nur eine Defini-
tion der Denkmäler, die in seinen Geltungsbereich fallen, son-
dern es enthält darüber hinaus den Auftrag, eine Denkmalliste
zu erstellen. In dieses Verzeichnis sind nach Begutachtung
durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege „von
Menschen geschaffene Sachen aus vergangener Zeit, deren Er-
haltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städte-
baulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeu-
tung im Interesse der Allgemeinheit liegt“, als Denkmäler ein-
zutragen.
Galten im 19. Jahrhundert noch vor allem Zeugnisse aus dem
Mittelalter und früherer Zeit als „denkmalwürdig“, so reicht
die Zeitgrenze heute bis nahe an die Gegenwart, womit auch
der bis in die sechziger Jahre in der praktischen Denkmal-
pflege vernachlässigte Bereich der historistischen Architektur
des späteren 19. Jahrhunderts, dann die Bauten des Jugendstils
vor dem Ersten Weltkrieg, schließlich die „Neue Sachlichkeit“
der zwanziger Jahre hinzugekommen sind. Erfaßt werden
auch Bauwerke, die zwar rein kunsthistorisch gesehen von un-
tergeordneter Bedeutung sind, aber oft gerade den Reiz eines
Ensembles, den Charakter einer Stadt, eines Dorfes ausma-
chen. Das Denkmalschutzgesetz wird damit einem modernen
Denkmalbegriff gerecht, der sich auf Zeugnisse der Geschichte
bezieht - auf das Geschichtsdenkmal, also nicht nur das
Kunstdenkmal, sondern genauso auf Zeugnisse der Technik-
geschichte, der Kulturgeschichte. Die bayerische Denkmal-
schutzgesetzgebung kennt - im Gegensatz zu anderen Denk-
malschutzgesetzen - keine Denkmäler erster, zweiter und drit-
ter Klasse, eine „Klassierung“, die sich nicht selten als gera-
dezu lebensgefährlich für den Denkmälerbestand erwiesen
hat, weil dann letztlich nur Denkmäler „erster Klasse“ erhal-
ten werden. Auch mit der Einbeziehung des Ensembleschutzes
wird das Bayerische Denkmalschutzgesetz den gewandelten
Leitvorstellungen der modernen Denkmalpflege gerecht. Al-
lerdings bedeutet der Ensembleschutz für Gruppen von Bau-
denkmälern, ja ganze historische Altstädte, auch eine gewal-
tige Erweiterung des Aufgabenbereichs.
Die Geschichtsdenkmäler unseres Landes reichen aber nicht
nur in die jüngere Vergangenheit, sondern bis zu den ersten
Spuren menschlicher Existenz in der Steinzeit zurück - Jahr-
tausende unserer Geschichte, aus der die Bau- und Kunstdenk-
mäler nur den deutlich sichtbaren Bereich repräsentieren. Ist
schon das Bewußtsein, daß viele Baudenkmäler, Kirchen, Bur-
gen, ja ganze Stadtensembles wie Regensburg und Augsburg,
auf den Resten in den Boden gesunkener Vorgängerbauten
früherer Epochen fußen, nicht genügend ausgebildet, so sind
wir immer noch weit davon entfernt, das gewaltige unterirdi-
sche Archiv der Bodendenkmäler auch nur annähernd zu ken-
nen, soweit es überhaupt erfaßbar ist. Hier liegt noch eine we-
sentliche Aufgabe für die Zukunft, die mit der Aufnahme der
etwa 10000 archäologischen Geländedenkmäler, der obertägig
sichtbaren Befestigungsanlagen und Grabhügel, nun wenig-
stens in Angriff genommen worden ist, wenn es sich auch nur
um einen Bruchteil des Bestandes an archäologischen Denk-
mälern handelt.
Die bayerische Denkmalliste hat den Charakter eines nach-
richtlichen Verzeichnisses. Die Eintragung wirkt nicht konsti-
tutiv, hat also keine rechtsgestaltende Wirkung. So kann ein
Objekt durchaus die Eigenschaften eines Denkmals haben und
den Schutz des Gesetzes genießen, auch wenn es nicht in die
Liste eingetragen ist. In diesem Sinn ist die Denkmalliste offen
für fortlaufende Ergänzungen und Berichtigungen, wobei
auch neue Erkenntnisse und Wandlungen des Denkmalver-
ständnisses Anlaß zur Neuaufnahme oder Streichung von Ob-
jekten geben können. Durch dieses hohe Maß an Aktualisier-
barkeit und Anpassungsfähigkeit ist immer eine sinnvolle
Fortschreibung gewährleistet.
Die Erfassung der Denkmäler Bayerns in der Denkmalliste
gibt erstmals einen geschlossenen und detaillierten Überblick
über die vielgestaltige und immer noch ungewöhnlich reiche
Denkmallandschaft des Freistaates. Zugleich verfügen die be-
teiligten Behörden nun über eine zuverlässige Grundlage für
den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes: Man kann davon
ausgehen, daß Veränderungen oder die Beseitigung von in der
Liste verzeichneten Objekten der Erlaubnis der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder einer Baugenehmigung bedürfen. Im
Rahmen dieser Verfahren erfolgt dann eine angemessene Ab-
wägung der verschiedenen privaten und öffentlichen Interes-
sen mit den Belangen des Denkmalschutzes.
Auf die Liste der Baudenkmäler sowie die Erfassung der baye-
rischen Ensembles konzentrierte sich in den vergangenen zehn
Jahren die Arbeit der Abteilung Inventarisation des Landes-
amts für Denkmalpflege, während die Abteilung Bodendenk-
malpflege die Liste der archäologischen Geländedenkmäler er-
stellte. Denkmallisten als Verwaltungsinstrumente waren in
Bayern schon aufgrund von Verordnungen in den Jahren
1882, 1904 und 1908 angelegt worden. Die neue Listenaktion
mußte nicht am Nullpunkt anfangen, sondern fußt auf der seit
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vom „Kgl. Ge-
neralkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bay-
erns“ (seit 1917 „Landesamt für Denkmalpflege“) geleisteten
Inventarisationsarbeit, vor allem der inzwischen mehr als 100
Bände umfassenden Großinventarreihe „Die Kunstdenkmäler
von Bayern“, die inzwischen wieder als Nachdruck vorliegt
und auch mit neuen Bänden - in Bearbeitung ist u.a. die Stadt
Bamberg - weitergeführt werden soll, dazu die in der Nach-
kriegszeit erschienene und inzwischen abgeschlossene Reihe
der Kurzinventare von Mittelfranken, Oberfranken und
Schwaben, die unter dem Titel „Bayerische Kunstdenkmale“
erschienen ist. 1977 konnte eine erste Statistik der in den Ent-
würfen der Denkmallisten erfaßten 108987 Baudenkmäler
und 1113 Ensembles vorgelegt werden, und 1978 waren sämtli-
che Denkmallisten der 96 kreisfreien Städte und Landkreise
Bayerns im Entwurf abgeschlossen. Soweit die nötigen Stel-
lungnahmen der Städte und Gemeinden vorlagen, mußte dann
das Landesamt für Denkmalpflege entsprechend den Land-
tagsbeschlüssen vom 11. Juli und 20. September 1978 unter Be-
teiligung der Kreisverwaltungsbehörden versuchen, sich mit
den Gemeinden zu einigen und die dann noch strittigen Fälle
dem Landesdenkmalrat vorlegen; ein vielleicht etwas kompli-
ziertes Verfahren, das aber dank des überall im Lande geführ-
ten intensiven Gesprächs anfängliche Vorbehalte gegen die
Denkmallisten abbauen konnte. Vor allem wurden die Listen
in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die neben
Streichungen auch viele wichtige Ergänzungen in Vorschlag
brachten, ständig weiter verbessert. In der Diskussion mit den
beteiligten Gemeinden hat sich aber auch erwiesen, daß trotz
gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten in der überwälti-
genden Mehrzahl der Fälle die fachliche Beurteilung des Lan-
desamts für Denkmalpflege als sachgerecht anerkannt worden
ist.
Die Reihe „Denkmäler in Bayern“, in der die Denkmallisten
veröffentlicht werden, gliedert sich in sieben Bände, die je-
weils einen bayerischen Regierungsbezirk behandeln. Das Ver-
zeichnis der Denkmäler Oberbayerns ist wegen des besonders
umfangreichen Denkmälerbestandes in zwei Teile unterglie-
dert, die die Landeshauptstadt München und das übrige Ober-
bayern abdecken. Innerhalb der einzelnen Regierungsbezirke
ist die Darstellung geordnet nach kreisfreien Städten und nach
Landkreisen, die jeweils in alphabetischer Reihenfolge aufge-
Ensemble Neudorf von Südosten
Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bayern wurden mit In-
krafttreten des Denkmalschutzgesetzes 1973 auf eine neue
rechtliche Grundlage gestellt. Um einen für den Bürger und
die Behörden überschaubaren praktischen Vollzug zu gewähr-
leisten, gibt das Denkmalschutzgesetz nicht nur eine Defini-
tion der Denkmäler, die in seinen Geltungsbereich fallen, son-
dern es enthält darüber hinaus den Auftrag, eine Denkmalliste
zu erstellen. In dieses Verzeichnis sind nach Begutachtung
durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege „von
Menschen geschaffene Sachen aus vergangener Zeit, deren Er-
haltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städte-
baulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeu-
tung im Interesse der Allgemeinheit liegt“, als Denkmäler ein-
zutragen.
Galten im 19. Jahrhundert noch vor allem Zeugnisse aus dem
Mittelalter und früherer Zeit als „denkmalwürdig“, so reicht
die Zeitgrenze heute bis nahe an die Gegenwart, womit auch
der bis in die sechziger Jahre in der praktischen Denkmal-
pflege vernachlässigte Bereich der historistischen Architektur
des späteren 19. Jahrhunderts, dann die Bauten des Jugendstils
vor dem Ersten Weltkrieg, schließlich die „Neue Sachlichkeit“
der zwanziger Jahre hinzugekommen sind. Erfaßt werden
auch Bauwerke, die zwar rein kunsthistorisch gesehen von un-
tergeordneter Bedeutung sind, aber oft gerade den Reiz eines
Ensembles, den Charakter einer Stadt, eines Dorfes ausma-
chen. Das Denkmalschutzgesetz wird damit einem modernen
Denkmalbegriff gerecht, der sich auf Zeugnisse der Geschichte
bezieht - auf das Geschichtsdenkmal, also nicht nur das
Kunstdenkmal, sondern genauso auf Zeugnisse der Technik-
geschichte, der Kulturgeschichte. Die bayerische Denkmal-
schutzgesetzgebung kennt - im Gegensatz zu anderen Denk-
malschutzgesetzen - keine Denkmäler erster, zweiter und drit-
ter Klasse, eine „Klassierung“, die sich nicht selten als gera-
dezu lebensgefährlich für den Denkmälerbestand erwiesen
hat, weil dann letztlich nur Denkmäler „erster Klasse“ erhal-
ten werden. Auch mit der Einbeziehung des Ensembleschutzes
wird das Bayerische Denkmalschutzgesetz den gewandelten
Leitvorstellungen der modernen Denkmalpflege gerecht. Al-
lerdings bedeutet der Ensembleschutz für Gruppen von Bau-
denkmälern, ja ganze historische Altstädte, auch eine gewal-
tige Erweiterung des Aufgabenbereichs.
Die Geschichtsdenkmäler unseres Landes reichen aber nicht
nur in die jüngere Vergangenheit, sondern bis zu den ersten
Spuren menschlicher Existenz in der Steinzeit zurück - Jahr-
tausende unserer Geschichte, aus der die Bau- und Kunstdenk-
mäler nur den deutlich sichtbaren Bereich repräsentieren. Ist
schon das Bewußtsein, daß viele Baudenkmäler, Kirchen, Bur-
gen, ja ganze Stadtensembles wie Regensburg und Augsburg,
auf den Resten in den Boden gesunkener Vorgängerbauten
früherer Epochen fußen, nicht genügend ausgebildet, so sind
wir immer noch weit davon entfernt, das gewaltige unterirdi-
sche Archiv der Bodendenkmäler auch nur annähernd zu ken-
nen, soweit es überhaupt erfaßbar ist. Hier liegt noch eine we-
sentliche Aufgabe für die Zukunft, die mit der Aufnahme der
etwa 10000 archäologischen Geländedenkmäler, der obertägig
sichtbaren Befestigungsanlagen und Grabhügel, nun wenig-
stens in Angriff genommen worden ist, wenn es sich auch nur
um einen Bruchteil des Bestandes an archäologischen Denk-
mälern handelt.
Die bayerische Denkmalliste hat den Charakter eines nach-
richtlichen Verzeichnisses. Die Eintragung wirkt nicht konsti-
tutiv, hat also keine rechtsgestaltende Wirkung. So kann ein
Objekt durchaus die Eigenschaften eines Denkmals haben und
den Schutz des Gesetzes genießen, auch wenn es nicht in die
Liste eingetragen ist. In diesem Sinn ist die Denkmalliste offen
für fortlaufende Ergänzungen und Berichtigungen, wobei
auch neue Erkenntnisse und Wandlungen des Denkmalver-
ständnisses Anlaß zur Neuaufnahme oder Streichung von Ob-
jekten geben können. Durch dieses hohe Maß an Aktualisier-
barkeit und Anpassungsfähigkeit ist immer eine sinnvolle
Fortschreibung gewährleistet.
Die Erfassung der Denkmäler Bayerns in der Denkmalliste
gibt erstmals einen geschlossenen und detaillierten Überblick
über die vielgestaltige und immer noch ungewöhnlich reiche
Denkmallandschaft des Freistaates. Zugleich verfügen die be-
teiligten Behörden nun über eine zuverlässige Grundlage für
den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes: Man kann davon
ausgehen, daß Veränderungen oder die Beseitigung von in der
Liste verzeichneten Objekten der Erlaubnis der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder einer Baugenehmigung bedürfen. Im
Rahmen dieser Verfahren erfolgt dann eine angemessene Ab-
wägung der verschiedenen privaten und öffentlichen Interes-
sen mit den Belangen des Denkmalschutzes.
Auf die Liste der Baudenkmäler sowie die Erfassung der baye-
rischen Ensembles konzentrierte sich in den vergangenen zehn
Jahren die Arbeit der Abteilung Inventarisation des Landes-
amts für Denkmalpflege, während die Abteilung Bodendenk-
malpflege die Liste der archäologischen Geländedenkmäler er-
stellte. Denkmallisten als Verwaltungsinstrumente waren in
Bayern schon aufgrund von Verordnungen in den Jahren
1882, 1904 und 1908 angelegt worden. Die neue Listenaktion
mußte nicht am Nullpunkt anfangen, sondern fußt auf der seit
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vom „Kgl. Ge-
neralkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bay-
erns“ (seit 1917 „Landesamt für Denkmalpflege“) geleisteten
Inventarisationsarbeit, vor allem der inzwischen mehr als 100
Bände umfassenden Großinventarreihe „Die Kunstdenkmäler
von Bayern“, die inzwischen wieder als Nachdruck vorliegt
und auch mit neuen Bänden - in Bearbeitung ist u.a. die Stadt
Bamberg - weitergeführt werden soll, dazu die in der Nach-
kriegszeit erschienene und inzwischen abgeschlossene Reihe
der Kurzinventare von Mittelfranken, Oberfranken und
Schwaben, die unter dem Titel „Bayerische Kunstdenkmale“
erschienen ist. 1977 konnte eine erste Statistik der in den Ent-
würfen der Denkmallisten erfaßten 108987 Baudenkmäler
und 1113 Ensembles vorgelegt werden, und 1978 waren sämtli-
che Denkmallisten der 96 kreisfreien Städte und Landkreise
Bayerns im Entwurf abgeschlossen. Soweit die nötigen Stel-
lungnahmen der Städte und Gemeinden vorlagen, mußte dann
das Landesamt für Denkmalpflege entsprechend den Land-
tagsbeschlüssen vom 11. Juli und 20. September 1978 unter Be-
teiligung der Kreisverwaltungsbehörden versuchen, sich mit
den Gemeinden zu einigen und die dann noch strittigen Fälle
dem Landesdenkmalrat vorlegen; ein vielleicht etwas kompli-
ziertes Verfahren, das aber dank des überall im Lande geführ-
ten intensiven Gesprächs anfängliche Vorbehalte gegen die
Denkmallisten abbauen konnte. Vor allem wurden die Listen
in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die neben
Streichungen auch viele wichtige Ergänzungen in Vorschlag
brachten, ständig weiter verbessert. In der Diskussion mit den
beteiligten Gemeinden hat sich aber auch erwiesen, daß trotz
gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten in der überwälti-
genden Mehrzahl der Fälle die fachliche Beurteilung des Lan-
desamts für Denkmalpflege als sachgerecht anerkannt worden
ist.
Die Reihe „Denkmäler in Bayern“, in der die Denkmallisten
veröffentlicht werden, gliedert sich in sieben Bände, die je-
weils einen bayerischen Regierungsbezirk behandeln. Das Ver-
zeichnis der Denkmäler Oberbayerns ist wegen des besonders
umfangreichen Denkmälerbestandes in zwei Teile unterglie-
dert, die die Landeshauptstadt München und das übrige Ober-
bayern abdecken. Innerhalb der einzelnen Regierungsbezirke
ist die Darstellung geordnet nach kreisfreien Städten und nach
Landkreisen, die jeweils in alphabetischer Reihenfolge aufge-
Ensemble Neudorf von Südosten