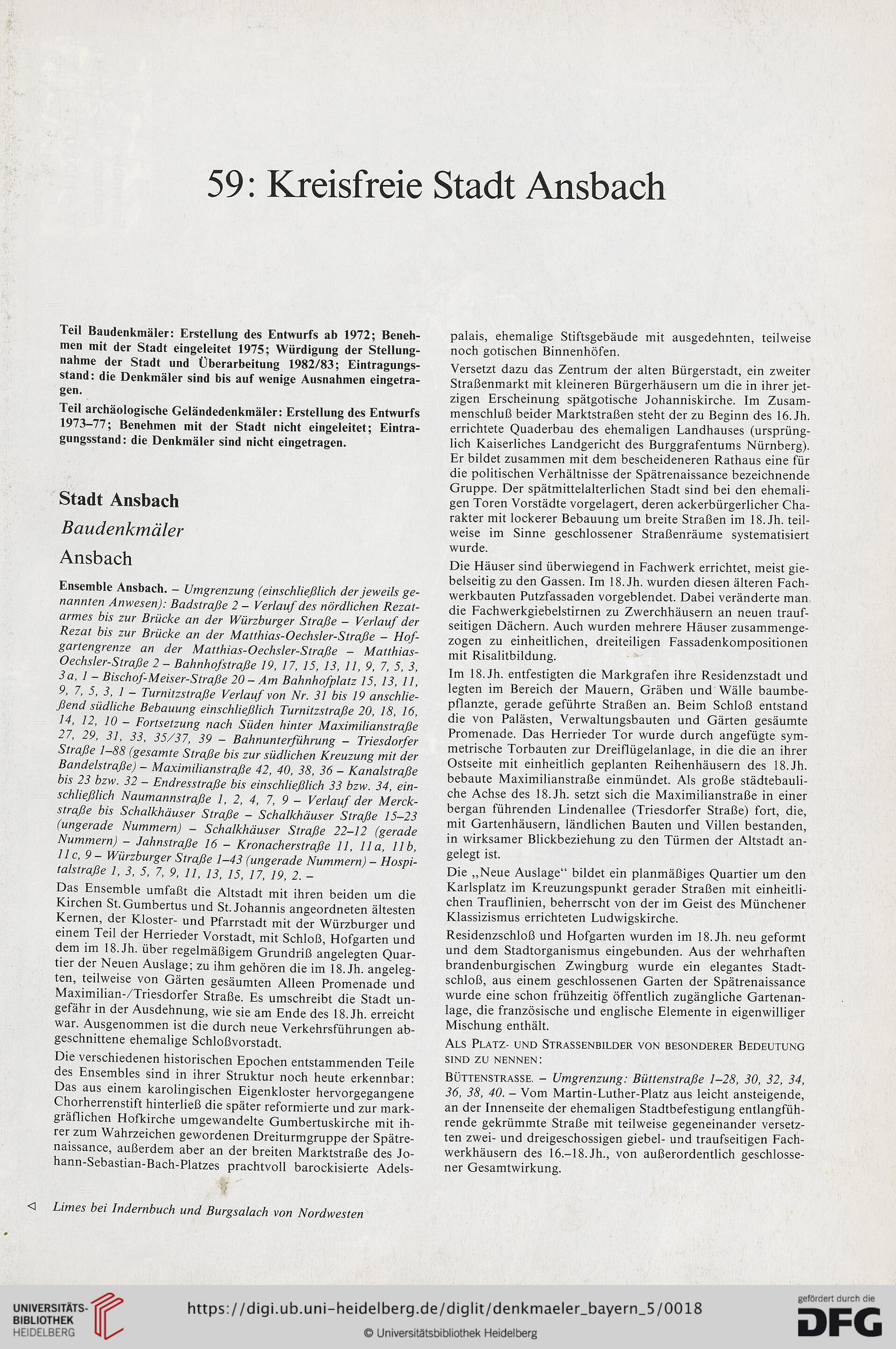59: Kreisfreie Stadt Ansbach
Teil Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs ab 1972; Beneh-
men mit der Stadt eingeleitet 1975; Würdigung der Stellung-
nahme der Stadt und Überarbeitung 1982/83; Eintragungs-
stand: die Denkmäler sind bis auf wenige Ausnahmen eingetra-
gen.
Teil archäologische Geländedenkmäler: Erstellung des Entwurfs
1973-77; Benehmen mit der Stadt nicht eingeleitet; Eintra-
gungsstand: die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Stadt Ansbach
Baudenkmäler
Ansbach
Ensemble Ansbach. — Umgrenzung (einschließlich der jeweils ge-
nannten Anwesen): Badstraße 2 - Verlauf des nördlichen Rezat-
armes bis zur Brücke an der Würzburger Straße — Verlauf der
Rezat bis zur Brücke an der Matthias-Oechsler-Straße - Hof-
gartengrenze an der Matthias-Oechsler-Straße - Matthias-
Oechsler-Straße 2 - Bahnhofstraße 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3,
3a, 1 - Bischof-Meiser-Straße 20 - Am Bahnhofplatz 15, 13, 11,
9, 7, 5,3,1- Turnitzstraße Verlauf von Nr. 31 bis 19 anschlie-
ßend südliche Bebauung einschließlich Turnitzstraße 20, 18, 16,
14, 12, 10 - Fortsetzung nach Süden hinter Maximilianstraße
27, 29, 31, 33, 35/37, 39 - Bahnunterführung - Triesdorfer
Straße 1-88 (gesamte Straße bis zur südlichen Kreuzung mit der
Bandelstraße) - Maximilianstraße 42, 40, 38, 36 - Kanalstraße
bis 23 bzw. 32 - Endresstraße bis einschließlich 33 bzw. 34, ein-
schließlich Naumannstraße 1, 2, 4, 7,9- Verlauf der Merck-
straße bis Schalkhäuser Straße - Schalkhäuser Straße 15-23
(ungerade Nummern) - Schalkhäuser Straße 22-12 (gerade
Nummern) - Jahnstraße 16 - Kronacherstraße 11, 11a, 11b,
11 c, 9- Würzburger Straße 1-43 (ungerade Nummern) - Hospi-
talstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2. -
Das Ensemble umfaßt die Altstadt mit ihren beiden um die
Kirchen St.Gumbertus und St. Johannis angeordneten ältesten
Kernen, der Kloster- und Pfarrstadt mit der Würzburger und
einem Teil der Herrieder Vorstadt, mit Schloß, Hofgarten und
dem im 18. Jh. über regelmäßigem Grundriß angelegten Quar-
tier der Neuen Auslage; zu ihm gehören die im 18.Jh. angeleg-
ten, teilweise von Gärten gesäumten Alleen Promenade und
Maximilian-/Triesdorfer Straße. Es umschreibt die Stadt un-
gefähr in der Ausdehnung, wie sie am Ende des 18. Jh. erreicht
war. Ausgenommen ist die durch neue Verkehrsführungen ab-
geschnittene ehemalige Schloßvorstadt.
Die verschiedenen historischen Epochen entstammenden Teile
des Ensembles sind in ihrer Struktur noch heute erkennbar:
Das aus einem karolingischen Eigenkloster hervorgegangene
Chorherrenstift hinterließ die später reformierte und zur mark-
gräflichen Hofkirche umgewandelte Gumbertuskirche mit ih-
rer zum Wahrzeichen gewordenen Dreiturmgruppe der Spätre-
naissance, außerdem aber an der breiten Marktstraße des Jo-
hann-Sebastian-Bach-Platzes prachtvoll barockisierte Adels-
palais, ehemalige Stiftsgebäude mit ausgedehnten, teilweise
noch gotischen Binnenhöfen.
Versetzt dazu das Zentrum der alten Bürgerstadt, ein zweiter
Straßenmarkt mit kleineren Bürgerhäusern um die in ihrer jet-
zigen Erscheinung spätgotische Johanniskirche. Im Zusam-
menschluß beider Marktstraßen steht der zu Beginn des 16. Jh.
errichtete Quaderbau des ehemaligen Landhauses (ursprüng-
lich Kaiserliches Landgericht des Burggrafentums Nürnberg).
Er bildet zusammen mit dem bescheideneren Rathaus eine für
die politischen Verhältnisse der Spätrenaissance bezeichnende
Gruppe. Der spätmittelalterlichen Stadt sind bei den ehemali-
gen Toren Vorstädte vorgelagert, deren ackerbürgerlicher Cha-
rakter mit lockerer Bebauung um breite Straßen im 18. Jh. teil-
weise im Sinne geschlossener Straßenräume systematisiert
wurde.
Die Häuser sind überwiegend in Fachwerk errichtet, meist gie-
belseitig zu den Gassen. Im 18. Jh. wurden diesen älteren Fach-
werkbauten Putzfassaden vorgeblendet. Dabei veränderte man
die Fachwerkgiebelstirnen zu Zwerchhäusern an neuen trauf-
seitigen Dächern. Auch wurden mehrere Häuser zusammenge-
zogen zu einheitlichen, dreiteiligen Fassadenkompositionen
mit Risalitbildung.
Im 18. Jh. entfestigten die Markgrafen ihre Residenzstadt und
legten im Bereich der Mauern, Gräben und Wälle baumbe-
pflanzte, gerade geführte Straßen an. Beim Schloß entstand
die von Palästen, Verwaltungsbauten und Gärten gesäumte
Promenade. Das Herrieder Tor wurde durch angefügte sym-
metrische Torbauten zur Dreiflügelanlage, in die die an ihrer
Ostseite mit einheitlich geplanten Reihenhäusern des 18. Jh.
bebaute Maximilianstraße einmündet. Als große städtebauli-
che Achse des 18. Jh. setzt sich die Maximilianstraße in einer
bergan führenden Lindenallee (Triesdorfer Straße) fort, die,
mit Gartenhäusern, ländlichen Bauten und Villen bestanden,
in wirksamer Blickbeziehung zu den Türmen der Altstadt an-
gelegt ist.
Die „Neue Auslage“ bildet ein planmäßiges Quartier um den
Karlsplatz im Kreuzungspunkt gerader Straßen mit einheitli-
chen Trauflinien, beherrscht von der im Geist des Münchener
Klassizismus errichteten Ludwigskirche.
Residenzschloß und Hofgarten wurden im 18. Jh. neu geformt
und dem Stadtorganismus eingebunden. Aus der wehrhaften
brandenburgischen Zwingburg wurde ein elegantes Stadt-
schloß, aus einem geschlossenen Garten der Spätrenaissance
wurde eine schon frühzeitig öffentlich zugängliche Gartenan-
lage, die französische und englische Elemente in eigenwilliger
Mischung enthält.
Als Platz- und Strassenbilder von besonderer Bedeutung
sind zu nennen:
Büttenstrasse. - Umgrenzung: Büttenstraße 1-28, 30, 32, 34,
36, 38, 40. - Vom Martin-Luther-Platz aus leicht ansteigende,
an der Innenseite der ehemaligen Stadtbefestigung entlangfüh-
rende gekrümmte Straße mit teilweise gegeneinander versetz-
ten zwei- und dreigeschossigen giebel- und traufseitigen Fach-
werkhäusern des 16.-18. Jh., von außerordentlich geschlosse-
ner Gesamtwirkung.
< Limes bei Indernbuch und Burgsalach von Nordwesten
Teil Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs ab 1972; Beneh-
men mit der Stadt eingeleitet 1975; Würdigung der Stellung-
nahme der Stadt und Überarbeitung 1982/83; Eintragungs-
stand: die Denkmäler sind bis auf wenige Ausnahmen eingetra-
gen.
Teil archäologische Geländedenkmäler: Erstellung des Entwurfs
1973-77; Benehmen mit der Stadt nicht eingeleitet; Eintra-
gungsstand: die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Stadt Ansbach
Baudenkmäler
Ansbach
Ensemble Ansbach. — Umgrenzung (einschließlich der jeweils ge-
nannten Anwesen): Badstraße 2 - Verlauf des nördlichen Rezat-
armes bis zur Brücke an der Würzburger Straße — Verlauf der
Rezat bis zur Brücke an der Matthias-Oechsler-Straße - Hof-
gartengrenze an der Matthias-Oechsler-Straße - Matthias-
Oechsler-Straße 2 - Bahnhofstraße 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3,
3a, 1 - Bischof-Meiser-Straße 20 - Am Bahnhofplatz 15, 13, 11,
9, 7, 5,3,1- Turnitzstraße Verlauf von Nr. 31 bis 19 anschlie-
ßend südliche Bebauung einschließlich Turnitzstraße 20, 18, 16,
14, 12, 10 - Fortsetzung nach Süden hinter Maximilianstraße
27, 29, 31, 33, 35/37, 39 - Bahnunterführung - Triesdorfer
Straße 1-88 (gesamte Straße bis zur südlichen Kreuzung mit der
Bandelstraße) - Maximilianstraße 42, 40, 38, 36 - Kanalstraße
bis 23 bzw. 32 - Endresstraße bis einschließlich 33 bzw. 34, ein-
schließlich Naumannstraße 1, 2, 4, 7,9- Verlauf der Merck-
straße bis Schalkhäuser Straße - Schalkhäuser Straße 15-23
(ungerade Nummern) - Schalkhäuser Straße 22-12 (gerade
Nummern) - Jahnstraße 16 - Kronacherstraße 11, 11a, 11b,
11 c, 9- Würzburger Straße 1-43 (ungerade Nummern) - Hospi-
talstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2. -
Das Ensemble umfaßt die Altstadt mit ihren beiden um die
Kirchen St.Gumbertus und St. Johannis angeordneten ältesten
Kernen, der Kloster- und Pfarrstadt mit der Würzburger und
einem Teil der Herrieder Vorstadt, mit Schloß, Hofgarten und
dem im 18. Jh. über regelmäßigem Grundriß angelegten Quar-
tier der Neuen Auslage; zu ihm gehören die im 18.Jh. angeleg-
ten, teilweise von Gärten gesäumten Alleen Promenade und
Maximilian-/Triesdorfer Straße. Es umschreibt die Stadt un-
gefähr in der Ausdehnung, wie sie am Ende des 18. Jh. erreicht
war. Ausgenommen ist die durch neue Verkehrsführungen ab-
geschnittene ehemalige Schloßvorstadt.
Die verschiedenen historischen Epochen entstammenden Teile
des Ensembles sind in ihrer Struktur noch heute erkennbar:
Das aus einem karolingischen Eigenkloster hervorgegangene
Chorherrenstift hinterließ die später reformierte und zur mark-
gräflichen Hofkirche umgewandelte Gumbertuskirche mit ih-
rer zum Wahrzeichen gewordenen Dreiturmgruppe der Spätre-
naissance, außerdem aber an der breiten Marktstraße des Jo-
hann-Sebastian-Bach-Platzes prachtvoll barockisierte Adels-
palais, ehemalige Stiftsgebäude mit ausgedehnten, teilweise
noch gotischen Binnenhöfen.
Versetzt dazu das Zentrum der alten Bürgerstadt, ein zweiter
Straßenmarkt mit kleineren Bürgerhäusern um die in ihrer jet-
zigen Erscheinung spätgotische Johanniskirche. Im Zusam-
menschluß beider Marktstraßen steht der zu Beginn des 16. Jh.
errichtete Quaderbau des ehemaligen Landhauses (ursprüng-
lich Kaiserliches Landgericht des Burggrafentums Nürnberg).
Er bildet zusammen mit dem bescheideneren Rathaus eine für
die politischen Verhältnisse der Spätrenaissance bezeichnende
Gruppe. Der spätmittelalterlichen Stadt sind bei den ehemali-
gen Toren Vorstädte vorgelagert, deren ackerbürgerlicher Cha-
rakter mit lockerer Bebauung um breite Straßen im 18. Jh. teil-
weise im Sinne geschlossener Straßenräume systematisiert
wurde.
Die Häuser sind überwiegend in Fachwerk errichtet, meist gie-
belseitig zu den Gassen. Im 18. Jh. wurden diesen älteren Fach-
werkbauten Putzfassaden vorgeblendet. Dabei veränderte man
die Fachwerkgiebelstirnen zu Zwerchhäusern an neuen trauf-
seitigen Dächern. Auch wurden mehrere Häuser zusammenge-
zogen zu einheitlichen, dreiteiligen Fassadenkompositionen
mit Risalitbildung.
Im 18. Jh. entfestigten die Markgrafen ihre Residenzstadt und
legten im Bereich der Mauern, Gräben und Wälle baumbe-
pflanzte, gerade geführte Straßen an. Beim Schloß entstand
die von Palästen, Verwaltungsbauten und Gärten gesäumte
Promenade. Das Herrieder Tor wurde durch angefügte sym-
metrische Torbauten zur Dreiflügelanlage, in die die an ihrer
Ostseite mit einheitlich geplanten Reihenhäusern des 18. Jh.
bebaute Maximilianstraße einmündet. Als große städtebauli-
che Achse des 18. Jh. setzt sich die Maximilianstraße in einer
bergan führenden Lindenallee (Triesdorfer Straße) fort, die,
mit Gartenhäusern, ländlichen Bauten und Villen bestanden,
in wirksamer Blickbeziehung zu den Türmen der Altstadt an-
gelegt ist.
Die „Neue Auslage“ bildet ein planmäßiges Quartier um den
Karlsplatz im Kreuzungspunkt gerader Straßen mit einheitli-
chen Trauflinien, beherrscht von der im Geist des Münchener
Klassizismus errichteten Ludwigskirche.
Residenzschloß und Hofgarten wurden im 18. Jh. neu geformt
und dem Stadtorganismus eingebunden. Aus der wehrhaften
brandenburgischen Zwingburg wurde ein elegantes Stadt-
schloß, aus einem geschlossenen Garten der Spätrenaissance
wurde eine schon frühzeitig öffentlich zugängliche Gartenan-
lage, die französische und englische Elemente in eigenwilliger
Mischung enthält.
Als Platz- und Strassenbilder von besonderer Bedeutung
sind zu nennen:
Büttenstrasse. - Umgrenzung: Büttenstraße 1-28, 30, 32, 34,
36, 38, 40. - Vom Martin-Luther-Platz aus leicht ansteigende,
an der Innenseite der ehemaligen Stadtbefestigung entlangfüh-
rende gekrümmte Straße mit teilweise gegeneinander versetz-
ten zwei- und dreigeschossigen giebel- und traufseitigen Fach-
werkhäusern des 16.-18. Jh., von außerordentlich geschlosse-
ner Gesamtwirkung.
< Limes bei Indernbuch und Burgsalach von Nordwesten