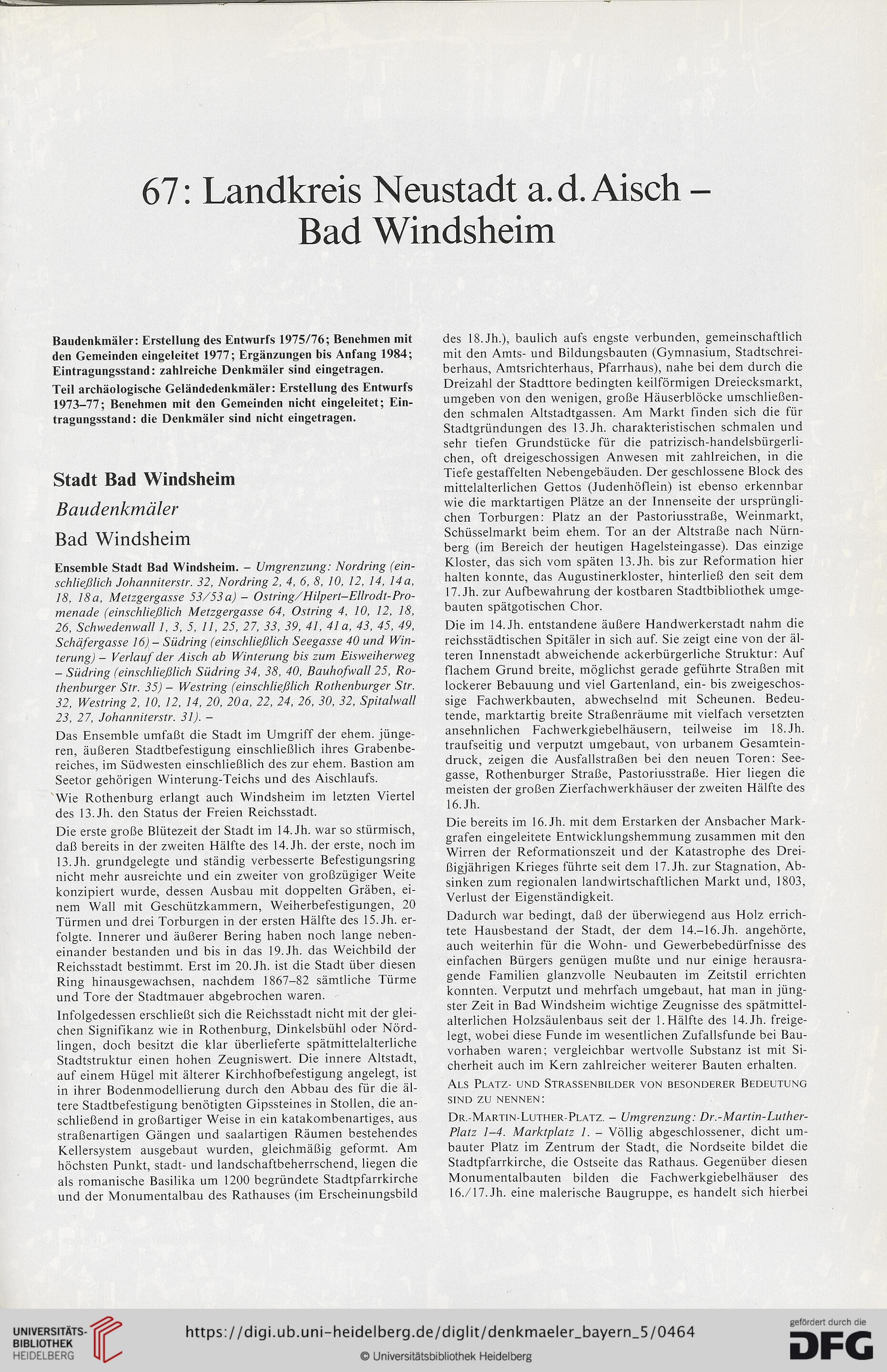67: Landkreis Neustadt a.d. Aisch -
Bad Windsheim
Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs 1975/76; Benehmen mit
den Gemeinden eingeleitet 1977; Ergänzungen bis Anfang 1984;
Eintragungsstand: zahlreiche Denkmäler sind eingetragen.
Teil archäologische Geländedenkmäler: Erstellung des Entwurfs
1973-77; Benehmen mit den Gemeinden nicht eingeleitet; Ein-
tragungsstand: die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Stadt Bad Windsheim
Baudenkmäler
Bad Windsheim
Ensemble Stadt Bad Windsheim. - Umgrenzung: Nordring (ein-
schließlich Johanniterstr. 32, Nordring 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 a,
18, 18a, Metzgergasse 53/53a) - Ostring/Hilpert-Ellrodt-Pro-
menade (einschließlich Metzgergasse 64. Ostring 4, 10, 12, 18,
26, Schwedenwall 1, 3, 5, 11, 25, 27, 33, 39, 41. 41a, 43, 45, 49,
Schäfergasse 16) - Südring (einschließlich Seegasse 40 und Win-
terung) - Verlauf der Aisch ab Winterung bis zum Eisweiherweg
- Südring (einschließlich Südring 34, 38, 40, Bauhofwall 25, Ro-
thenburger Str. 35) - Westring (einschließlich Rothenburger Str.
32. Westring 2. 10, 12, 14, 20, 20a, 22, 24, 26, 30, 32, Spitalwall
23, 27, Johanniterstr. 31). -
Das Ensemble umfaßt die Stadt im Umgriff der ehern, jünge-
ren, äußeren Stadtbefestigung einschließlich ihres Grabenbe-
reiches, im Südwesten einschließlich des zur ehern. Bastion am
Seetor gehörigen Winterung-Teichs und des Aischlaufs.
Wie Rothenburg erlangt auch Windsheim im letzten Viertel
des 13. Jh. den Status der Freien Reichsstadt.
Die erste große Blütezeit der Stadt im 14. Jh. war so stürmisch,
daß bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jh. der erste, noch im
13.Jh. grundgelegte und ständig verbesserte Befestigungsring
nicht mehr ausreichte und ein zweiter von großzügiger Weite
konzipiert wurde, dessen Ausbau mit doppelten Gräben, ei-
nem Wall mit Geschützkammern, Weiherbefestigungen, 20
Türmen und drei Torburgen in der ersten Hälfte des 15. Jh. er-
folgte. Innerer und äußerer Bering haben noch lange neben-
einander bestanden und bis in das 19.Jh. das Weichbild der
Reichsstadt bestimmt. Erst im 20. Jh. ist die Stadt über diesen
Ring hinausgewachsen, nachdem 1867-82 sämtliche Türme
und Tore der Stadtmauer abgebrochen waren.
Infolgedessen erschließt sich die Reichsstadt nicht mit der glei-
chen Signifikanz wie in Rothenburg, Dinkelsbühl oder Nörd-
lingen, doch besitzt die klar überlieferte spätmittelalterliche
Stadtstruktur einen hohen Zeugniswert. Die innere Altstadt,
auf einem Hügel mit älterer Kirchhofbefestigung angelegt, ist
in ihrer Bodenmodellierung durch den Abbau des für die äl-
tere Stadtbefestigung benötigten Gipssteines in Stollen, die an-
schließend in großartiger Weise in ein katakombenartiges, aus
straßenartigen Gängen und saalartigen Räumen bestehendes
Kellersystem ausgebaut wurden, gleichmäßig geformt. Am
höchsten Punkt, Stadt- und landschaftbeherrschend, liegen die
als romanische Basilika um 1200 begründete Stadtpfarrkirche
und der Monumentalbau des Rathauses (im Erscheinungsbild
des 18.Jh.), baulich aufs engste verbunden, gemeinschaftlich
mit den Amts- und Bildungsbauten (Gymnasium, Stadtschrei-
berhaus, Amtsrichterhaus, Pfarrhaus), nahe bei dem durch die
Dreizahl der Stadttore bedingten keilförmigen Dreiecksmarkt,
umgeben von den wenigen, große Häuserblöcke umschließen-
den schmalen Altstadtgassen. Am Markt finden sich die für
Stadtgründungen des 13. Jh. charakteristischen schmalen und
sehr tiefen Grundstücke für die patrizisch-handelsbürgerli-
chen, oft dreigeschossigen Anwesen mit zahlreichen, in die
Tiefe gestaffelten Nebengebäuden. Der geschlossene Block des
mittelalterlichen Gettos (Judenhöflein) ist ebenso erkennbar
wie die marktartigen Plätze an der Innenseite der ursprüngli-
chen Torburgen: Platz an der Pastoriusstraße, Weinmarkt,
Schüsselmarkt beim ehern. Tor an der Altstraße nach Nürn-
berg (im Bereich der heutigen Hagelsteingasse). Das einzige
Kloster, das sich vom späten 13. Jh. bis zur Reformation hier
halten konnte, das Augustinerkloster, hinterließ den seit dem
17. Jh. zur Aufbewahrung der kostbaren Stadtbibliothek umge-
bauten spätgotischen Chor.
Die im 14.Jh. entstandene äußere Handwerkerstadt nahm die
reichsstädtischen Spitäler in sich auf. Sie zeigt eine von der äl-
teren Innenstadt abweichende ackerbürgerliche Struktur: Auf
flachem Grund breite, möglichst gerade geführte Straßen mit
lockerer Bebauung und viel Gartenland, ein- bis zweigeschos-
sige Fachwerkbauten, abwechselnd mit Scheunen. Bedeu-
tende, marktartig breite Straßenräume mit vielfach versetzten
ansehnlichen Fachwerkgiebelhäusern, teilweise im 18.Jh.
traufseitig und verputzt umgebaut, von urbanem Gesamtein-
druck, zeigen die Ausfallstraßen bei den neuen Toren: See-
gasse, Rothenburger Straße, Pastoriusstraße. Hier liegen die
meisten der großen Zierfachwerkhäuser der zweiten Hälfte des
16. Jh.
Die bereits im 16. Jh. mit dem Erstarken der Ansbacher Mark-
grafen eingeleitete Entwicklungshemmung zusammen mit den
Wirren der Reformationszeit und der Katastrophe des Drei-
ßigjährigen Krieges führte seit dem 17. Jh. zur Stagnation, Ab-
sinken zum regionalen landwirtschaftlichen Markt und, 1803,
Verlust der Eigenständigkeit.
Dadurch war bedingt, daß der überwiegend aus Holz errich-
tete Hausbestand der Stadt, der dem 14.-16.Jh. angehörte,
auch weiterhin für die Wohn- und Gewerbebedürfnisse des
einfachen Bürgers genügen mußte und nur einige herausra-
gende Familien glanzvolle Neubauten im Zeitstil errichten
konnten. Verputzt und mehrfach umgebaut, hat man in jüng-
ster Zeit in Bad Windsheim wichtige Zeugnisse des spätmittel-
alterlichen Holzsäulenbaus seit der (.Hälfte des 14.Jh. freige-
legt, wobei diese Funde im wesentlichen Zufallsfunde bei Bau-
vorhaben waren; vergleichbar wertvolle Substanz ist mit Si-
cherheit auch im Kern zahlreicher weiterer Bauten erhalten.
Als Platz- und Strassenbilder von besonderer Bedeutung
sind zu nennen:
Dr.-Martin-Luther-Platz. - Umgrenzung: Dr.-Martin-Luther-
Platz 1-4. Marktplatz 1. - Völlig abgeschlossener, dicht um-
bauter Platz im Zentrum der Stadt, die Nordseite bildet die
Stadtpfarrkirche, die Ostseite das Rathaus. Gegenüber diesen
Monumentalbauten bilden die Fachwerkgiebelhäuser des
16./17.Jh. eine malerische Baugruppe, es handelt sich hierbei
Bad Windsheim
Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs 1975/76; Benehmen mit
den Gemeinden eingeleitet 1977; Ergänzungen bis Anfang 1984;
Eintragungsstand: zahlreiche Denkmäler sind eingetragen.
Teil archäologische Geländedenkmäler: Erstellung des Entwurfs
1973-77; Benehmen mit den Gemeinden nicht eingeleitet; Ein-
tragungsstand: die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Stadt Bad Windsheim
Baudenkmäler
Bad Windsheim
Ensemble Stadt Bad Windsheim. - Umgrenzung: Nordring (ein-
schließlich Johanniterstr. 32, Nordring 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 a,
18, 18a, Metzgergasse 53/53a) - Ostring/Hilpert-Ellrodt-Pro-
menade (einschließlich Metzgergasse 64. Ostring 4, 10, 12, 18,
26, Schwedenwall 1, 3, 5, 11, 25, 27, 33, 39, 41. 41a, 43, 45, 49,
Schäfergasse 16) - Südring (einschließlich Seegasse 40 und Win-
terung) - Verlauf der Aisch ab Winterung bis zum Eisweiherweg
- Südring (einschließlich Südring 34, 38, 40, Bauhofwall 25, Ro-
thenburger Str. 35) - Westring (einschließlich Rothenburger Str.
32. Westring 2. 10, 12, 14, 20, 20a, 22, 24, 26, 30, 32, Spitalwall
23, 27, Johanniterstr. 31). -
Das Ensemble umfaßt die Stadt im Umgriff der ehern, jünge-
ren, äußeren Stadtbefestigung einschließlich ihres Grabenbe-
reiches, im Südwesten einschließlich des zur ehern. Bastion am
Seetor gehörigen Winterung-Teichs und des Aischlaufs.
Wie Rothenburg erlangt auch Windsheim im letzten Viertel
des 13. Jh. den Status der Freien Reichsstadt.
Die erste große Blütezeit der Stadt im 14. Jh. war so stürmisch,
daß bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jh. der erste, noch im
13.Jh. grundgelegte und ständig verbesserte Befestigungsring
nicht mehr ausreichte und ein zweiter von großzügiger Weite
konzipiert wurde, dessen Ausbau mit doppelten Gräben, ei-
nem Wall mit Geschützkammern, Weiherbefestigungen, 20
Türmen und drei Torburgen in der ersten Hälfte des 15. Jh. er-
folgte. Innerer und äußerer Bering haben noch lange neben-
einander bestanden und bis in das 19.Jh. das Weichbild der
Reichsstadt bestimmt. Erst im 20. Jh. ist die Stadt über diesen
Ring hinausgewachsen, nachdem 1867-82 sämtliche Türme
und Tore der Stadtmauer abgebrochen waren.
Infolgedessen erschließt sich die Reichsstadt nicht mit der glei-
chen Signifikanz wie in Rothenburg, Dinkelsbühl oder Nörd-
lingen, doch besitzt die klar überlieferte spätmittelalterliche
Stadtstruktur einen hohen Zeugniswert. Die innere Altstadt,
auf einem Hügel mit älterer Kirchhofbefestigung angelegt, ist
in ihrer Bodenmodellierung durch den Abbau des für die äl-
tere Stadtbefestigung benötigten Gipssteines in Stollen, die an-
schließend in großartiger Weise in ein katakombenartiges, aus
straßenartigen Gängen und saalartigen Räumen bestehendes
Kellersystem ausgebaut wurden, gleichmäßig geformt. Am
höchsten Punkt, Stadt- und landschaftbeherrschend, liegen die
als romanische Basilika um 1200 begründete Stadtpfarrkirche
und der Monumentalbau des Rathauses (im Erscheinungsbild
des 18.Jh.), baulich aufs engste verbunden, gemeinschaftlich
mit den Amts- und Bildungsbauten (Gymnasium, Stadtschrei-
berhaus, Amtsrichterhaus, Pfarrhaus), nahe bei dem durch die
Dreizahl der Stadttore bedingten keilförmigen Dreiecksmarkt,
umgeben von den wenigen, große Häuserblöcke umschließen-
den schmalen Altstadtgassen. Am Markt finden sich die für
Stadtgründungen des 13. Jh. charakteristischen schmalen und
sehr tiefen Grundstücke für die patrizisch-handelsbürgerli-
chen, oft dreigeschossigen Anwesen mit zahlreichen, in die
Tiefe gestaffelten Nebengebäuden. Der geschlossene Block des
mittelalterlichen Gettos (Judenhöflein) ist ebenso erkennbar
wie die marktartigen Plätze an der Innenseite der ursprüngli-
chen Torburgen: Platz an der Pastoriusstraße, Weinmarkt,
Schüsselmarkt beim ehern. Tor an der Altstraße nach Nürn-
berg (im Bereich der heutigen Hagelsteingasse). Das einzige
Kloster, das sich vom späten 13. Jh. bis zur Reformation hier
halten konnte, das Augustinerkloster, hinterließ den seit dem
17. Jh. zur Aufbewahrung der kostbaren Stadtbibliothek umge-
bauten spätgotischen Chor.
Die im 14.Jh. entstandene äußere Handwerkerstadt nahm die
reichsstädtischen Spitäler in sich auf. Sie zeigt eine von der äl-
teren Innenstadt abweichende ackerbürgerliche Struktur: Auf
flachem Grund breite, möglichst gerade geführte Straßen mit
lockerer Bebauung und viel Gartenland, ein- bis zweigeschos-
sige Fachwerkbauten, abwechselnd mit Scheunen. Bedeu-
tende, marktartig breite Straßenräume mit vielfach versetzten
ansehnlichen Fachwerkgiebelhäusern, teilweise im 18.Jh.
traufseitig und verputzt umgebaut, von urbanem Gesamtein-
druck, zeigen die Ausfallstraßen bei den neuen Toren: See-
gasse, Rothenburger Straße, Pastoriusstraße. Hier liegen die
meisten der großen Zierfachwerkhäuser der zweiten Hälfte des
16. Jh.
Die bereits im 16. Jh. mit dem Erstarken der Ansbacher Mark-
grafen eingeleitete Entwicklungshemmung zusammen mit den
Wirren der Reformationszeit und der Katastrophe des Drei-
ßigjährigen Krieges führte seit dem 17. Jh. zur Stagnation, Ab-
sinken zum regionalen landwirtschaftlichen Markt und, 1803,
Verlust der Eigenständigkeit.
Dadurch war bedingt, daß der überwiegend aus Holz errich-
tete Hausbestand der Stadt, der dem 14.-16.Jh. angehörte,
auch weiterhin für die Wohn- und Gewerbebedürfnisse des
einfachen Bürgers genügen mußte und nur einige herausra-
gende Familien glanzvolle Neubauten im Zeitstil errichten
konnten. Verputzt und mehrfach umgebaut, hat man in jüng-
ster Zeit in Bad Windsheim wichtige Zeugnisse des spätmittel-
alterlichen Holzsäulenbaus seit der (.Hälfte des 14.Jh. freige-
legt, wobei diese Funde im wesentlichen Zufallsfunde bei Bau-
vorhaben waren; vergleichbar wertvolle Substanz ist mit Si-
cherheit auch im Kern zahlreicher weiterer Bauten erhalten.
Als Platz- und Strassenbilder von besonderer Bedeutung
sind zu nennen:
Dr.-Martin-Luther-Platz. - Umgrenzung: Dr.-Martin-Luther-
Platz 1-4. Marktplatz 1. - Völlig abgeschlossener, dicht um-
bauter Platz im Zentrum der Stadt, die Nordseite bildet die
Stadtpfarrkirche, die Ostseite das Rathaus. Gegenüber diesen
Monumentalbauten bilden die Fachwerkgiebelhäuser des
16./17.Jh. eine malerische Baugruppe, es handelt sich hierbei