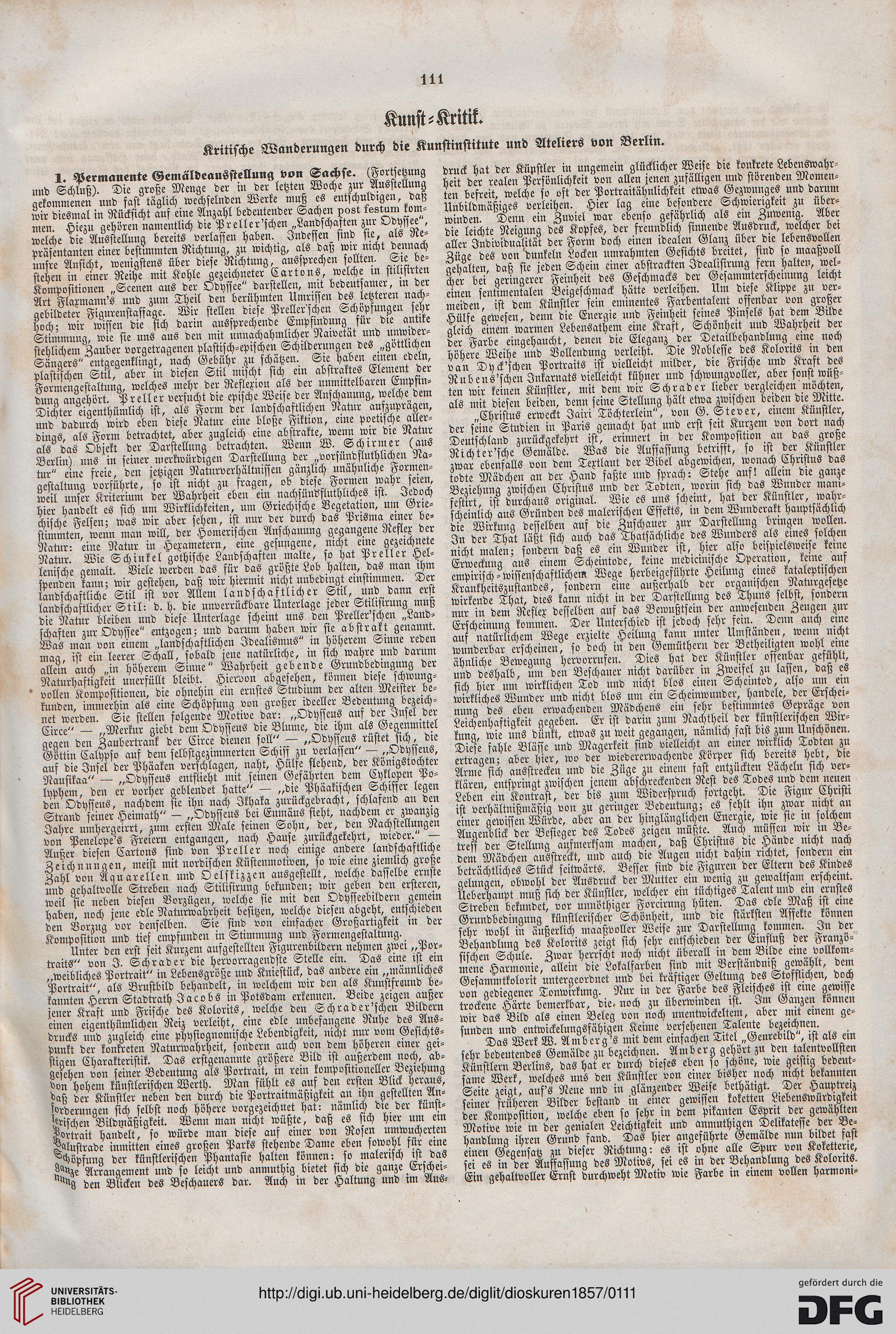111
Kunst-Kritik.
Kritische Wanderungen durch die Kunstinstitute und Ateliers von Berlin.
1. Permanente Gemäldeausstellung von Sachse. (Fortsetzung
und Schluß). Die große Menge der in der letzten Woche zur Ausstellung
gekommenen und fast täglich wechselnden Werke muß es entschuldigen, daß
wir diesmal in Rücksicht auf eine Anzahl bedeutender Sachen post kestnm kom-
men. Hiezu gehören namentlich die Preller'schen „Landschaften zur Odyssee",
welche die Ausstellung bereits verlassen haben. Indessen sind sie, als Re-
präsentanten einer bestimmten Richtung, zu wichtig, als daß wir nicht denuach
unsre Ansicht, wenigstens über diese Richtung, aussprechen sollten. Sie be-
stehen in einer Reihe mit Kohle gezeichneter Cartons, welche in stilisirten
Kompositionen „Scenen aus der Odyssee" darstellen, mit bedeutsamer, in der
Art Flaxmann's und zum Theil den berühmten Umrissen des letzteren nach-
gebildeter Figurenstasfage. Wir stellen diese Preller'schen Schöpfungen sehr
hoch; wir wissen die sich darin aussprechende Empfindung für die antike
Stimmung, wie sie uns aus den mit unnachahmlicher Naivetät und unwider-
stehlichem Zauber vorgetragencn plastisch-epischen Schilderungen des „göttlichen
Säugers" eutgegcnklingt, nach Gebühr zu schätzen. Sie haben einen edeln,
plastischen Stil, aber in diesen Stil mischt sich ein abstraktes Element der
Formengestaltung, welches mehr der Reflexion als der unmittelbaren Empfin-
dung angehört. Preller versucht die epische Weise der Anschauung, welche dem
Dichter eigenthümlich ist, als Form der landschaftlichen Natur aufzuprägen,
und dadurch wird eben diese Natur eine bloße Fiktion, eine poetische aller-
dings, als Form betrachtet, aber zugleich eine abstrakte, wenn wir die Natur
als das Objekt der Darstellung betrachten. Wenn W. Schirmer (aus
Berlin) uns in seiner merkwürdigen Darstellung der „vorsündfluthlichen Na-
tur" eine freie, den jetzigen Naturverhältnissen gänzlich unähnliche Formen-
gestaltung vorführte, so ist nicht zu fragen, ob diese Formen wahr seien,
weil unser Kriterium der Wahrheit eben ein nachsünvfluthliches ist. Jedoch
hier handelt es sich um Wirklichkeiten, um Griechische Vegetation, um Grie-
chische Felsen; was wir aber sehen, ist nur der durch das Prisma einer be-
stimmten, wenn man will, der Homerischen Anschauung gegangene Reflex der
Natur: eine Natur in Hexametern, eine gesungene, nicht eine gezeichnete
Natur. Wie Schinkel gothische Landschaften malte, so hat Preller Hel-
lenische gemalt. Viele werden das für das größte Lob halten, das man ihm
spenden kann; wir gestehen, daß wir hiermit nicht unbedingt einstimmen. Der
landschaftliche Stil ist vor Allem landschaftlicher Stil, und dann erst
landschaftlicher Stil: d. h. die unverrückbare Unterlage jeder Stilisirung muß
die Natur bleiben und diese Unterlage scheint uns den Preller'schen „Land-
schaften zur Odyssee" entzogen; und darum haben wir sic abstrakt genannt.
Was man von einem „landschaftlichen Idealismus" in höherem Sinne reden
mag, ist ein leerer Schall, sobald jene natürliche, in sich wahre und darum
allein auch „in höherem Sinne" Wahrheit gebende Grundbedingung der
Natnrhaftigkcit unerfüllt bleibt. Hiervon abgesehen, können diese schwung-
vollen Kompositionen, die ohnehin ein ernstes Studium der alten Meister be-
kunden, immerhin als eine Schöpfung von großer ideeller Bedeutung bezeich-
net werden. Sie stellen folgende Motive dar: „Odysseus auf der Insel der
Circe" — „Merkur giebt dem Odysseus die Blume, die ihm als Gegenmittel
gegen den Zaubertrank der Circe dienen soll" — „Odysseus rüstet sich, die
Göttin Calypso auf dem selbstgezimmerten Schiff zu verlassen" — „Odysseus,
auf die Insel der Phäaken verschlagen, naht, Hülfe flehend, der Königstochter
Nausikaa" — „Odysseus entflieht mit seinen Gefährten dem Cyklopen Po-
lyphem, den er vorher geblendet hatte" — „die PH irakischen Schiffer legen
den Odysseus, nachdem sie ihn nach Jkhaka zurückgebracht, schlafend an den
Strand seiner Heimath" — „Odysseus bei Enmäus sieht, nachdem er zwanzig
Jahre umhergeirrt, zum ersten Male seinen Sohn, der, den Nachstellungen
von Penelope's Freiern entgangen, nach Hause zurückgckehrt, wieder." —
Außer diesen Cartons sind von Preller noch einige andere landschaftliche
Zeichnungen, meist mit nordischen Küstenmotiven, so wie eine ziemlich große
Zahl von Aquarellen und Oelskizzen ausgestellt, welche dasselbe ernste
und gehaltvolle Streben nach Stilisirung bekunden; wir geben den ersteren,
weil sie neben diesen Vorzügen, welche sie mit den Odysseebildern gemein
haben, noch jene edle Naturwahrheit besitzen, welche diesen abgeht, entschieden
den Vorzug vor denselben. Sie sind von einfacher Großartigkeit in der
Komposition und tief empfunden in Stimmung und Formengestaltung.
Unter den erst seit Kurzem aufgestellten Figurenbildern nehmen zwei „Por-
traits" von I. Schräder die hervorragendste Stelle ein. Das eine ist ein
„weibliches Portrait" in Lebensgröße und Kniestück, das andere ein „männliches
Portrait", als Brustbild behandelt, in welchem wir den als Kunstfreund be-
kannten Herrn Stadtrath Jacobs in Potsdam erkennen. Beide zeigen außer
jener Kraft und Frische des Kolorits, welche den Schrader'schen Bildern
einen eigenthümlichen Reiz verleiht, eine edle unbefangene Ruhe des Aus-
drucks und zugleich eine physiognomische Lebendigkeit, nicht nur vom Gesichts-
punkt der konkreten Naturwahrheit, sondern auch von dem höheren einer gei-
stigen Charakteristik. Das erstgenannte größere Bild ist außerdem noch, ab-
gesehen von seiner Bedeutung als Portrait, in rein kompositioneller Beziehung
don hohem künstlerischen Werth. Man fühlt es auf den ersten Blick heraus,
^aß der Künstler neben den durch die Portraitmäßigkeit an ihn gestellten An-
wrderungen sich selbst noch höhere vorgezeichuet hat: nämlich die der künst-
Nischen Bildinäßigkeit. Wenn man nicht wüßte, daß es sich hier um ein
^rtrait handelt, so würde man diese auf einer von Rosen umwucherten
Mustrade inmitten eines großen Parks stehende Dame eben sowohl für eine
Schöpfung der künstlerischen Phantasie halten können: so malerisch ist das
^ze Arrangement und so leicht und anmuthig bietet sich die ganze Erschei-
den Blicken des Beschauers dar. Auch in der Haltung und im Aus-
druck hat der Künstler in ungemein glücklicher Weise die konkrete Lebenswahr-
heit der realen Persönlichkeit von allen jenen zufälligen und störenden Momen-
ten befreit, welche so oft der Portraitähnlichkeit etwas Gezwnnges und darum
Unbildmäßiges verleihen. Hier lag eine besondere Schwierigkeit zu über-
winden. Denn ein Zuviel war ebenso gefährlich als ein Zuwenig. Aber
die leichte Neigung des Kopfes, der freundlich sinnende Ausdruck, welcher bei
aller Individualität der Form doch einen idealen Glanz über die lebensvollen
Züge des von'dunkeln Locken umrahmten Gesichts breitet, sind so maaßvoll
gehalten, daß sie jeden Schein einer abstrackten Jdealisirung fern halten, wel-
cher bei geringerer Feinheit des Geschmacks der Gesammterscheinung leicht
einen sentimentalen Beigeschmack hätte verleihen. Um diese Klippe zu ver-
meiden, ist dem Künstler sein eminentes Farbentalent offenbar von großer
Hülfe gewesen, denn die Energie und Feinheit seines Pinsels hat dem Bilde
gleich einem warmen Lebensathem eine Kraft, Schönheit und Wahrheit der
der Farbe eingehaucht, denen die Eleganz der Detailbehandlung eine noch
höhere Weihe und Vollendung verleiht. Die Noblesse des Kolorits in den
van Dyck'schen Portraits ist vielleicht milder, die Frische und Kraft des
Rubens'schen Inkarnats vielleicht kühner und schwungvoller, aber sonst wüß-
ten wir keinen Künstler, mit dem wir Schräder lieber vergleichen möchten,
als mit diesen beiden, denn seine Stellung hält etwa zwischen beiden die Mitte.
„Christus erweckt Jairi Töchterlein", von G. Stever, einem Künstler,
der seine Studien in Paris gemacht hat und erst seit Kurzem von dort nach
Deutschland zurückgckehrt ist, erinnert in der Komposition an das große
Richter'sche Gemälde. Was die Auffassung betrifft, so ist der Künstler
zwar ebenfalls von dem Textlant der Bibel abgewichen, wonach Christus das
todte Mädchen an der Hand faßte und sprach: Stehe auf! allein die ganze
Beziehung zwischen Christus und der Todten, worin sich das Wunder mam-
festirt, ist durchaus original. Wie es uns scheint, hat der Künstler, wahr-
scheinlich aus Gründen des malerischen Effekts, in dem Wunderakt hauptsächlich
die Wirkung desselben auf die Zuschauer zur Darstellung bringen wollen.
In der That läßt sich auch das Thatsächliche des Wunders als eines solchen
nicht malen; sondern daß es ein Wunder ist, hier also beispielsweise keine
Erweckung aus einem Scheintodc, keine medicinische Operation, keine auf
empirisch-wissenschaftlichem Wege herbeigeführte Heilung eines kataleptischen
Krankhcitszustandes, sondern eine außerhalb der organischen Naturgesetze
wirkende That, dies kann nicht in der Darstellung des Thuns selbst, sondern
nur in dem Reflex desselben auf das Bewußtsein der anwesenden Zeugen zur
Erscheinung kommen. Der Unterschied ist jedoch sehr fein. Denn auch eine
auf natürlichem Wege erzielte Heilung kann unter Umständen, wenn nicht
wunderbar erscheinen, so doch in den Gemüthern der Betheiligten wohl eine
ähnliche Bewegung Hervorrufen. Dies hat der Künstler offenbar gefühlt,
und deshalb, um den Beschauer nicht darüber in Zweifel zu lassen, daß es
sich hier um wirklichen Tod und nicht blos einen Scheintod, also um ein
wirkliches Wunder und nicht blos um ein Scheinwundcr, handele, der Erschei-
nung des eben erwachenden Mädchens ein sehr bestimmtes Gepräge von
Leichenhaftigkeit gegeben. Er ist darin zum Nachtheil der künstlerischen Wir-
kung, wie uns dünkt, etwas zu weit gegangen, nämlich fast bis zum Unschönen.
Diese fahle Blässe und Magerkeit sind vielleicht an einer wirklich Todten zu
ertragen; aber hier, wo der wiedererwachende Körper sich bereits hebt, die
Arme sich ausstrecken und die Züge zu einem fast entzückten Lächeln sich ver-
klären, entspringt zwischen jenem abschreckenden Rest des Todes und dem neuen
Leben ein Kontrast, der bis zum Widerspruch fortgeht. Die Figur Christi
ist verhältnißmäßig von zu geringer Bedeutung; es fehlt ihn zwar nicht an
einer gewissen Würde, aber an der hinglänglichen Energie, wie sie in solchem
Augenblick der Besieger des Todes zeigen müßte. Auch müssen wir in Be-
treff der Stellung aufmerksam machen, daß Christus die Hände nicht nach
dem Mädchen ausstreckt, und auch die Augen nicht dahin richtet, sondern ein
beträchtliches Stück seitwärts. Besser sind die Figuren der Eltern des Kindes
gelungen, obwohl der Ausdruck der Mutter ein wenig zu gewaltsam erscheint.
Ueberhaupt muß sich der Künstler, welcher ein tüchtiges Talent und ein ernstes
Streben bekundet, vor unnöthiger Forcirung hüten. Das edle Maß ist eine
Grundbedingung künstlerischer Schönheit, und die stärksten Affekte können
sehr wohl in äußerlich maaßvoller Weise zur Darstellung kommen. In der
Behandlung des Kolorits zeigt sich sehr entschieden der Einfluß der Franzö-
sischen Schule. Zwar herrscht noch nicht überall in dem Bilde eine vollkom-
mene Harmonie, allein die Lokalfarben sind mit Verständniß gewählt, dem
Gesammtkolorit untergeordnet und bei kräftiger Geltung des Stofflichen, doch
von gediegener Tonwirkung. Nur in der Farbe des Fleisches ist eine gewisse
trockene Härte bemerkbar, die« noch zu überwinden ist. Im Ganzen können
wir das Bild als einen Beleg von noch unentwickeltem, aber mit einem ge-
sunden und cntwickelungsfähigen Keime versehenen Talente bezeichnen.
Das Werk W. Amberg's mit dem einfachen Titel „Genrebild", ist als ein
sehr bedeutendes Gemälde zu bezeichnen. Amberg gehört zu den talentvollsten
Künstlern Berlins, das hat er durch dieses eben so schöne, wie geistig bedeut-
same Werk, welches uns den Künstler von einer bisher noch nicht bekannten
Seite zeigt, auf's Neue und in glänzender Weise bethätigt. Der Hauptreiz
seiner früheren Bilder bestand in einer gewissen koketten Liebenswürdigkeit
der Komposition, welche eben so sehr in dem pikanten Esprit der gewählten
Motive wie in der genialen Leichtigkeit und anmuthigen Delikatesse der Be-
handlung ihren Grund fand. Das hier angeführte Gemälde nun bildet fast
einen Gegensatz zu dieser Richtung: es ist ohne alle Spur von Koketterie,
sei es in der Auffassung des Motivs, sei es in der Behandlung des Kolorits.
Ein gehaltvoller Ernst durchweht Motiv wie Farbe in einem vollen harmoni-
Kunst-Kritik.
Kritische Wanderungen durch die Kunstinstitute und Ateliers von Berlin.
1. Permanente Gemäldeausstellung von Sachse. (Fortsetzung
und Schluß). Die große Menge der in der letzten Woche zur Ausstellung
gekommenen und fast täglich wechselnden Werke muß es entschuldigen, daß
wir diesmal in Rücksicht auf eine Anzahl bedeutender Sachen post kestnm kom-
men. Hiezu gehören namentlich die Preller'schen „Landschaften zur Odyssee",
welche die Ausstellung bereits verlassen haben. Indessen sind sie, als Re-
präsentanten einer bestimmten Richtung, zu wichtig, als daß wir nicht denuach
unsre Ansicht, wenigstens über diese Richtung, aussprechen sollten. Sie be-
stehen in einer Reihe mit Kohle gezeichneter Cartons, welche in stilisirten
Kompositionen „Scenen aus der Odyssee" darstellen, mit bedeutsamer, in der
Art Flaxmann's und zum Theil den berühmten Umrissen des letzteren nach-
gebildeter Figurenstasfage. Wir stellen diese Preller'schen Schöpfungen sehr
hoch; wir wissen die sich darin aussprechende Empfindung für die antike
Stimmung, wie sie uns aus den mit unnachahmlicher Naivetät und unwider-
stehlichem Zauber vorgetragencn plastisch-epischen Schilderungen des „göttlichen
Säugers" eutgegcnklingt, nach Gebühr zu schätzen. Sie haben einen edeln,
plastischen Stil, aber in diesen Stil mischt sich ein abstraktes Element der
Formengestaltung, welches mehr der Reflexion als der unmittelbaren Empfin-
dung angehört. Preller versucht die epische Weise der Anschauung, welche dem
Dichter eigenthümlich ist, als Form der landschaftlichen Natur aufzuprägen,
und dadurch wird eben diese Natur eine bloße Fiktion, eine poetische aller-
dings, als Form betrachtet, aber zugleich eine abstrakte, wenn wir die Natur
als das Objekt der Darstellung betrachten. Wenn W. Schirmer (aus
Berlin) uns in seiner merkwürdigen Darstellung der „vorsündfluthlichen Na-
tur" eine freie, den jetzigen Naturverhältnissen gänzlich unähnliche Formen-
gestaltung vorführte, so ist nicht zu fragen, ob diese Formen wahr seien,
weil unser Kriterium der Wahrheit eben ein nachsünvfluthliches ist. Jedoch
hier handelt es sich um Wirklichkeiten, um Griechische Vegetation, um Grie-
chische Felsen; was wir aber sehen, ist nur der durch das Prisma einer be-
stimmten, wenn man will, der Homerischen Anschauung gegangene Reflex der
Natur: eine Natur in Hexametern, eine gesungene, nicht eine gezeichnete
Natur. Wie Schinkel gothische Landschaften malte, so hat Preller Hel-
lenische gemalt. Viele werden das für das größte Lob halten, das man ihm
spenden kann; wir gestehen, daß wir hiermit nicht unbedingt einstimmen. Der
landschaftliche Stil ist vor Allem landschaftlicher Stil, und dann erst
landschaftlicher Stil: d. h. die unverrückbare Unterlage jeder Stilisirung muß
die Natur bleiben und diese Unterlage scheint uns den Preller'schen „Land-
schaften zur Odyssee" entzogen; und darum haben wir sic abstrakt genannt.
Was man von einem „landschaftlichen Idealismus" in höherem Sinne reden
mag, ist ein leerer Schall, sobald jene natürliche, in sich wahre und darum
allein auch „in höherem Sinne" Wahrheit gebende Grundbedingung der
Natnrhaftigkcit unerfüllt bleibt. Hiervon abgesehen, können diese schwung-
vollen Kompositionen, die ohnehin ein ernstes Studium der alten Meister be-
kunden, immerhin als eine Schöpfung von großer ideeller Bedeutung bezeich-
net werden. Sie stellen folgende Motive dar: „Odysseus auf der Insel der
Circe" — „Merkur giebt dem Odysseus die Blume, die ihm als Gegenmittel
gegen den Zaubertrank der Circe dienen soll" — „Odysseus rüstet sich, die
Göttin Calypso auf dem selbstgezimmerten Schiff zu verlassen" — „Odysseus,
auf die Insel der Phäaken verschlagen, naht, Hülfe flehend, der Königstochter
Nausikaa" — „Odysseus entflieht mit seinen Gefährten dem Cyklopen Po-
lyphem, den er vorher geblendet hatte" — „die PH irakischen Schiffer legen
den Odysseus, nachdem sie ihn nach Jkhaka zurückgebracht, schlafend an den
Strand seiner Heimath" — „Odysseus bei Enmäus sieht, nachdem er zwanzig
Jahre umhergeirrt, zum ersten Male seinen Sohn, der, den Nachstellungen
von Penelope's Freiern entgangen, nach Hause zurückgckehrt, wieder." —
Außer diesen Cartons sind von Preller noch einige andere landschaftliche
Zeichnungen, meist mit nordischen Küstenmotiven, so wie eine ziemlich große
Zahl von Aquarellen und Oelskizzen ausgestellt, welche dasselbe ernste
und gehaltvolle Streben nach Stilisirung bekunden; wir geben den ersteren,
weil sie neben diesen Vorzügen, welche sie mit den Odysseebildern gemein
haben, noch jene edle Naturwahrheit besitzen, welche diesen abgeht, entschieden
den Vorzug vor denselben. Sie sind von einfacher Großartigkeit in der
Komposition und tief empfunden in Stimmung und Formengestaltung.
Unter den erst seit Kurzem aufgestellten Figurenbildern nehmen zwei „Por-
traits" von I. Schräder die hervorragendste Stelle ein. Das eine ist ein
„weibliches Portrait" in Lebensgröße und Kniestück, das andere ein „männliches
Portrait", als Brustbild behandelt, in welchem wir den als Kunstfreund be-
kannten Herrn Stadtrath Jacobs in Potsdam erkennen. Beide zeigen außer
jener Kraft und Frische des Kolorits, welche den Schrader'schen Bildern
einen eigenthümlichen Reiz verleiht, eine edle unbefangene Ruhe des Aus-
drucks und zugleich eine physiognomische Lebendigkeit, nicht nur vom Gesichts-
punkt der konkreten Naturwahrheit, sondern auch von dem höheren einer gei-
stigen Charakteristik. Das erstgenannte größere Bild ist außerdem noch, ab-
gesehen von seiner Bedeutung als Portrait, in rein kompositioneller Beziehung
don hohem künstlerischen Werth. Man fühlt es auf den ersten Blick heraus,
^aß der Künstler neben den durch die Portraitmäßigkeit an ihn gestellten An-
wrderungen sich selbst noch höhere vorgezeichuet hat: nämlich die der künst-
Nischen Bildinäßigkeit. Wenn man nicht wüßte, daß es sich hier um ein
^rtrait handelt, so würde man diese auf einer von Rosen umwucherten
Mustrade inmitten eines großen Parks stehende Dame eben sowohl für eine
Schöpfung der künstlerischen Phantasie halten können: so malerisch ist das
^ze Arrangement und so leicht und anmuthig bietet sich die ganze Erschei-
den Blicken des Beschauers dar. Auch in der Haltung und im Aus-
druck hat der Künstler in ungemein glücklicher Weise die konkrete Lebenswahr-
heit der realen Persönlichkeit von allen jenen zufälligen und störenden Momen-
ten befreit, welche so oft der Portraitähnlichkeit etwas Gezwnnges und darum
Unbildmäßiges verleihen. Hier lag eine besondere Schwierigkeit zu über-
winden. Denn ein Zuviel war ebenso gefährlich als ein Zuwenig. Aber
die leichte Neigung des Kopfes, der freundlich sinnende Ausdruck, welcher bei
aller Individualität der Form doch einen idealen Glanz über die lebensvollen
Züge des von'dunkeln Locken umrahmten Gesichts breitet, sind so maaßvoll
gehalten, daß sie jeden Schein einer abstrackten Jdealisirung fern halten, wel-
cher bei geringerer Feinheit des Geschmacks der Gesammterscheinung leicht
einen sentimentalen Beigeschmack hätte verleihen. Um diese Klippe zu ver-
meiden, ist dem Künstler sein eminentes Farbentalent offenbar von großer
Hülfe gewesen, denn die Energie und Feinheit seines Pinsels hat dem Bilde
gleich einem warmen Lebensathem eine Kraft, Schönheit und Wahrheit der
der Farbe eingehaucht, denen die Eleganz der Detailbehandlung eine noch
höhere Weihe und Vollendung verleiht. Die Noblesse des Kolorits in den
van Dyck'schen Portraits ist vielleicht milder, die Frische und Kraft des
Rubens'schen Inkarnats vielleicht kühner und schwungvoller, aber sonst wüß-
ten wir keinen Künstler, mit dem wir Schräder lieber vergleichen möchten,
als mit diesen beiden, denn seine Stellung hält etwa zwischen beiden die Mitte.
„Christus erweckt Jairi Töchterlein", von G. Stever, einem Künstler,
der seine Studien in Paris gemacht hat und erst seit Kurzem von dort nach
Deutschland zurückgckehrt ist, erinnert in der Komposition an das große
Richter'sche Gemälde. Was die Auffassung betrifft, so ist der Künstler
zwar ebenfalls von dem Textlant der Bibel abgewichen, wonach Christus das
todte Mädchen an der Hand faßte und sprach: Stehe auf! allein die ganze
Beziehung zwischen Christus und der Todten, worin sich das Wunder mam-
festirt, ist durchaus original. Wie es uns scheint, hat der Künstler, wahr-
scheinlich aus Gründen des malerischen Effekts, in dem Wunderakt hauptsächlich
die Wirkung desselben auf die Zuschauer zur Darstellung bringen wollen.
In der That läßt sich auch das Thatsächliche des Wunders als eines solchen
nicht malen; sondern daß es ein Wunder ist, hier also beispielsweise keine
Erweckung aus einem Scheintodc, keine medicinische Operation, keine auf
empirisch-wissenschaftlichem Wege herbeigeführte Heilung eines kataleptischen
Krankhcitszustandes, sondern eine außerhalb der organischen Naturgesetze
wirkende That, dies kann nicht in der Darstellung des Thuns selbst, sondern
nur in dem Reflex desselben auf das Bewußtsein der anwesenden Zeugen zur
Erscheinung kommen. Der Unterschied ist jedoch sehr fein. Denn auch eine
auf natürlichem Wege erzielte Heilung kann unter Umständen, wenn nicht
wunderbar erscheinen, so doch in den Gemüthern der Betheiligten wohl eine
ähnliche Bewegung Hervorrufen. Dies hat der Künstler offenbar gefühlt,
und deshalb, um den Beschauer nicht darüber in Zweifel zu lassen, daß es
sich hier um wirklichen Tod und nicht blos einen Scheintod, also um ein
wirkliches Wunder und nicht blos um ein Scheinwundcr, handele, der Erschei-
nung des eben erwachenden Mädchens ein sehr bestimmtes Gepräge von
Leichenhaftigkeit gegeben. Er ist darin zum Nachtheil der künstlerischen Wir-
kung, wie uns dünkt, etwas zu weit gegangen, nämlich fast bis zum Unschönen.
Diese fahle Blässe und Magerkeit sind vielleicht an einer wirklich Todten zu
ertragen; aber hier, wo der wiedererwachende Körper sich bereits hebt, die
Arme sich ausstrecken und die Züge zu einem fast entzückten Lächeln sich ver-
klären, entspringt zwischen jenem abschreckenden Rest des Todes und dem neuen
Leben ein Kontrast, der bis zum Widerspruch fortgeht. Die Figur Christi
ist verhältnißmäßig von zu geringer Bedeutung; es fehlt ihn zwar nicht an
einer gewissen Würde, aber an der hinglänglichen Energie, wie sie in solchem
Augenblick der Besieger des Todes zeigen müßte. Auch müssen wir in Be-
treff der Stellung aufmerksam machen, daß Christus die Hände nicht nach
dem Mädchen ausstreckt, und auch die Augen nicht dahin richtet, sondern ein
beträchtliches Stück seitwärts. Besser sind die Figuren der Eltern des Kindes
gelungen, obwohl der Ausdruck der Mutter ein wenig zu gewaltsam erscheint.
Ueberhaupt muß sich der Künstler, welcher ein tüchtiges Talent und ein ernstes
Streben bekundet, vor unnöthiger Forcirung hüten. Das edle Maß ist eine
Grundbedingung künstlerischer Schönheit, und die stärksten Affekte können
sehr wohl in äußerlich maaßvoller Weise zur Darstellung kommen. In der
Behandlung des Kolorits zeigt sich sehr entschieden der Einfluß der Franzö-
sischen Schule. Zwar herrscht noch nicht überall in dem Bilde eine vollkom-
mene Harmonie, allein die Lokalfarben sind mit Verständniß gewählt, dem
Gesammtkolorit untergeordnet und bei kräftiger Geltung des Stofflichen, doch
von gediegener Tonwirkung. Nur in der Farbe des Fleisches ist eine gewisse
trockene Härte bemerkbar, die« noch zu überwinden ist. Im Ganzen können
wir das Bild als einen Beleg von noch unentwickeltem, aber mit einem ge-
sunden und cntwickelungsfähigen Keime versehenen Talente bezeichnen.
Das Werk W. Amberg's mit dem einfachen Titel „Genrebild", ist als ein
sehr bedeutendes Gemälde zu bezeichnen. Amberg gehört zu den talentvollsten
Künstlern Berlins, das hat er durch dieses eben so schöne, wie geistig bedeut-
same Werk, welches uns den Künstler von einer bisher noch nicht bekannten
Seite zeigt, auf's Neue und in glänzender Weise bethätigt. Der Hauptreiz
seiner früheren Bilder bestand in einer gewissen koketten Liebenswürdigkeit
der Komposition, welche eben so sehr in dem pikanten Esprit der gewählten
Motive wie in der genialen Leichtigkeit und anmuthigen Delikatesse der Be-
handlung ihren Grund fand. Das hier angeführte Gemälde nun bildet fast
einen Gegensatz zu dieser Richtung: es ist ohne alle Spur von Koketterie,
sei es in der Auffassung des Motivs, sei es in der Behandlung des Kolorits.
Ein gehaltvoller Ernst durchweht Motiv wie Farbe in einem vollen harmoni-