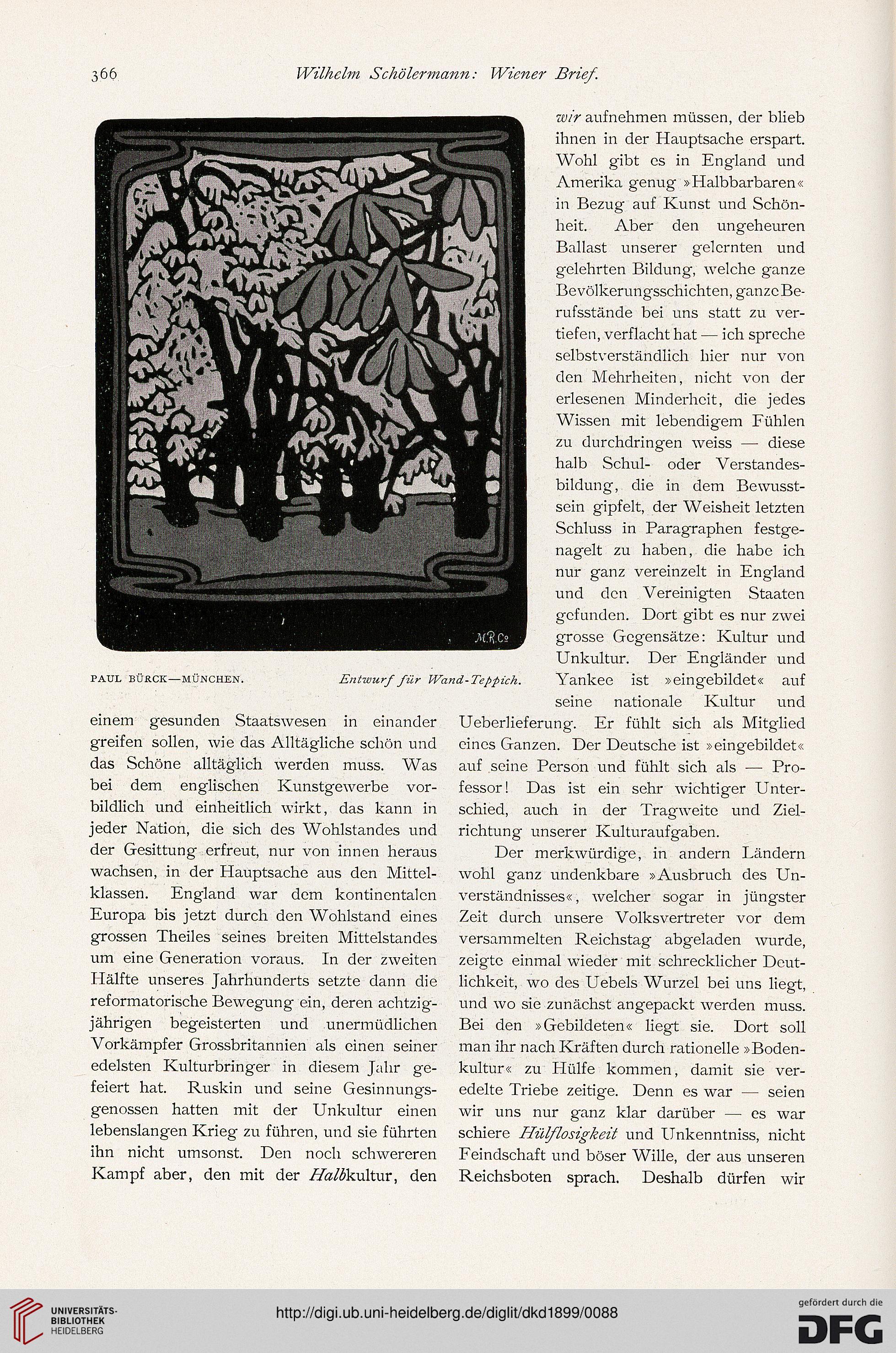366
Wilhelm Schölermann: Wiener Brief.
PAUL HURCK—MÜNCHEN.
Entwurf für Wand-Teppich.
einem gesunden Staatswesen in einander
greifen sollen, wie das Alltägliche schön und
das Schöne alltäglich werden muss. Was
bei dem englischen Kunstgewerbe vor-
bildlich und einheitlich wirkt, das kann in
jeder Nation, die sich des Wohlstandes und
der Gesittung erfreut, nur von innen heraus
wachsen, in der Hauptsache aus den Mittel-
klassen. England war dem kontinentalen
Europa bis jetzt durch den Wohlstand eines
grossen Theiles seines breiten Mittelshin des
um eine Generation voraus. In der zweiten
Hälfte unseres Jahrhunderts setzte dann die
reformatorische Bewegung ein, deren achtzig-
jährigen begeisterten und unermüdlichen
Vorkämpfer Grossbritannien als einen seiner
edelsten Kulturbringer in diesem Jahr ge-
feiert hat. Ruskin und seine Gesinnungs-
genossen hatten mit der Unkultur einen
lebenslangen Krieg zu führen, und sie führten
ihn nicht umsonst. Den noch schwereren
Kampf aber, den mit der ffalÖkvltar, den
wir aufnehmen müssen, der blieb
ihnen in der Hauptsache erspart.
Wohl gibt es in England und
Amerika genug »Halbbarbaren«
in Bezug auf Kunst und Schön-
heit. Aber den ungeheuren
Ballast unserer gelernten und
gelehrten Bildung, welche ganze
Bevölkerungsschichten, ganzcBe-
rufsstände bei uns statt zu ver-
tiefen, verflacht hat — ich spreche
selbstverständlich hier nur von
den Mehrheiten, nicht von der
erlesenen Minderheit, die jedes
Wissen mit lebendigem Fühlen
zu durchdringen weiss — diese
halb Schul- oder Verstandes-
bildung, die in dem Bewusst-
sein gipfelt, der Weisheit letzten
Schluss in Paragraphen festge-
nagelt zu haben, die habe ich
nur ganz vereinzelt in England
und den Vereinigten Staaten
gefunden. Dort gibt es nur zwei
grosse Gegensätze: Kultur und
Unkultur. Der Engländer und
Yankee ist »eingebildet« auf
seine nationale Kultur und
Ueberlieferung. Er fühlt sich als Mitglied
eines Ganzen. Der Deutsche ist »eingebildet«
auf seine Person und fühlt sich als — Pro-
fessor! Das ist ein sehr wichtiger Unter-
schied, auch in der Tragweite und Ziel-
richtung unserer Kulturaufgaben.
Der merkwürdige, in andern Ländern
wohl ganz undenkbare »Ausbruch des Un-
verständnisses« , welcher sogar in jüngster
Zeit durch unsere Volksvertreter vor dem
versammelten Reichstag abgeladen wurde,
zeigte einmal wieder mit schrecklicher Deut-
lichkeit, wo des Uebels Wurzel bei uns liegt,
und wo sie zunächst angepackt werden muss.
Bei den »Gebildeten« liegt sie. Dort soll
man ihr nach Kräften durch rationelle »Boden-
kultur« zu Hülfe kommen, damit sie ver-
edelte Triebe zeitige. Denn es war — seien
wir uns nur ganz klar darüber — es war
schiere Hülflosigkeit und Unkenntniss, nicht
Feindschaft und böser Wille, der aus unseren
Reichsboten sprach. Deshalb dürfen wir
Wilhelm Schölermann: Wiener Brief.
PAUL HURCK—MÜNCHEN.
Entwurf für Wand-Teppich.
einem gesunden Staatswesen in einander
greifen sollen, wie das Alltägliche schön und
das Schöne alltäglich werden muss. Was
bei dem englischen Kunstgewerbe vor-
bildlich und einheitlich wirkt, das kann in
jeder Nation, die sich des Wohlstandes und
der Gesittung erfreut, nur von innen heraus
wachsen, in der Hauptsache aus den Mittel-
klassen. England war dem kontinentalen
Europa bis jetzt durch den Wohlstand eines
grossen Theiles seines breiten Mittelshin des
um eine Generation voraus. In der zweiten
Hälfte unseres Jahrhunderts setzte dann die
reformatorische Bewegung ein, deren achtzig-
jährigen begeisterten und unermüdlichen
Vorkämpfer Grossbritannien als einen seiner
edelsten Kulturbringer in diesem Jahr ge-
feiert hat. Ruskin und seine Gesinnungs-
genossen hatten mit der Unkultur einen
lebenslangen Krieg zu führen, und sie führten
ihn nicht umsonst. Den noch schwereren
Kampf aber, den mit der ffalÖkvltar, den
wir aufnehmen müssen, der blieb
ihnen in der Hauptsache erspart.
Wohl gibt es in England und
Amerika genug »Halbbarbaren«
in Bezug auf Kunst und Schön-
heit. Aber den ungeheuren
Ballast unserer gelernten und
gelehrten Bildung, welche ganze
Bevölkerungsschichten, ganzcBe-
rufsstände bei uns statt zu ver-
tiefen, verflacht hat — ich spreche
selbstverständlich hier nur von
den Mehrheiten, nicht von der
erlesenen Minderheit, die jedes
Wissen mit lebendigem Fühlen
zu durchdringen weiss — diese
halb Schul- oder Verstandes-
bildung, die in dem Bewusst-
sein gipfelt, der Weisheit letzten
Schluss in Paragraphen festge-
nagelt zu haben, die habe ich
nur ganz vereinzelt in England
und den Vereinigten Staaten
gefunden. Dort gibt es nur zwei
grosse Gegensätze: Kultur und
Unkultur. Der Engländer und
Yankee ist »eingebildet« auf
seine nationale Kultur und
Ueberlieferung. Er fühlt sich als Mitglied
eines Ganzen. Der Deutsche ist »eingebildet«
auf seine Person und fühlt sich als — Pro-
fessor! Das ist ein sehr wichtiger Unter-
schied, auch in der Tragweite und Ziel-
richtung unserer Kulturaufgaben.
Der merkwürdige, in andern Ländern
wohl ganz undenkbare »Ausbruch des Un-
verständnisses« , welcher sogar in jüngster
Zeit durch unsere Volksvertreter vor dem
versammelten Reichstag abgeladen wurde,
zeigte einmal wieder mit schrecklicher Deut-
lichkeit, wo des Uebels Wurzel bei uns liegt,
und wo sie zunächst angepackt werden muss.
Bei den »Gebildeten« liegt sie. Dort soll
man ihr nach Kräften durch rationelle »Boden-
kultur« zu Hülfe kommen, damit sie ver-
edelte Triebe zeitige. Denn es war — seien
wir uns nur ganz klar darüber — es war
schiere Hülflosigkeit und Unkenntniss, nicht
Feindschaft und böser Wille, der aus unseren
Reichsboten sprach. Deshalb dürfen wir