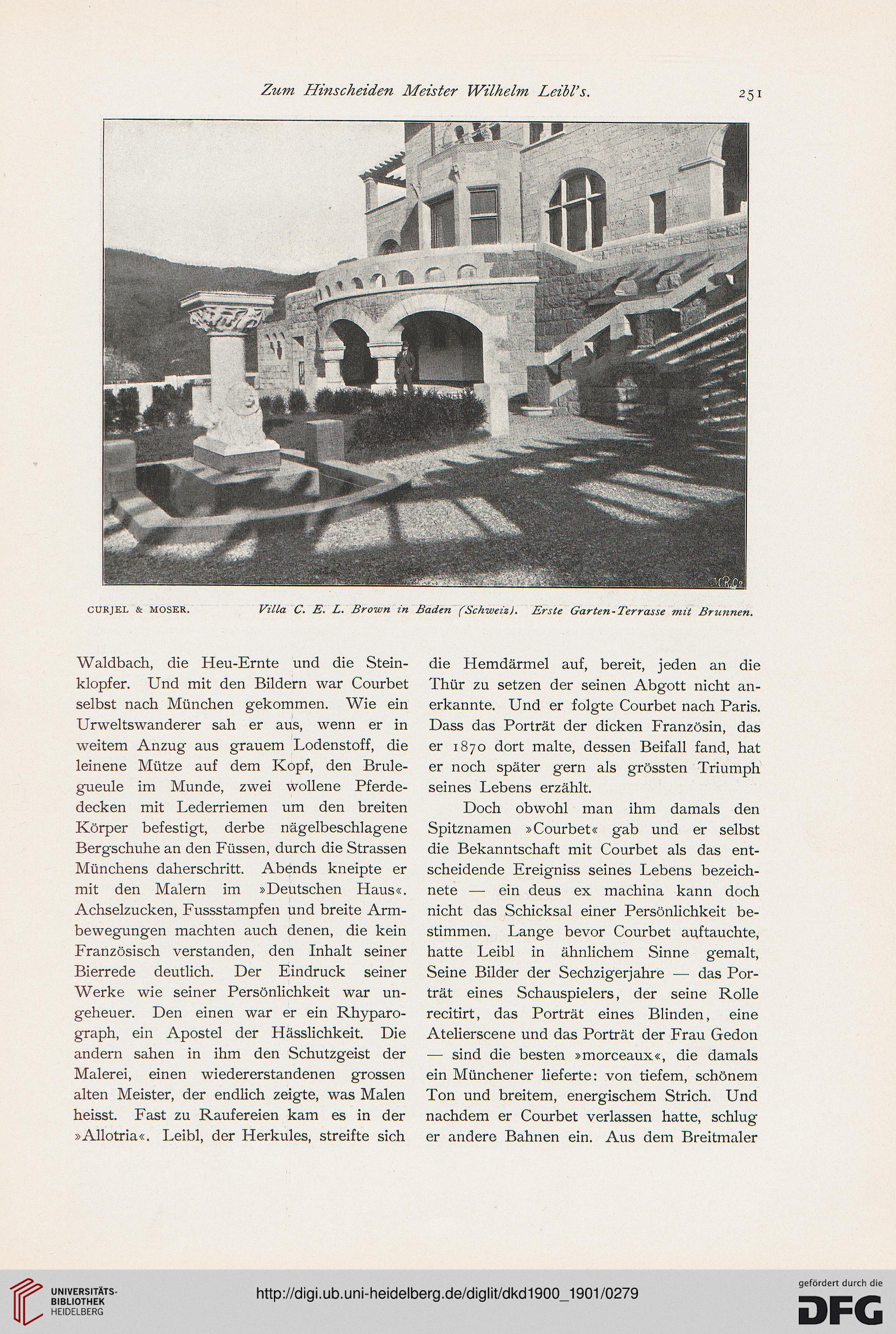Zum Hinscheiden Meister Wilhelm Leibl's.
Waldbach, die Heu-Ernte und die Stein-
klopfer. Und mit den Bildern war Courbet
selbst nach München gekommen. Wie ein
Urweltswanderer sah er aus, wenn er in
weitem Anzug aus grauem Lodenstoff, die
leinene Mütze auf dem Kopf, den Brule-
gueule im Munde, zwei wollene Pferde-
decken mit Lederriemen um den breiten
Körper befestigt, derbe nägelbeschlagene
Bergschuhe an den Füssen, durch die Strassen
Münchens daherschritt. Abends kneipte er
mit den Malern im »Deutschen Haus«.
Achselzucken, Fussstampfen und breite Arm-
bewegungen machten auch denen, die kein
Französisch verstanden, den Inhalt seiner
Bierrede deutlich. Der Eindruck seiner
Werke wie seiner Persönlichkeit war un-
geheuer. Den einen war er ein Rhyparo-
graph, ein Apostel der Hässlichkeit. Die
andern sahen in ihm den Schutzgeist der
Malerei, einen wiedererstandenen grossen
alten Meister, der endlich zeigte, was Malen
heisst. Fast zu Raufereien kam es in der
»Allotria«. Leibi, der Herkules, streifte sich
die Hemdärmel auf, bereit, jeden an die
Thür zu setzen der seinen Abgott nicht an-
erkannte. Und er folgte Courbet nach Paris.
Dass das Porträt der dicken Französin, das
er 1870 dort malte, dessen Beifall fand, hat
er noch später gern als grössten Triumph
seines Lebens erzählt.
Doch obwohl man ihm damals den
Spitznamen »Courbet« gab und er selbst
die Bekanntschaft mit Courbet als das ent-
scheidende Ereigniss seines Lebens bezeich-
nete — ein deus ex machina kann doch
nicht das Schicksal einer Persönlichkeit be-
stimmen. Lange bevor Courbet auftauchte,
hatte Leibi in ähnlichem Sinne gemalt,
Seine Bilder der Sechzigerjahre — das Por-
trät eines Schauspielers, der seine Rolle
recitirt, das Porträt eines Blinden, eine
Atelierscene und das Porträt der Frau Gedon
— sind die besten »morceaux«, die damals
ein Münchener lieferte: von tiefem, schönem
Ton und breitem, energischem Strich. Und
nachdem er Courbet verlassen hatte, schlug
er andere Bahnen ein. Aus dem Breitmaler
Waldbach, die Heu-Ernte und die Stein-
klopfer. Und mit den Bildern war Courbet
selbst nach München gekommen. Wie ein
Urweltswanderer sah er aus, wenn er in
weitem Anzug aus grauem Lodenstoff, die
leinene Mütze auf dem Kopf, den Brule-
gueule im Munde, zwei wollene Pferde-
decken mit Lederriemen um den breiten
Körper befestigt, derbe nägelbeschlagene
Bergschuhe an den Füssen, durch die Strassen
Münchens daherschritt. Abends kneipte er
mit den Malern im »Deutschen Haus«.
Achselzucken, Fussstampfen und breite Arm-
bewegungen machten auch denen, die kein
Französisch verstanden, den Inhalt seiner
Bierrede deutlich. Der Eindruck seiner
Werke wie seiner Persönlichkeit war un-
geheuer. Den einen war er ein Rhyparo-
graph, ein Apostel der Hässlichkeit. Die
andern sahen in ihm den Schutzgeist der
Malerei, einen wiedererstandenen grossen
alten Meister, der endlich zeigte, was Malen
heisst. Fast zu Raufereien kam es in der
»Allotria«. Leibi, der Herkules, streifte sich
die Hemdärmel auf, bereit, jeden an die
Thür zu setzen der seinen Abgott nicht an-
erkannte. Und er folgte Courbet nach Paris.
Dass das Porträt der dicken Französin, das
er 1870 dort malte, dessen Beifall fand, hat
er noch später gern als grössten Triumph
seines Lebens erzählt.
Doch obwohl man ihm damals den
Spitznamen »Courbet« gab und er selbst
die Bekanntschaft mit Courbet als das ent-
scheidende Ereigniss seines Lebens bezeich-
nete — ein deus ex machina kann doch
nicht das Schicksal einer Persönlichkeit be-
stimmen. Lange bevor Courbet auftauchte,
hatte Leibi in ähnlichem Sinne gemalt,
Seine Bilder der Sechzigerjahre — das Por-
trät eines Schauspielers, der seine Rolle
recitirt, das Porträt eines Blinden, eine
Atelierscene und das Porträt der Frau Gedon
— sind die besten »morceaux«, die damals
ein Münchener lieferte: von tiefem, schönem
Ton und breitem, energischem Strich. Und
nachdem er Courbet verlassen hatte, schlug
er andere Bahnen ein. Aus dem Breitmaler