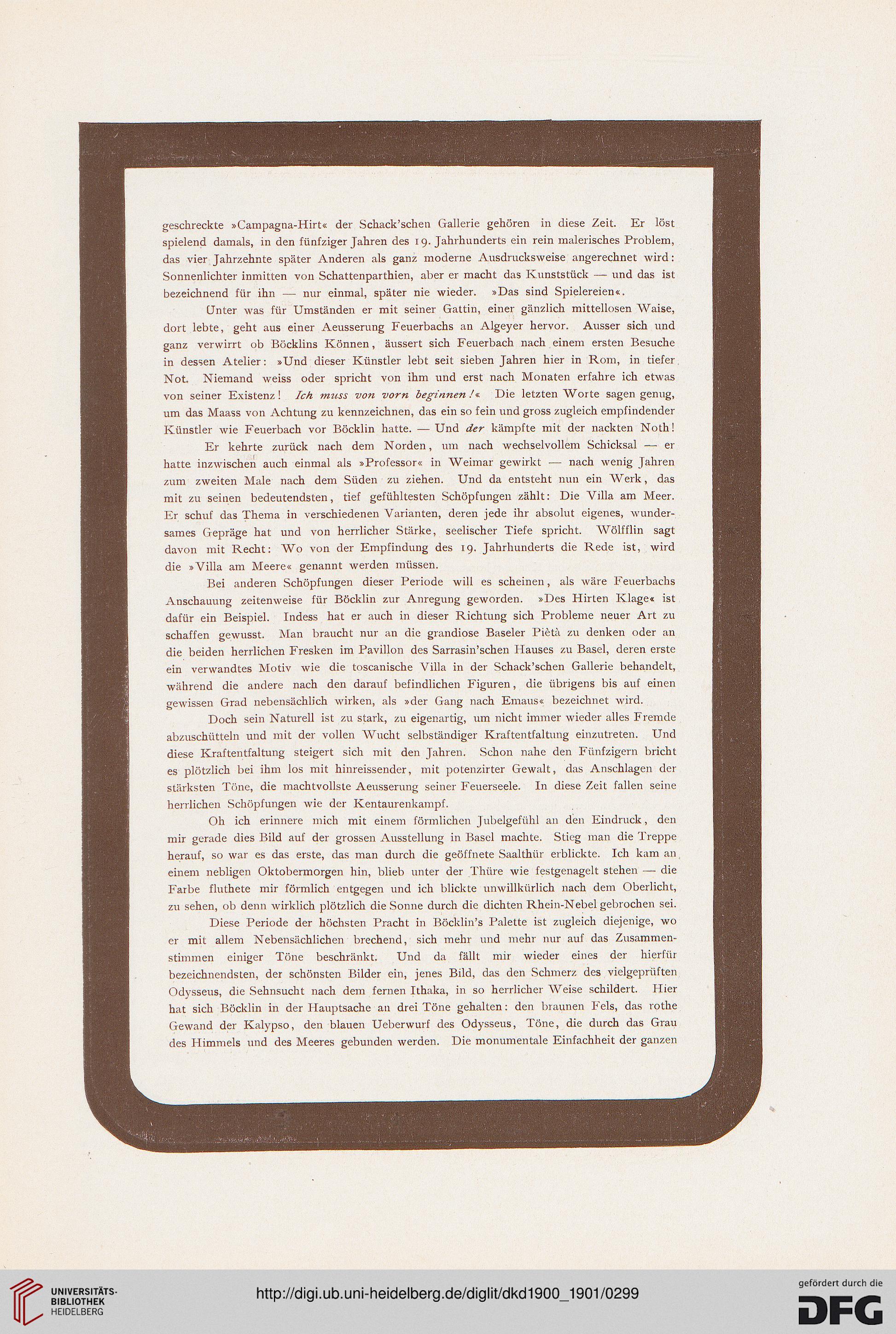geschreckte »Campagna-Hirt« der Schack'schen Gallerie gehören in diese Zeit. Er löst
spielend damals, in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein rein malerisches Problem,
das vier Jahrzehnte später Anderen als ganz moderne Ausdrucksweise angerechnet wird:
Sonnenlichter inmitten von Schattenparthien, aber er macht das Kunststück — und das ist
bezeichnend für ihn — nur einmal, später nie wieder. »Das sind Spielereien«.
Unter was für Umständen er mit seiner Gattin, einer gänzlich mittellosen Waise,
dort lebte, geht aus einer Aeusserung Feuerbachs an Algeyer hervor. Ausser sich und
ganz verwirrt ob Böcklins Können, äussert sich Feuerbach nach einem ersten Besuche
in dessen Atelier: »Und dieser Künstler lebt seit sieben Jahren hier in Rom, in tiefer
Not. Niemand weiss oder spricht von ihm und erst nach Monaten erfahre ich etwas
von seiner Existenz ! Ich nwiss von vorn beginnen /« Die letzten Worte sagen genug,
um das Maass von Achtung zu kennzeichnen, das ein so fein und gross zugleich empfindender
Künstler wie Feuerbach vor Böcklin hatte. — Und der kämpfte mit der nackten Noth!
Er kehrte zurück nach dem Norden, um nach wechselvollem Schicksal — er
hatte inzwischen auch einmal als »Professor« in Weimar gewirkt — nach wenig Jahren
zum zweiten Male nach dem Süden zu ziehen. Und da entsteht nun ein Werk, das
mit zu seinen bedeutendsten, tief gefühltesten Schöpfungen zählt: Die Villa am Meer.
Er schuf das Thema in verschiedenen Varianten, deren jede ihr absolut eigenes, wunder-
sames Gepräge hat und von herrlicher Stärke, seelischer Tiefe spricht. Wölfflin sagt
davon mit Recht: Wo von der Empfindung des 19. Jahrhunderts die Rede ist, wird
die »Villa am Meere« genannt werden müssen.
Bei anderen Schöpfungen dieser Periode will es scheinen, als wäre Feuerbachs
Anschauung zeitenweise für Böcklin zur Anregung geworden. »Des Hirten Klage« ist
dafür ein Beispiel. Indess hat er auch in dieser Richtung sich Probleme neuer Art zu
schaffen gewusst. Man braucht nur an die grandiose Baseler Pietä zu denken oder an
die beiden herrlichen Fresken im Pavillon des Sarrasin'schen Hauses zu Basel, deren erste
ein verwandtes Motiv wie die toscanische Villa in der Schack'schen Gallerie behandelt,
während die andere nach den darauf befindlichen Figuren, die übrigens bis auf einen
gewissen Grad nebensächlich wirken, als »der Gang nach Emaus« bezeichnet wird.
Doch sein Naturell ist zu stark, zu eigenartig, um nicht immer wieder alles Fremde
abzuschütteln und mit der vollen Wucht selbständiger Kraftentfaltung einzutreten. Und
diese Kraftentfaltung steigert sich mit den Jahren. Schon nahe den Fünfzigern bricht
es plötzlich bei ihm los mit hinreissender, mit potenzirter Gewalt, das Anschlagen der
stärksten Töne, die machtvollste Aeusserung seiner Feuerseele. In diese Zeit fallen seine
henlichen Schöpfungen wie der Kentaurenkampf.
Oh ich erinnere mich mit einem förmlichen Jubelgefühl an den Eindruck, den
mir gerade dies Bild auf der grossen Ausstellung in Basel machte. Stieg man die Treppe
herauf, so war es das erste, das man durch die geöffnete Saalthür erblickte. Ich kam an
einem nebligen Oktobermorgen hin, blieb unter der Thüre wie festgenagelt stehen — die
Farbe fluthete mir förmlich entgegen und ich blickte unwillkürlich nach dem Oberlicht,
zu sehen, ob denn wirklich plötzlich die Sonne durch die dichten Rhein-Nebel gebrochen sei.
Diese Periode der höchsten Pracht in Böcklin's Palette ist zugleich diejenige, wo
er mit allem Nebensächlichen brechend, sich mehr und mehr nur auf das Zusammen-
stimmen einiger Töne beschränkt. Und da fällt mir wieder eines der hierfür
bezeichnendsten, der schönsten Bilder ein, jenes Bild, das den Schmerz des vielgeprüften
Odysseus, die Sehnsucht nach dem fernen Ithaka, in so herrlicher Weise schildert. Hier
hat sich Böcklin in der Hauptsache au drei Töne gehalten: den braunen Fels, das rothe
Gewand der Kalypso, den blauen Ueberwurf des Odysseus, Töne, die durch das Grau
des Himmels und des Meeres gebunden werden. Die monumentale Einfachheit der ganzen
spielend damals, in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein rein malerisches Problem,
das vier Jahrzehnte später Anderen als ganz moderne Ausdrucksweise angerechnet wird:
Sonnenlichter inmitten von Schattenparthien, aber er macht das Kunststück — und das ist
bezeichnend für ihn — nur einmal, später nie wieder. »Das sind Spielereien«.
Unter was für Umständen er mit seiner Gattin, einer gänzlich mittellosen Waise,
dort lebte, geht aus einer Aeusserung Feuerbachs an Algeyer hervor. Ausser sich und
ganz verwirrt ob Böcklins Können, äussert sich Feuerbach nach einem ersten Besuche
in dessen Atelier: »Und dieser Künstler lebt seit sieben Jahren hier in Rom, in tiefer
Not. Niemand weiss oder spricht von ihm und erst nach Monaten erfahre ich etwas
von seiner Existenz ! Ich nwiss von vorn beginnen /« Die letzten Worte sagen genug,
um das Maass von Achtung zu kennzeichnen, das ein so fein und gross zugleich empfindender
Künstler wie Feuerbach vor Böcklin hatte. — Und der kämpfte mit der nackten Noth!
Er kehrte zurück nach dem Norden, um nach wechselvollem Schicksal — er
hatte inzwischen auch einmal als »Professor« in Weimar gewirkt — nach wenig Jahren
zum zweiten Male nach dem Süden zu ziehen. Und da entsteht nun ein Werk, das
mit zu seinen bedeutendsten, tief gefühltesten Schöpfungen zählt: Die Villa am Meer.
Er schuf das Thema in verschiedenen Varianten, deren jede ihr absolut eigenes, wunder-
sames Gepräge hat und von herrlicher Stärke, seelischer Tiefe spricht. Wölfflin sagt
davon mit Recht: Wo von der Empfindung des 19. Jahrhunderts die Rede ist, wird
die »Villa am Meere« genannt werden müssen.
Bei anderen Schöpfungen dieser Periode will es scheinen, als wäre Feuerbachs
Anschauung zeitenweise für Böcklin zur Anregung geworden. »Des Hirten Klage« ist
dafür ein Beispiel. Indess hat er auch in dieser Richtung sich Probleme neuer Art zu
schaffen gewusst. Man braucht nur an die grandiose Baseler Pietä zu denken oder an
die beiden herrlichen Fresken im Pavillon des Sarrasin'schen Hauses zu Basel, deren erste
ein verwandtes Motiv wie die toscanische Villa in der Schack'schen Gallerie behandelt,
während die andere nach den darauf befindlichen Figuren, die übrigens bis auf einen
gewissen Grad nebensächlich wirken, als »der Gang nach Emaus« bezeichnet wird.
Doch sein Naturell ist zu stark, zu eigenartig, um nicht immer wieder alles Fremde
abzuschütteln und mit der vollen Wucht selbständiger Kraftentfaltung einzutreten. Und
diese Kraftentfaltung steigert sich mit den Jahren. Schon nahe den Fünfzigern bricht
es plötzlich bei ihm los mit hinreissender, mit potenzirter Gewalt, das Anschlagen der
stärksten Töne, die machtvollste Aeusserung seiner Feuerseele. In diese Zeit fallen seine
henlichen Schöpfungen wie der Kentaurenkampf.
Oh ich erinnere mich mit einem förmlichen Jubelgefühl an den Eindruck, den
mir gerade dies Bild auf der grossen Ausstellung in Basel machte. Stieg man die Treppe
herauf, so war es das erste, das man durch die geöffnete Saalthür erblickte. Ich kam an
einem nebligen Oktobermorgen hin, blieb unter der Thüre wie festgenagelt stehen — die
Farbe fluthete mir förmlich entgegen und ich blickte unwillkürlich nach dem Oberlicht,
zu sehen, ob denn wirklich plötzlich die Sonne durch die dichten Rhein-Nebel gebrochen sei.
Diese Periode der höchsten Pracht in Böcklin's Palette ist zugleich diejenige, wo
er mit allem Nebensächlichen brechend, sich mehr und mehr nur auf das Zusammen-
stimmen einiger Töne beschränkt. Und da fällt mir wieder eines der hierfür
bezeichnendsten, der schönsten Bilder ein, jenes Bild, das den Schmerz des vielgeprüften
Odysseus, die Sehnsucht nach dem fernen Ithaka, in so herrlicher Weise schildert. Hier
hat sich Böcklin in der Hauptsache au drei Töne gehalten: den braunen Fels, das rothe
Gewand der Kalypso, den blauen Ueberwurf des Odysseus, Töne, die durch das Grau
des Himmels und des Meeres gebunden werden. Die monumentale Einfachheit der ganzen