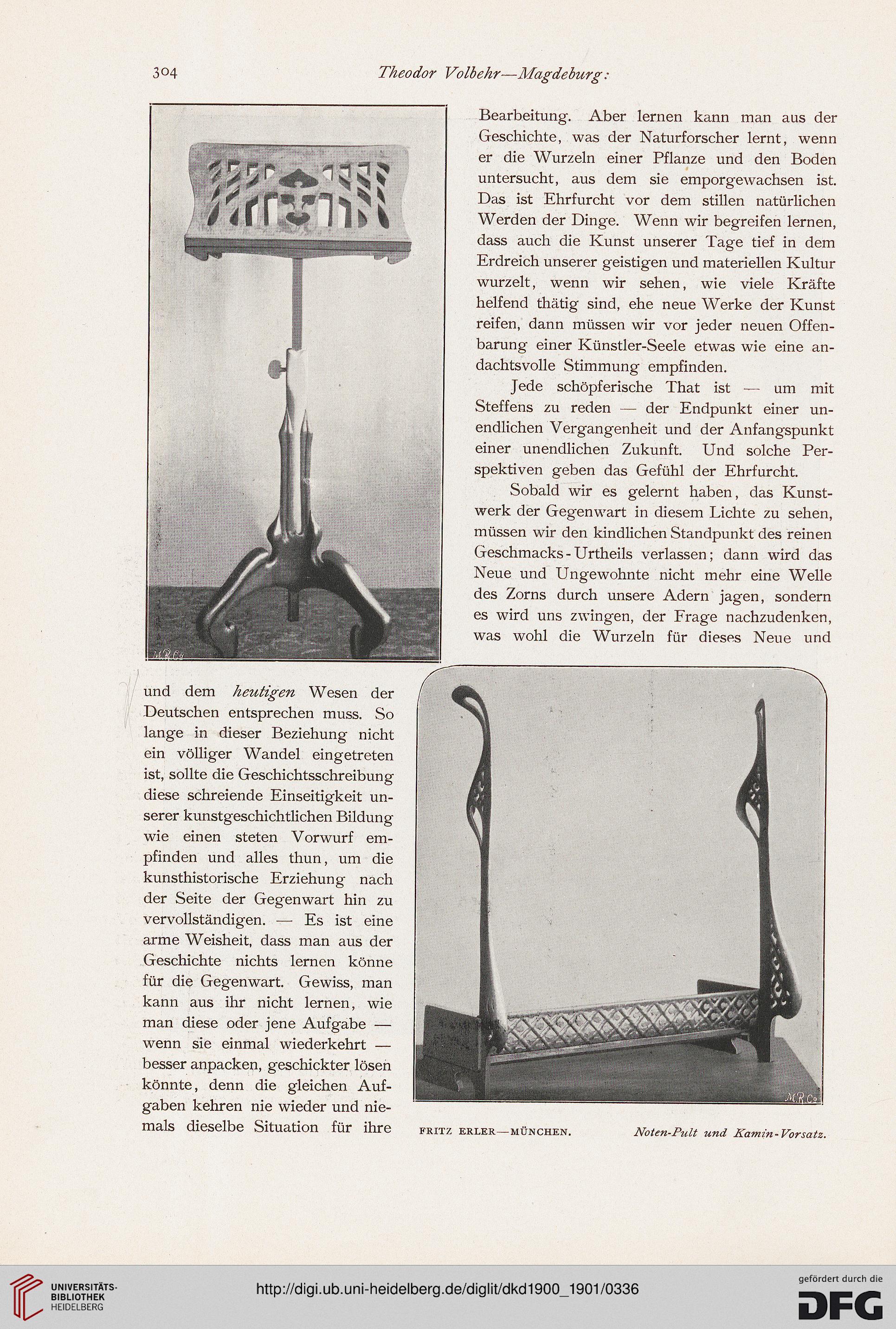304
Theodor Volbehr—Magdeburg:
und dem heutigen Wesen der
Deutschen entsprechen muss. So
lange in dieser Beziehung nicht
ein völliger Wandel eingetreten
ist, sollte die Geschichtsschreibung
diese schreiende Einseitigkeit un-
serer kunstgeschichtlichen Bildung
wie einen steten Vorwurf em-
pfinden und alles thun, um die
kunsthistorische Erziehung nach
der Seite der Gegenwart hin zu
vervollständigen. — Es ist eine
arme Weisheit, dass man aus der
Geschichte nichts lernen könne
für die Gegenwart. Gewiss, man
kann aus ihr nicht lernen, wie
man diese oder jene Aufgabe —
wenn sie einmal wiederkehrt —
besser anpacken, geschickter lösen
könnte, denn die gleichen Auf-
gaben kehren nie wieder und nie-
mals dieselbe Situation für ihre
Bearbeitung. Aber lernen kann man aus der
Geschichte, was der Naturforscher lernt, wenn
er die Wurzeln einer Pflanze und den Boden
untersucht, aus dem sie emporgewachsen ist.
Das ist Ehrfurcht vor dem stillen natürlichen
Werden der Dinge. Wenn wir begreifen lernen,
dass auch die Kunst unserer Tage tief in dem
Erdreich unserer geistigen und materiellen Kultur
wurzelt, wenn wir sehen, wie viele Kräfte
helfend thätig sind, ehe neue Werke der Kunst
reifen, dann müssen wir vor jeder neuen Offen-
barung einer Künstler-Seele etwas wie eine an-
dachtsvolle Stimmung empfinden.
Jede schöpferische That ist — um mit
Steffens zu reden — der Endpunkt einer un-
endlichen Vergangenheit und der Anfangspunkt
einer unendlichen Zukunft. Und solche Per-
spektiven geben das Gefühl der Ehrfurcht.
Sobald wir es gelernt haben, das Kunst-
werk der Gegenwart in diesem Lichte zu sehen,
müssen wir den kindlichen Standpunkt des reinen
Geschmacks - Urtheils verlassen; dann wird das
Neue und Ungewohnte nicht mehr eine Welle
des Zorns durch unsere Adern jagen, sondern
es wird uns zwingen, der Frage nachzudenken,
was wohl die Wurzeln für dieses Neue und
FRITZ ERLER—MÜNCHEN.
Noten-Pult und Kamin-Vorsatz.
Theodor Volbehr—Magdeburg:
und dem heutigen Wesen der
Deutschen entsprechen muss. So
lange in dieser Beziehung nicht
ein völliger Wandel eingetreten
ist, sollte die Geschichtsschreibung
diese schreiende Einseitigkeit un-
serer kunstgeschichtlichen Bildung
wie einen steten Vorwurf em-
pfinden und alles thun, um die
kunsthistorische Erziehung nach
der Seite der Gegenwart hin zu
vervollständigen. — Es ist eine
arme Weisheit, dass man aus der
Geschichte nichts lernen könne
für die Gegenwart. Gewiss, man
kann aus ihr nicht lernen, wie
man diese oder jene Aufgabe —
wenn sie einmal wiederkehrt —
besser anpacken, geschickter lösen
könnte, denn die gleichen Auf-
gaben kehren nie wieder und nie-
mals dieselbe Situation für ihre
Bearbeitung. Aber lernen kann man aus der
Geschichte, was der Naturforscher lernt, wenn
er die Wurzeln einer Pflanze und den Boden
untersucht, aus dem sie emporgewachsen ist.
Das ist Ehrfurcht vor dem stillen natürlichen
Werden der Dinge. Wenn wir begreifen lernen,
dass auch die Kunst unserer Tage tief in dem
Erdreich unserer geistigen und materiellen Kultur
wurzelt, wenn wir sehen, wie viele Kräfte
helfend thätig sind, ehe neue Werke der Kunst
reifen, dann müssen wir vor jeder neuen Offen-
barung einer Künstler-Seele etwas wie eine an-
dachtsvolle Stimmung empfinden.
Jede schöpferische That ist — um mit
Steffens zu reden — der Endpunkt einer un-
endlichen Vergangenheit und der Anfangspunkt
einer unendlichen Zukunft. Und solche Per-
spektiven geben das Gefühl der Ehrfurcht.
Sobald wir es gelernt haben, das Kunst-
werk der Gegenwart in diesem Lichte zu sehen,
müssen wir den kindlichen Standpunkt des reinen
Geschmacks - Urtheils verlassen; dann wird das
Neue und Ungewohnte nicht mehr eine Welle
des Zorns durch unsere Adern jagen, sondern
es wird uns zwingen, der Frage nachzudenken,
was wohl die Wurzeln für dieses Neue und
FRITZ ERLER—MÜNCHEN.
Noten-Pult und Kamin-Vorsatz.