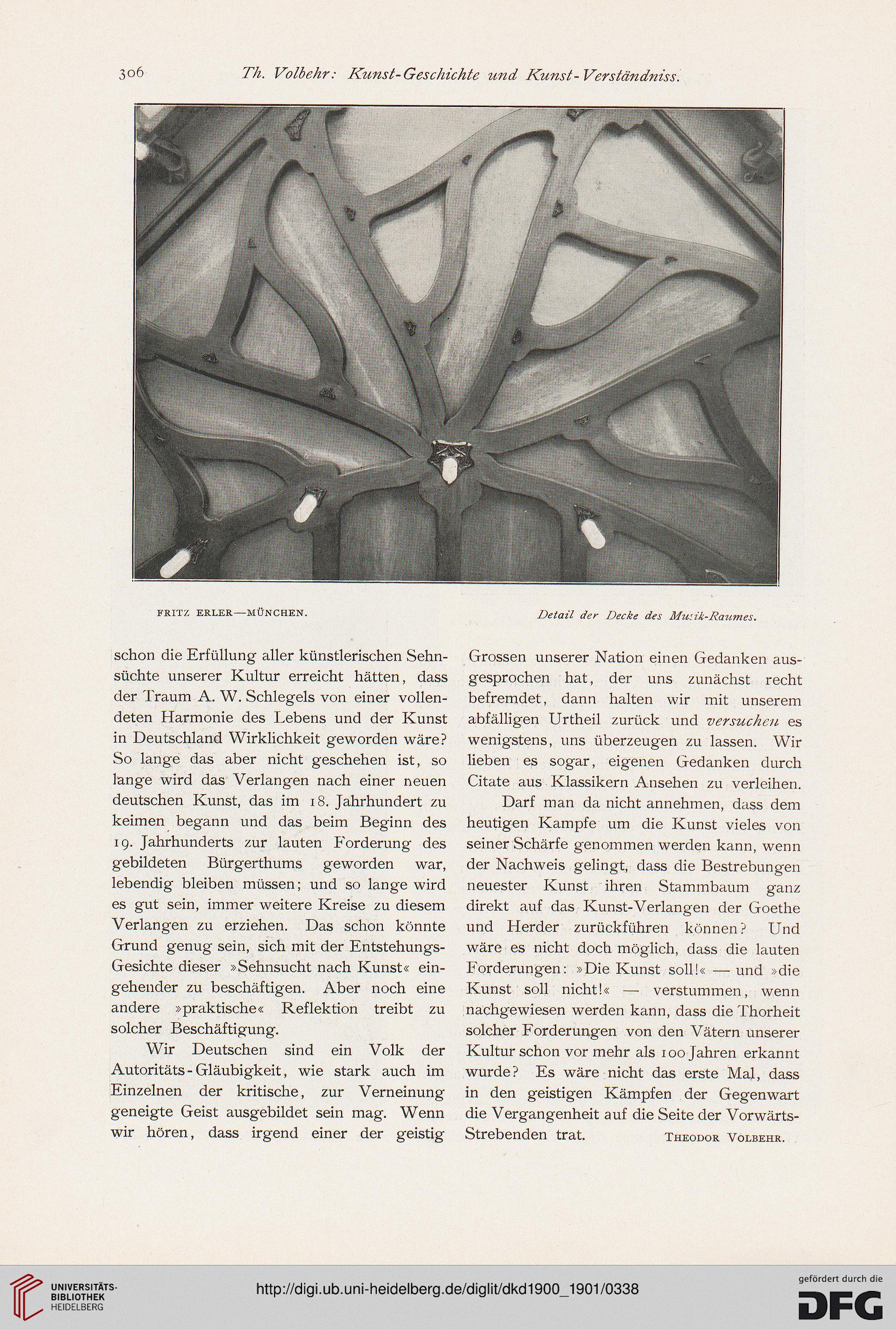3o6
Th. Volbehr: Kunst-Geschichte und Kunst-Verständniss.
fritz erler—münchen.
Detail der Decke des Muni-Raumes.
schon die Erfüllung aller künstlerischen Sehn-
süchte unserer Kultur erreicht hätten, dass
der Traum A. W. Schlegels von einer vollen-
deten Harmonie des Lebens und der Kunst
in Deutschland Wirklichkeit geworden wäre?
So lange das aber nicht geschehen ist, so
lange wird das Verlangen nach einer neuen
deutschen Kunst, das im 18. Jahrhundert zu
keimen begann und das beim Beginn des
19. Jahrhunderts zur lauten Forderung des
gebildeten Bürgerthums geworden war,
lebendig bleiben müssen; und so lange wird
es gut sein, immer weitere Kreise zu diesem
Verlangen zu erziehen. Das schon könnte
Grund genug sein, sich mit der Entstehungs-
Gesichte dieser »Sehnsucht nach Kunst« ein-
gehender zu beschäftigen. Aber noch eine
andere »praktische« Reflektion treibt zu
solcher Beschäftigung.
Wir Deutschen sind ein Volk der
Autoritäts - Gläubigkeit, wie stark auch im
Einzelnen der kritische, zur Verneinung
geneigte Geist ausgebildet sein mag. Wenn
wir hören, dass irgend einer der geistig
Grossen unserer Nation einen Gedanken aus-
gesprochen hat, der uns zunächst recht
befremdet, dann halten wir mit unserem
abfälligen Urtheil zurück und versuchen es
wenigstens, uns überzeugen zu lassen. Wir
lieben es sogar, eigenen Gedanken durch
Citate aus Klassikern Ansehen zu verleihen.
Darf man da nicht annehmen, dass dem
heutigen Kampfe um die Kunst vieles von
seiner Schärfe genommen werden kann, wenn
der Nachweis gelingt, dass die Bestrebungen
neuester Kunst ihren Stammbaum ganz
direkt auf das Kunst-Verlangen der Goethe
und Herder zurückführen können? Und
wäre es nicht doch möglich, dass die lauten
Forderungen: »Die Kunst soll!« — und »die
Kunst soll nicht!« — verstummen, wenn
nachgewiesen werden kann, dass die Thorheit
solcher Forderungen von den Vätern unserer
Kultur schon vor mehr als 100 Jahren erkannt
wurde? Es wäre nicht das erste Mal, dass
in den geistigen Kämpfen der Gegenwart
die Vergangenheit auf die Seite der Vorwärts-
Strebenden trat. Theodor Volbehr.
Th. Volbehr: Kunst-Geschichte und Kunst-Verständniss.
fritz erler—münchen.
Detail der Decke des Muni-Raumes.
schon die Erfüllung aller künstlerischen Sehn-
süchte unserer Kultur erreicht hätten, dass
der Traum A. W. Schlegels von einer vollen-
deten Harmonie des Lebens und der Kunst
in Deutschland Wirklichkeit geworden wäre?
So lange das aber nicht geschehen ist, so
lange wird das Verlangen nach einer neuen
deutschen Kunst, das im 18. Jahrhundert zu
keimen begann und das beim Beginn des
19. Jahrhunderts zur lauten Forderung des
gebildeten Bürgerthums geworden war,
lebendig bleiben müssen; und so lange wird
es gut sein, immer weitere Kreise zu diesem
Verlangen zu erziehen. Das schon könnte
Grund genug sein, sich mit der Entstehungs-
Gesichte dieser »Sehnsucht nach Kunst« ein-
gehender zu beschäftigen. Aber noch eine
andere »praktische« Reflektion treibt zu
solcher Beschäftigung.
Wir Deutschen sind ein Volk der
Autoritäts - Gläubigkeit, wie stark auch im
Einzelnen der kritische, zur Verneinung
geneigte Geist ausgebildet sein mag. Wenn
wir hören, dass irgend einer der geistig
Grossen unserer Nation einen Gedanken aus-
gesprochen hat, der uns zunächst recht
befremdet, dann halten wir mit unserem
abfälligen Urtheil zurück und versuchen es
wenigstens, uns überzeugen zu lassen. Wir
lieben es sogar, eigenen Gedanken durch
Citate aus Klassikern Ansehen zu verleihen.
Darf man da nicht annehmen, dass dem
heutigen Kampfe um die Kunst vieles von
seiner Schärfe genommen werden kann, wenn
der Nachweis gelingt, dass die Bestrebungen
neuester Kunst ihren Stammbaum ganz
direkt auf das Kunst-Verlangen der Goethe
und Herder zurückführen können? Und
wäre es nicht doch möglich, dass die lauten
Forderungen: »Die Kunst soll!« — und »die
Kunst soll nicht!« — verstummen, wenn
nachgewiesen werden kann, dass die Thorheit
solcher Forderungen von den Vätern unserer
Kultur schon vor mehr als 100 Jahren erkannt
wurde? Es wäre nicht das erste Mal, dass
in den geistigen Kämpfen der Gegenwart
die Vergangenheit auf die Seite der Vorwärts-
Strebenden trat. Theodor Volbehr.