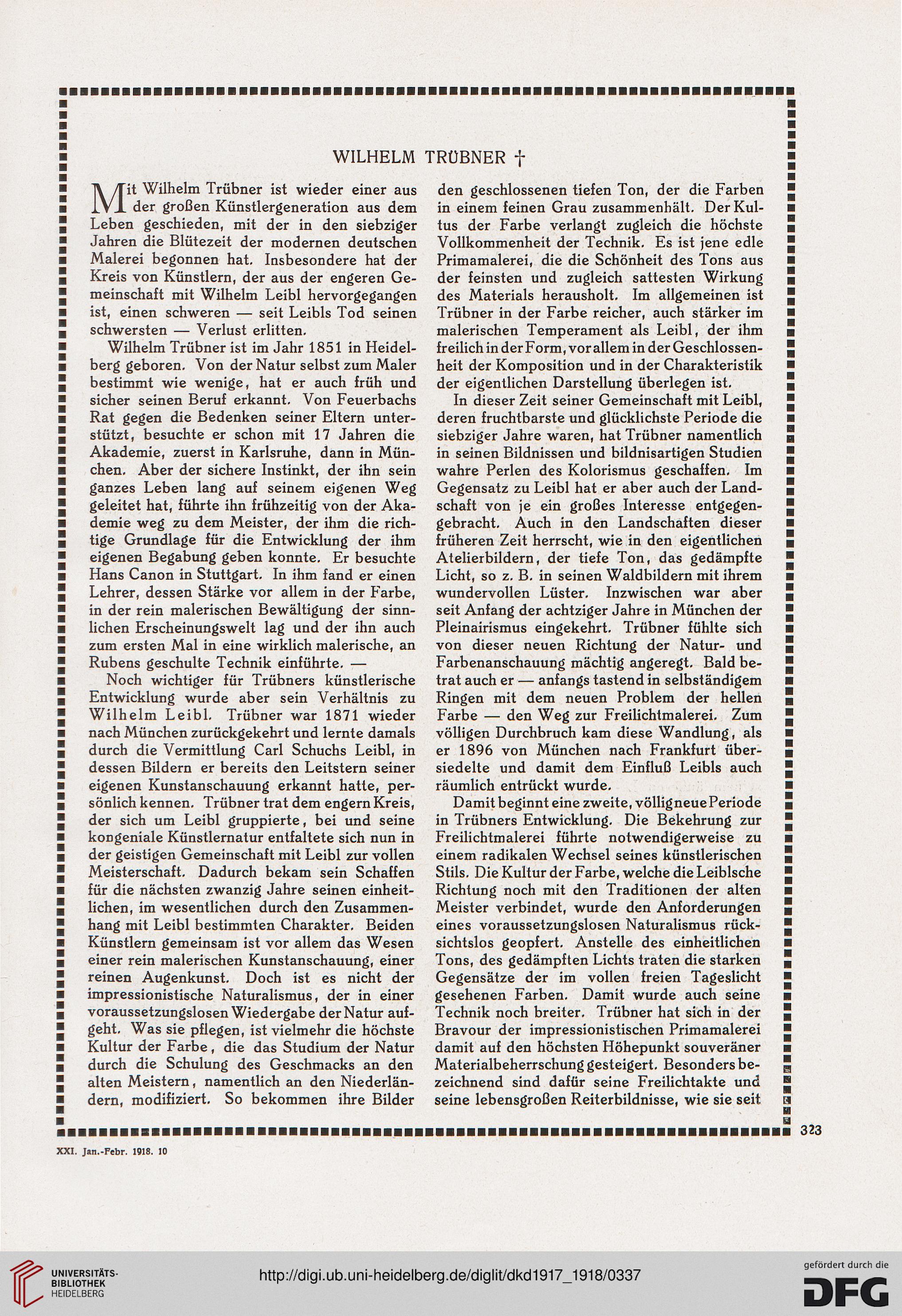WILHELM TRÜBNER f
Mit Wilhelm Trübner ist wieder einer aus
der großen Künstlergeneration aus dem
Leben geschieden, mit der in den siebziger
Jahren die Blütezeit der modernen deutschen
Malerei begonnen hat. Insbesondere hat der
Kreis von Künstlern, der aus der engeren Ge-
meinschaft mit Wilhelm Leibi hervorgegangen
ist, einen schweren — seit Leibis Tod seinen
schwersten — Verlust erlitten.
Wilhelm Trübner ist im Jahr 1851 in Heidel-
berg geboren. Von der Natur selbst zum Maler
bestimmt wie wenige, hat er auch früh und
sicher seinen Beruf erkannt. Von Feuerbachs
Rat gegen die Bedenken seiner Eltern unter-
stützt, besuchte er schon mit 17 Jahren die
Akademie, zuerst in Karlsruhe, dann in Mün-
chen. Aber der sichere Instinkt, der ihn sein
ganzes Leben lang auf seinem eigenen Weg
geleitet hat, führte ihn frühzeitig von der Aka-
demie weg zu dem Meister, der ihm die rich-
tige Grundlage für die Entwicklung der ihm
eigenen Begabung geben konnte. Er besuchte
Hans Canon in Stuttgart. In ihm fand er einen
Lehrer, dessen Stärke vor allem in der Farbe,
in der rein malerischen Bewältigung der sinn-
lichen Erscheinungswelt lag und der ihn auch
zum ersten Mal in eine wirklich malerische, an
Rubens geschulte Technik einführte. —
Noch wichtiger für Trübners künstlerische
Entwicklung wurde aber sein Verhältnis zu
Wilhelm Leibi. Trübner war 1871 wieder
nach München zurückgekehrt und lernte damals
durch die Vermittlung Carl Schuchs Leibi, in
dessen Bildern er bereits den Leitstern seiner
eigenen Kunstanschauung erkannt hatte, per-
sönlich kennen. Trübner trat dem engern Kreis,
der sich um Leibi gruppierte, bei und seine
kongeniale Künstlernatur entfaltete sich nun in
der geistigen Gemeinschaft mit Leibi zur vollen
Meisterschaft. Dadurch bekam sein Schaffen
für die nächsten zwanzig Jahre seinen einheit-
lichen, im wesentlichen durch den Zusammen-
hang mit Leibi bestimmten Charakter. Beiden
Künstlern gemeinsam ist vor allem das Wesen
einer rein malerischen Kunstanschauung, einer
reinen Augenkunst. Doch ist es nicht der
impressionistische Naturalismus, der in einer
voraussetzungslosen Wiedergabe der Natur auf-
geht. Was sie pflegen, ist vielmehr die höchste
Kultur der Farbe, die das Studium der Natur
durch die Schulung des Geschmacks an den
alten Meistern, namentlich an den Niederlän-
dern, modifiziert. So bekommen ihre Bilder
den geschlossenen tiefen Ton, der die Farben
in einem feinen Grau zusammenhält. Der Kul-
tus der Farbe verlangt zugleich die höchste
Vollkommenheit der Technik. Es ist jene edle
Primamalerei, die die Schönheit des Tons aus
der feinsten und zugleich sattesten Wirkung
des Materials herausholt. Im allgemeinen ist
Trübner in der Farbe reicher, auch stärker im
malerischen Temperament als Leibi, der ihm
freilich in der Form, vor allem in der Geschlossen-
heit der Komposition und in der Charakteristik
der eigentlichen Darstellung überlegen ist.
In dieser Zeit seiner Gemeinschaft mit Leibi,
deren fruchtbarste und glücklichste Periode die
siebziger Jahre waren, hat Trübner namentlich
in seinen Bildnissen und bildnisartigen Studien
wahre Perlen des Kolorismus geschaffen. Im
Gegensatz zu Leibi hat er aber auch der Land-
schaft von je ein großes Interesse entgegen-
gebracht. Auch in den Landschaften dieser
früheren Zeit herrscht, wie in den eigentlichen
Atelierbildern, der tiefe Ton, das gedämpfte
Licht, so z. B. in seinen Waldbildern mit ihrem
wundervollen Lüster. Inzwischen war aber
seit Anfang der achtziger Jahre in München der
Pleinairismus eingekehrt. Trübner fühlte sich
von dieser neuen Richtung der Natur- und
Farbenanschauung mächtig angeregt. Bald be-
trat auch er — anfangs tastend in selbständigem
Ringen mit dem neuen Problem der hellen
Farbe — den Weg zur Freilichtmalerei. Zum
völligen Durchbruch kam diese Wandlung, als
er 1896 von München nach Frankfurt über-
siedelte und damit dem Einfluß Leibis auch
räumlich entrückt wurde.
Damit beginnt eine zweite, völligneuePeriode
in Trübners Entwicklung. Die Bekehrung zur
Freilichtmalerei führte notwendigerweise zu
einem radikalen Wechsel seines künstlerischen
Stils. Die Kultur der Farbe, welche die Leibische
Richtung noch mit den Traditionen der alten
Meister verbindet, wurde den Anforderungen
eines voraussetzungslosen Naturalismus rück-
sichtslos geopfert. Anstelle des einheitlichen
Tons, des gedämpften Lichts traten die starken
Gegensätze der im vollen freien Tageslicht
gesehenen Farben. Damit wurde auch seine
Technik noch breiter. Trübner hat sich in der
Bravour der impressionistischen Primamalerei
damit auf den höchsten Höhepunkt souveräner
Materialbeherrschung gesteigert. Besonders be-
zeichnend sind dafür seine Freilichtakte und
seine lebensgroßen Reiterbildnisse, wie sie seit
XXI. Jan.-Febr. 1918. 10
Mit Wilhelm Trübner ist wieder einer aus
der großen Künstlergeneration aus dem
Leben geschieden, mit der in den siebziger
Jahren die Blütezeit der modernen deutschen
Malerei begonnen hat. Insbesondere hat der
Kreis von Künstlern, der aus der engeren Ge-
meinschaft mit Wilhelm Leibi hervorgegangen
ist, einen schweren — seit Leibis Tod seinen
schwersten — Verlust erlitten.
Wilhelm Trübner ist im Jahr 1851 in Heidel-
berg geboren. Von der Natur selbst zum Maler
bestimmt wie wenige, hat er auch früh und
sicher seinen Beruf erkannt. Von Feuerbachs
Rat gegen die Bedenken seiner Eltern unter-
stützt, besuchte er schon mit 17 Jahren die
Akademie, zuerst in Karlsruhe, dann in Mün-
chen. Aber der sichere Instinkt, der ihn sein
ganzes Leben lang auf seinem eigenen Weg
geleitet hat, führte ihn frühzeitig von der Aka-
demie weg zu dem Meister, der ihm die rich-
tige Grundlage für die Entwicklung der ihm
eigenen Begabung geben konnte. Er besuchte
Hans Canon in Stuttgart. In ihm fand er einen
Lehrer, dessen Stärke vor allem in der Farbe,
in der rein malerischen Bewältigung der sinn-
lichen Erscheinungswelt lag und der ihn auch
zum ersten Mal in eine wirklich malerische, an
Rubens geschulte Technik einführte. —
Noch wichtiger für Trübners künstlerische
Entwicklung wurde aber sein Verhältnis zu
Wilhelm Leibi. Trübner war 1871 wieder
nach München zurückgekehrt und lernte damals
durch die Vermittlung Carl Schuchs Leibi, in
dessen Bildern er bereits den Leitstern seiner
eigenen Kunstanschauung erkannt hatte, per-
sönlich kennen. Trübner trat dem engern Kreis,
der sich um Leibi gruppierte, bei und seine
kongeniale Künstlernatur entfaltete sich nun in
der geistigen Gemeinschaft mit Leibi zur vollen
Meisterschaft. Dadurch bekam sein Schaffen
für die nächsten zwanzig Jahre seinen einheit-
lichen, im wesentlichen durch den Zusammen-
hang mit Leibi bestimmten Charakter. Beiden
Künstlern gemeinsam ist vor allem das Wesen
einer rein malerischen Kunstanschauung, einer
reinen Augenkunst. Doch ist es nicht der
impressionistische Naturalismus, der in einer
voraussetzungslosen Wiedergabe der Natur auf-
geht. Was sie pflegen, ist vielmehr die höchste
Kultur der Farbe, die das Studium der Natur
durch die Schulung des Geschmacks an den
alten Meistern, namentlich an den Niederlän-
dern, modifiziert. So bekommen ihre Bilder
den geschlossenen tiefen Ton, der die Farben
in einem feinen Grau zusammenhält. Der Kul-
tus der Farbe verlangt zugleich die höchste
Vollkommenheit der Technik. Es ist jene edle
Primamalerei, die die Schönheit des Tons aus
der feinsten und zugleich sattesten Wirkung
des Materials herausholt. Im allgemeinen ist
Trübner in der Farbe reicher, auch stärker im
malerischen Temperament als Leibi, der ihm
freilich in der Form, vor allem in der Geschlossen-
heit der Komposition und in der Charakteristik
der eigentlichen Darstellung überlegen ist.
In dieser Zeit seiner Gemeinschaft mit Leibi,
deren fruchtbarste und glücklichste Periode die
siebziger Jahre waren, hat Trübner namentlich
in seinen Bildnissen und bildnisartigen Studien
wahre Perlen des Kolorismus geschaffen. Im
Gegensatz zu Leibi hat er aber auch der Land-
schaft von je ein großes Interesse entgegen-
gebracht. Auch in den Landschaften dieser
früheren Zeit herrscht, wie in den eigentlichen
Atelierbildern, der tiefe Ton, das gedämpfte
Licht, so z. B. in seinen Waldbildern mit ihrem
wundervollen Lüster. Inzwischen war aber
seit Anfang der achtziger Jahre in München der
Pleinairismus eingekehrt. Trübner fühlte sich
von dieser neuen Richtung der Natur- und
Farbenanschauung mächtig angeregt. Bald be-
trat auch er — anfangs tastend in selbständigem
Ringen mit dem neuen Problem der hellen
Farbe — den Weg zur Freilichtmalerei. Zum
völligen Durchbruch kam diese Wandlung, als
er 1896 von München nach Frankfurt über-
siedelte und damit dem Einfluß Leibis auch
räumlich entrückt wurde.
Damit beginnt eine zweite, völligneuePeriode
in Trübners Entwicklung. Die Bekehrung zur
Freilichtmalerei führte notwendigerweise zu
einem radikalen Wechsel seines künstlerischen
Stils. Die Kultur der Farbe, welche die Leibische
Richtung noch mit den Traditionen der alten
Meister verbindet, wurde den Anforderungen
eines voraussetzungslosen Naturalismus rück-
sichtslos geopfert. Anstelle des einheitlichen
Tons, des gedämpften Lichts traten die starken
Gegensätze der im vollen freien Tageslicht
gesehenen Farben. Damit wurde auch seine
Technik noch breiter. Trübner hat sich in der
Bravour der impressionistischen Primamalerei
damit auf den höchsten Höhepunkt souveräner
Materialbeherrschung gesteigert. Besonders be-
zeichnend sind dafür seine Freilichtakte und
seine lebensgroßen Reiterbildnisse, wie sie seit
XXI. Jan.-Febr. 1918. 10