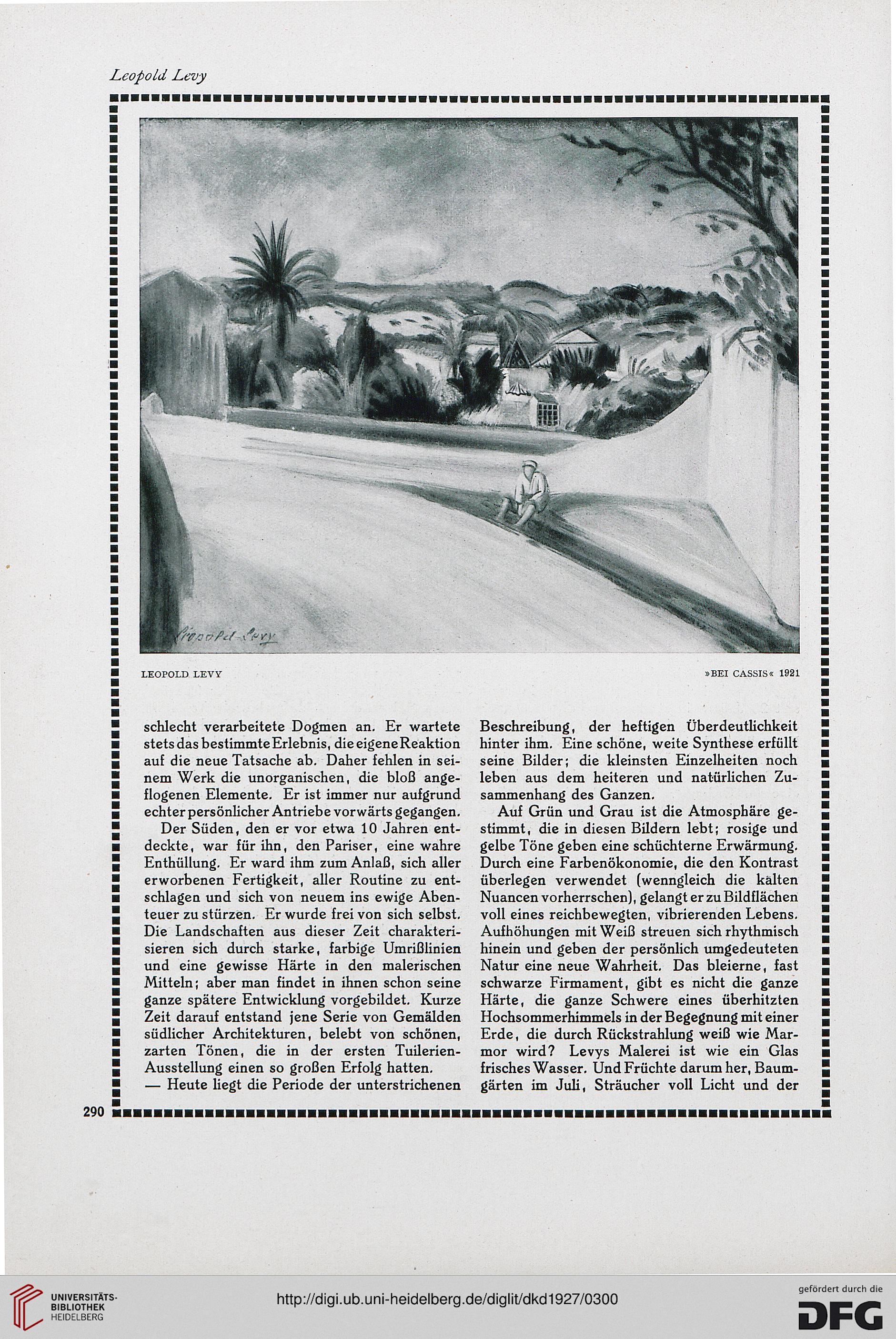Leopold Lcvy
LEOPOLD LEW
»BEI CASSIS« 1921
schlecht verarbeitete Dogmen an. Er wartete
stets das bestimmte Erlebnis, die eigene Reaktio n
auf die neue Tatsache ab. Daher fehlen in sei-
nem Werk die unorganischen, die bloß ange-
flogenen Elemente. Er ist immer nur aufgrund
echter persönlicher Antriebe vorwärts gegangen.
Der Süden, den er vor etwa 10 Jahren ent-
deckte, war für ihn, den Pariser, eine wahre
Enthüllung. Er ward ihm zum Anlaß, sich aller
erworbenen Fertigkeit, aller Routine zu ent-
schlagen und sich von neuem ins ewige Aben-
teuer zu stürzen. Er wurde frei von sich selbst.
Die Landschaften aus dieser Zeit charakteri-
sieren sich durch starke, farbige Umrißlinien
und eine gewisse Härte in den malerischen
Mitteln; aber man findet in ihnen schon seine
ganze spätere Entwicklung vorgebildet. Kurze
Zeit darauf entstand jene Serie von Gemälden
südlicher Architekturen, belebt von schönen,
zarten Tönen, die in der ersten Tuilerien-
Ausstellung einen so großen Erfolg hatten.
— Heute liegt die Periode der unterstrichenen
Beschreibung, der heftigen Überdeutlichkeit
hinter ihm. Eine schöne, weite Synthese erfüllt
seine Bilder; die kleinsten Einzelheiten noch
leben aus dem heiteren und natürlichen Zu-
sammenhang des Ganzen.
Auf Grün und Grau ist die Atmosphäre ge-
stimmt, die in diesen Bildern lebt; rosige und
gelbe Töne geben eine schüchterne Erwärmung.
Durch eine Farbenökonomie, die den Kontrast
überlegen verwendet (wenngleich die kälten
Nuancen vorherrschen), gelangt er zu Bildflächen
voll eines reichbewegten, vibrierenden Lebens.
Aufhöhungen mit Weiß streuen sich rhythmisch
hinein und geben der persönlich umgedeuteten
Natur eine neue Wahrheit. Das bleierne, fast
schwarze Firmament, gibt es nicht die ganze
Härte, die ganze Schwere eines überhitzten
Hochsommerhimmels in der Begegnung mit einer
Erde, die durch Rückstrahlung weiß wie Mar-
mor wird? Levys Malerei ist wie ein Glas
frisches Wasser. Und Früchte darum her, Baum-
gärten im Juli, Sträucher voll Licht und der
LEOPOLD LEW
»BEI CASSIS« 1921
schlecht verarbeitete Dogmen an. Er wartete
stets das bestimmte Erlebnis, die eigene Reaktio n
auf die neue Tatsache ab. Daher fehlen in sei-
nem Werk die unorganischen, die bloß ange-
flogenen Elemente. Er ist immer nur aufgrund
echter persönlicher Antriebe vorwärts gegangen.
Der Süden, den er vor etwa 10 Jahren ent-
deckte, war für ihn, den Pariser, eine wahre
Enthüllung. Er ward ihm zum Anlaß, sich aller
erworbenen Fertigkeit, aller Routine zu ent-
schlagen und sich von neuem ins ewige Aben-
teuer zu stürzen. Er wurde frei von sich selbst.
Die Landschaften aus dieser Zeit charakteri-
sieren sich durch starke, farbige Umrißlinien
und eine gewisse Härte in den malerischen
Mitteln; aber man findet in ihnen schon seine
ganze spätere Entwicklung vorgebildet. Kurze
Zeit darauf entstand jene Serie von Gemälden
südlicher Architekturen, belebt von schönen,
zarten Tönen, die in der ersten Tuilerien-
Ausstellung einen so großen Erfolg hatten.
— Heute liegt die Periode der unterstrichenen
Beschreibung, der heftigen Überdeutlichkeit
hinter ihm. Eine schöne, weite Synthese erfüllt
seine Bilder; die kleinsten Einzelheiten noch
leben aus dem heiteren und natürlichen Zu-
sammenhang des Ganzen.
Auf Grün und Grau ist die Atmosphäre ge-
stimmt, die in diesen Bildern lebt; rosige und
gelbe Töne geben eine schüchterne Erwärmung.
Durch eine Farbenökonomie, die den Kontrast
überlegen verwendet (wenngleich die kälten
Nuancen vorherrschen), gelangt er zu Bildflächen
voll eines reichbewegten, vibrierenden Lebens.
Aufhöhungen mit Weiß streuen sich rhythmisch
hinein und geben der persönlich umgedeuteten
Natur eine neue Wahrheit. Das bleierne, fast
schwarze Firmament, gibt es nicht die ganze
Härte, die ganze Schwere eines überhitzten
Hochsommerhimmels in der Begegnung mit einer
Erde, die durch Rückstrahlung weiß wie Mar-
mor wird? Levys Malerei ist wie ein Glas
frisches Wasser. Und Früchte darum her, Baum-
gärten im Juli, Sträucher voll Licht und der