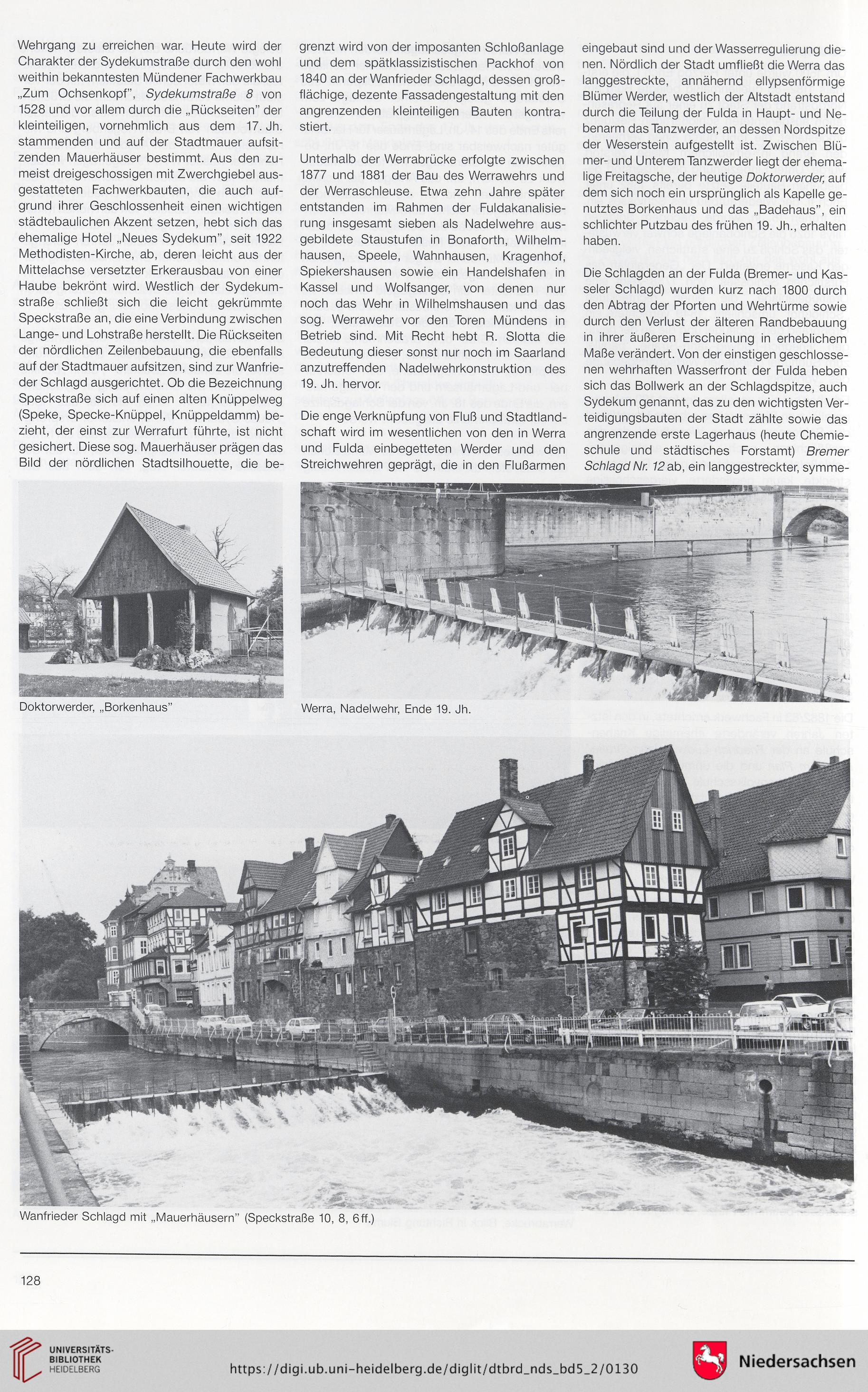Wehrgang zu erreichen war. Heute wird der
Charakter der Sydekumstraße durch den wohl
weithin bekanntesten Mündener Fachwerkbau
„Zum Ochsenkopf”, Sydekumstraße 8 von
1528 und vor allem durch die „Rückseiten” der
kleinteiligen, vornehmlich aus dem 17. Jh.
stammenden und auf der Stadtmauer aufsit-
zenden Mauerhäuser bestimmt. Aus den zu-
meist dreigeschossigen mit Zwerchgiebel aus-
gestatteten Fachwerkbauten, die auch auf-
grund ihrer Geschlossenheit einen wichtigen
städtebaulichen Akzent setzen, hebt sich das
ehemalige Hotel „Neues Sydekum”, seit 1922
Methodisten-Kirche, ab, deren leicht aus der
Mittelachse versetzter Erkerausbau von einer
Haube bekrönt wird. Westlich der Sydekum-
straße schließt sich die leicht gekrümmte
Speckstraße an, die eine Verbindung zwischen
Lange- und Lohstraße herstellt. Die Rückseiten
der nördlichen Zeilenbebauung, die ebenfalls
auf der Stadtmauer aufsitzen, sind zur Wanfrie-
der Schlagd ausgerichtet. Ob die Bezeichnung
Speckstraße sich auf einen alten Knüppelweg
(Speke, Specke-Knüppel, Knüppeldamm) be-
zieht, der einst zur Werrafurt führte, ist nicht
gesichert. Diese sog. Mauerhäuser prägen das
Bild der nördlichen Stadtsilhouette, die be-
grenzt wird von der imposanten Schloßanlage
und dem spätklassizistischen Packhof von
1840 an der Wanfrieder Schlagd, dessen groß-
flächige, dezente Fassadengestaltung mit den
angrenzenden kleinteiligen Bauten kontra-
stiert.
Unterhalb der Werrabrücke erfolgte zwischen
1877 und 1881 der Bau des Werrawehrs und
der Werraschleuse. Etwa zehn Jahre später
entstanden im Rahmen der Fuldakanalisie-
rung insgesamt sieben als Nadelwehre aus-
gebildete Staustufen in Bonaforth, Wilhelm-
hausen, Speele, Wahnhausen, Kragenhof,
Spiekershausen sowie ein Handelshafen in
Kassel und Wolfsanger, von denen nur
noch das Wehr in Wilhelmshausen und das
sog. Werrawehr vor den Toren Mündens in
Betrieb sind. Mit Recht hebt R. Slotta die
Bedeutung dieser sonst nur noch im Saarland
anzutreffenden Nadelwehrkonstruktion des
19. Jh. hervor.
Die enge Verknüpfung von Fluß und Stadtland-
schaft wird im wesentlichen von den in Werra
und Fulda einbegetteten Werder und den
Streichwehren geprägt, die in den Flußarmen
eingebaut sind und der Wasserregulierung die-
nen. Nördlich der Stadt umfließt die Werra das
langgestreckte, annähernd ellypsenförmige
Blümer Werder, westlich der Altstadt entstand
durch die Teilung der Fulda in Haupt- und Ne-
benarm das Tanzwerder, an dessen Nordspitze
der Weserstein aufgestellt ist. Zwischen Blü-
mer- und Unterem Tanzwerder liegt der ehema-
lige Freitagsche, der heutige Doktorwerder, auf
dem sich noch ein ursprünglich als Kapelle ge-
nutztes Borkenhaus und das „Badehaus”, ein
schlichter Putzbau des frühen 19. Jh., erhalten
haben.
Die Schlagden an der Fulda (Bremer- und Kas-
seler Schlagd) wurden kurz nach 1800 durch
den Abtrag der Pforten und Wehrtürme sowie
durch den Verlust der älteren Randbebauung
in ihrer äußeren Erscheinung in erheblichem
Maße verändert. Von der einstigen geschlosse-
nen wehrhaften Wasserfront der Fulda heben
sich das Bollwerk an der Schlagdspitze, auch
Sydekum genannt, das zu den wichtigsten Ver-
teidigungsbauten der Stadt zählte sowie das
angrenzende erste Lagerhaus (heute Chemie-
schule und städtisches Forstamt) Bremer
Schlagd Nr. 12 ab, ein langgestreckter, symme-
Doktorwerder, „Borkenhaus” Werra, Nadelwehr, Ende 19. Jh.
Wanfrieder Schlagd mit „Mauerhäusern” (Speckstraße 10, 8, 6 ff.)
128
Charakter der Sydekumstraße durch den wohl
weithin bekanntesten Mündener Fachwerkbau
„Zum Ochsenkopf”, Sydekumstraße 8 von
1528 und vor allem durch die „Rückseiten” der
kleinteiligen, vornehmlich aus dem 17. Jh.
stammenden und auf der Stadtmauer aufsit-
zenden Mauerhäuser bestimmt. Aus den zu-
meist dreigeschossigen mit Zwerchgiebel aus-
gestatteten Fachwerkbauten, die auch auf-
grund ihrer Geschlossenheit einen wichtigen
städtebaulichen Akzent setzen, hebt sich das
ehemalige Hotel „Neues Sydekum”, seit 1922
Methodisten-Kirche, ab, deren leicht aus der
Mittelachse versetzter Erkerausbau von einer
Haube bekrönt wird. Westlich der Sydekum-
straße schließt sich die leicht gekrümmte
Speckstraße an, die eine Verbindung zwischen
Lange- und Lohstraße herstellt. Die Rückseiten
der nördlichen Zeilenbebauung, die ebenfalls
auf der Stadtmauer aufsitzen, sind zur Wanfrie-
der Schlagd ausgerichtet. Ob die Bezeichnung
Speckstraße sich auf einen alten Knüppelweg
(Speke, Specke-Knüppel, Knüppeldamm) be-
zieht, der einst zur Werrafurt führte, ist nicht
gesichert. Diese sog. Mauerhäuser prägen das
Bild der nördlichen Stadtsilhouette, die be-
grenzt wird von der imposanten Schloßanlage
und dem spätklassizistischen Packhof von
1840 an der Wanfrieder Schlagd, dessen groß-
flächige, dezente Fassadengestaltung mit den
angrenzenden kleinteiligen Bauten kontra-
stiert.
Unterhalb der Werrabrücke erfolgte zwischen
1877 und 1881 der Bau des Werrawehrs und
der Werraschleuse. Etwa zehn Jahre später
entstanden im Rahmen der Fuldakanalisie-
rung insgesamt sieben als Nadelwehre aus-
gebildete Staustufen in Bonaforth, Wilhelm-
hausen, Speele, Wahnhausen, Kragenhof,
Spiekershausen sowie ein Handelshafen in
Kassel und Wolfsanger, von denen nur
noch das Wehr in Wilhelmshausen und das
sog. Werrawehr vor den Toren Mündens in
Betrieb sind. Mit Recht hebt R. Slotta die
Bedeutung dieser sonst nur noch im Saarland
anzutreffenden Nadelwehrkonstruktion des
19. Jh. hervor.
Die enge Verknüpfung von Fluß und Stadtland-
schaft wird im wesentlichen von den in Werra
und Fulda einbegetteten Werder und den
Streichwehren geprägt, die in den Flußarmen
eingebaut sind und der Wasserregulierung die-
nen. Nördlich der Stadt umfließt die Werra das
langgestreckte, annähernd ellypsenförmige
Blümer Werder, westlich der Altstadt entstand
durch die Teilung der Fulda in Haupt- und Ne-
benarm das Tanzwerder, an dessen Nordspitze
der Weserstein aufgestellt ist. Zwischen Blü-
mer- und Unterem Tanzwerder liegt der ehema-
lige Freitagsche, der heutige Doktorwerder, auf
dem sich noch ein ursprünglich als Kapelle ge-
nutztes Borkenhaus und das „Badehaus”, ein
schlichter Putzbau des frühen 19. Jh., erhalten
haben.
Die Schlagden an der Fulda (Bremer- und Kas-
seler Schlagd) wurden kurz nach 1800 durch
den Abtrag der Pforten und Wehrtürme sowie
durch den Verlust der älteren Randbebauung
in ihrer äußeren Erscheinung in erheblichem
Maße verändert. Von der einstigen geschlosse-
nen wehrhaften Wasserfront der Fulda heben
sich das Bollwerk an der Schlagdspitze, auch
Sydekum genannt, das zu den wichtigsten Ver-
teidigungsbauten der Stadt zählte sowie das
angrenzende erste Lagerhaus (heute Chemie-
schule und städtisches Forstamt) Bremer
Schlagd Nr. 12 ab, ein langgestreckter, symme-
Doktorwerder, „Borkenhaus” Werra, Nadelwehr, Ende 19. Jh.
Wanfrieder Schlagd mit „Mauerhäusern” (Speckstraße 10, 8, 6 ff.)
128