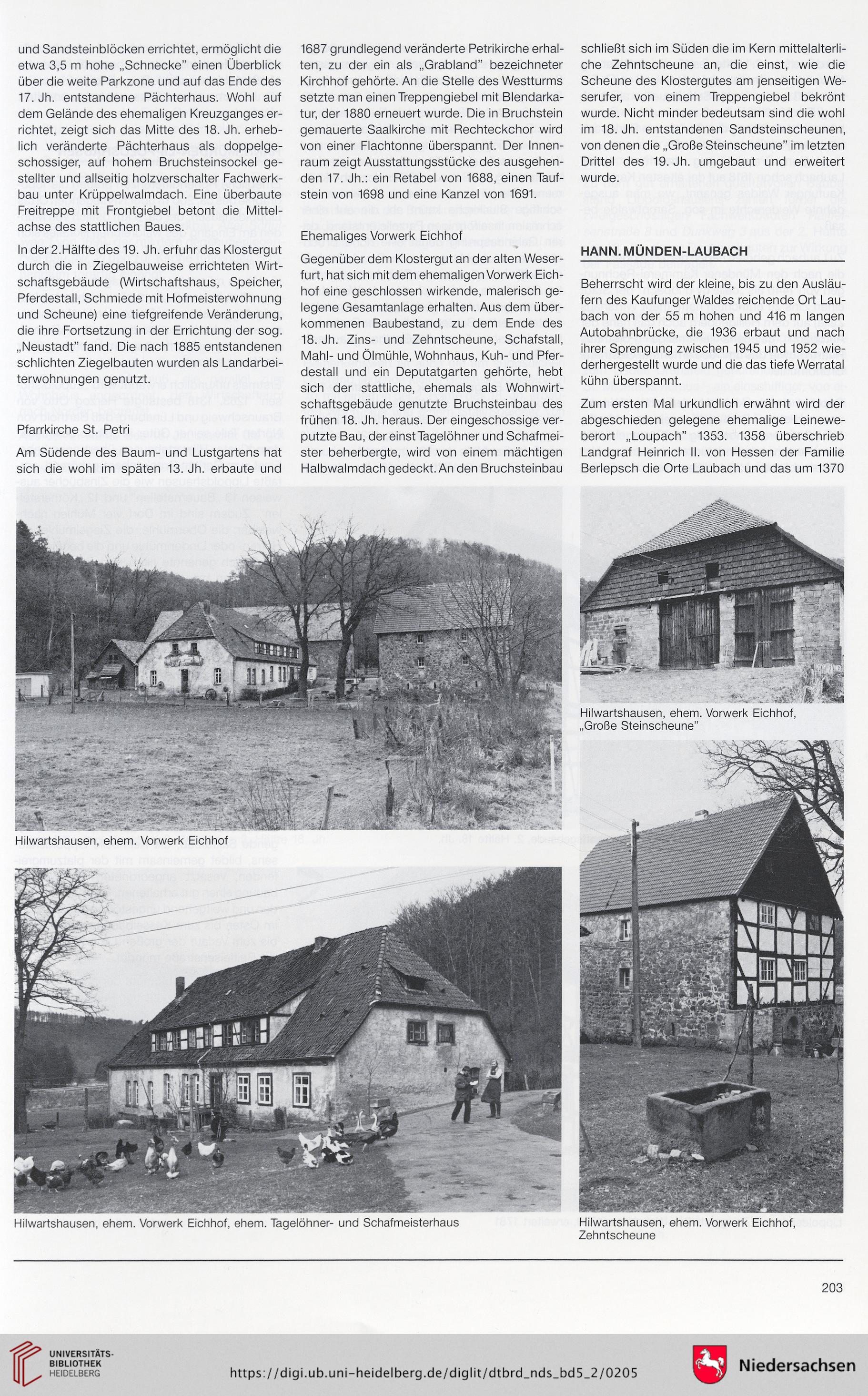und Sandsteinblöcken errichtet, ermöglicht die
etwa 3,5 m hohe „Schnecke” einen Überblick
über die weite Parkzone und auf das Ende des
17. Jh. entstandene Pächterhaus. Wohl auf
dem Gelände des ehemaligen Kreuzganges er-
richtet, zeigt sich das Mitte des 18. Jh. erheb-
lich veränderte Pächterhaus als doppelge-
schossiger, auf hohem Bruchsteinsockel ge-
stellter und allseitig holzverschalter Fachwerk-
bau unter Krüppelwalmdach. Eine überbaute
Freitreppe mit Frontgiebel betont die Mittel-
achse des stattlichen Baues.
In der 2.Hälfte des 19. Jh. erfuhr das Klostergut
durch die in Ziegelbauweise errichteten Wirt-
schaftsgebäude (Wirtschaftshaus, Speicher,
Pferdestall, Schmiede mit Hofmeisterwohnung
und Scheune) eine tiefgreifende Veränderung,
die ihre Fortsetzung in der Errichtung der sog.
„Neustadt” fand. Die nach 1885 entstandenen
schlichten Ziegelbauten wurden als Landarbei-
terwohnungen genutzt.
Pfarrkirche St. Petri
Am Südende des Baum- und Lustgartens hat
sich die wohl im späten 13. Jh. erbaute und
1687 grundlegend veränderte Petrikirche erhal-
ten, zu der ein als „Grabland” bezeichneter
Kirchhof gehörte. An die Stelle des Westturms
setzte man einen Treppengiebel mit Blendarka-
tur, der 1880 erneuert wurde. Die in Bruchstein
gemauerte Saalkirche mit Rechteckchor wird
von einer Flachtonne überspannt. Der Innen-
raum zeigt Ausstattungsstücke des ausgehen-
den 17. Jh.: ein Retabel von 1688, einen Tauf-
stein von 1698 und eine Kanzel von 1691.
Ehemaliges Vorwerk Eichhof
Gegenüber dem Klostergut an der alten Weser-
furt, hat sich mit dem ehemaligen Vorwerk Eich-
hof eine geschlossen wirkende, malerisch ge-
legene Gesamtanlage erhalten. Aus dem über-
kommenen Baubestand, zu dem Ende des
18. Jh. Zins- und Zehntscheune, Schafstall,
Mahl- und Ölmühle, Wohnhaus, Kuh- und Pfer-
destall und ein Deputatgarten gehörte, hebt
sich der stattliche, ehemals als Wohnwirt-
schaftsgebäude genutzte Bruchsteinbau des
frühen 18. Jh. heraus. Der eingeschossige ver-
putzte Bau, der einst Tagelöhner und Schafmei-
ster beherbergte, wird von einem mächtigen
Halbwalmdach gedeckt. An den Bruchsteinbau
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof, ehern. Tagelöhner- und Schafmeisterhaus
schließt sich im Süden die im Kern mittelalterli-
che Zehntscheune an, die einst, wie die
Scheune des Klostergutes am jenseitigen We-
serufer, von einem Treppengiebel bekrönt
wurde. Nicht minder bedeutsam sind die wohl
im 18. Jh. entstandenen Sandsteinscheunen,
von denen die „Große Steinscheune” im letzten
Drittel des 19. Jh. umgebaut und erweitert
wurde.
HANN. MÜNDEN-LAUBACH
Beherrscht wird der kleine, bis zu den Ausläu-
fern des Kaufunger Waldes reichende Ort Lau-
bach von der 55 m hohen und 416 m langen
Autobahnbrücke, die 1936 erbaut und nach
ihrer Sprengung zwischen 1945 und 1952 wie-
derhergestellt wurde und die das tiefe Werratal
kühn überspannt.
Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird der
abgeschieden gelegene ehemalige Leinewe-
berort „Loupach” 1353. 1358 überschrieb
Landgraf Heinrich II. von Hessen der Familie
Berlepsch die Orte Laubach und das um 1370
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,
„Große Steinscheune”
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,
Zehntscheune
203
etwa 3,5 m hohe „Schnecke” einen Überblick
über die weite Parkzone und auf das Ende des
17. Jh. entstandene Pächterhaus. Wohl auf
dem Gelände des ehemaligen Kreuzganges er-
richtet, zeigt sich das Mitte des 18. Jh. erheb-
lich veränderte Pächterhaus als doppelge-
schossiger, auf hohem Bruchsteinsockel ge-
stellter und allseitig holzverschalter Fachwerk-
bau unter Krüppelwalmdach. Eine überbaute
Freitreppe mit Frontgiebel betont die Mittel-
achse des stattlichen Baues.
In der 2.Hälfte des 19. Jh. erfuhr das Klostergut
durch die in Ziegelbauweise errichteten Wirt-
schaftsgebäude (Wirtschaftshaus, Speicher,
Pferdestall, Schmiede mit Hofmeisterwohnung
und Scheune) eine tiefgreifende Veränderung,
die ihre Fortsetzung in der Errichtung der sog.
„Neustadt” fand. Die nach 1885 entstandenen
schlichten Ziegelbauten wurden als Landarbei-
terwohnungen genutzt.
Pfarrkirche St. Petri
Am Südende des Baum- und Lustgartens hat
sich die wohl im späten 13. Jh. erbaute und
1687 grundlegend veränderte Petrikirche erhal-
ten, zu der ein als „Grabland” bezeichneter
Kirchhof gehörte. An die Stelle des Westturms
setzte man einen Treppengiebel mit Blendarka-
tur, der 1880 erneuert wurde. Die in Bruchstein
gemauerte Saalkirche mit Rechteckchor wird
von einer Flachtonne überspannt. Der Innen-
raum zeigt Ausstattungsstücke des ausgehen-
den 17. Jh.: ein Retabel von 1688, einen Tauf-
stein von 1698 und eine Kanzel von 1691.
Ehemaliges Vorwerk Eichhof
Gegenüber dem Klostergut an der alten Weser-
furt, hat sich mit dem ehemaligen Vorwerk Eich-
hof eine geschlossen wirkende, malerisch ge-
legene Gesamtanlage erhalten. Aus dem über-
kommenen Baubestand, zu dem Ende des
18. Jh. Zins- und Zehntscheune, Schafstall,
Mahl- und Ölmühle, Wohnhaus, Kuh- und Pfer-
destall und ein Deputatgarten gehörte, hebt
sich der stattliche, ehemals als Wohnwirt-
schaftsgebäude genutzte Bruchsteinbau des
frühen 18. Jh. heraus. Der eingeschossige ver-
putzte Bau, der einst Tagelöhner und Schafmei-
ster beherbergte, wird von einem mächtigen
Halbwalmdach gedeckt. An den Bruchsteinbau
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof, ehern. Tagelöhner- und Schafmeisterhaus
schließt sich im Süden die im Kern mittelalterli-
che Zehntscheune an, die einst, wie die
Scheune des Klostergutes am jenseitigen We-
serufer, von einem Treppengiebel bekrönt
wurde. Nicht minder bedeutsam sind die wohl
im 18. Jh. entstandenen Sandsteinscheunen,
von denen die „Große Steinscheune” im letzten
Drittel des 19. Jh. umgebaut und erweitert
wurde.
HANN. MÜNDEN-LAUBACH
Beherrscht wird der kleine, bis zu den Ausläu-
fern des Kaufunger Waldes reichende Ort Lau-
bach von der 55 m hohen und 416 m langen
Autobahnbrücke, die 1936 erbaut und nach
ihrer Sprengung zwischen 1945 und 1952 wie-
derhergestellt wurde und die das tiefe Werratal
kühn überspannt.
Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird der
abgeschieden gelegene ehemalige Leinewe-
berort „Loupach” 1353. 1358 überschrieb
Landgraf Heinrich II. von Hessen der Familie
Berlepsch die Orte Laubach und das um 1370
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,
„Große Steinscheune”
Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,
Zehntscheune
203