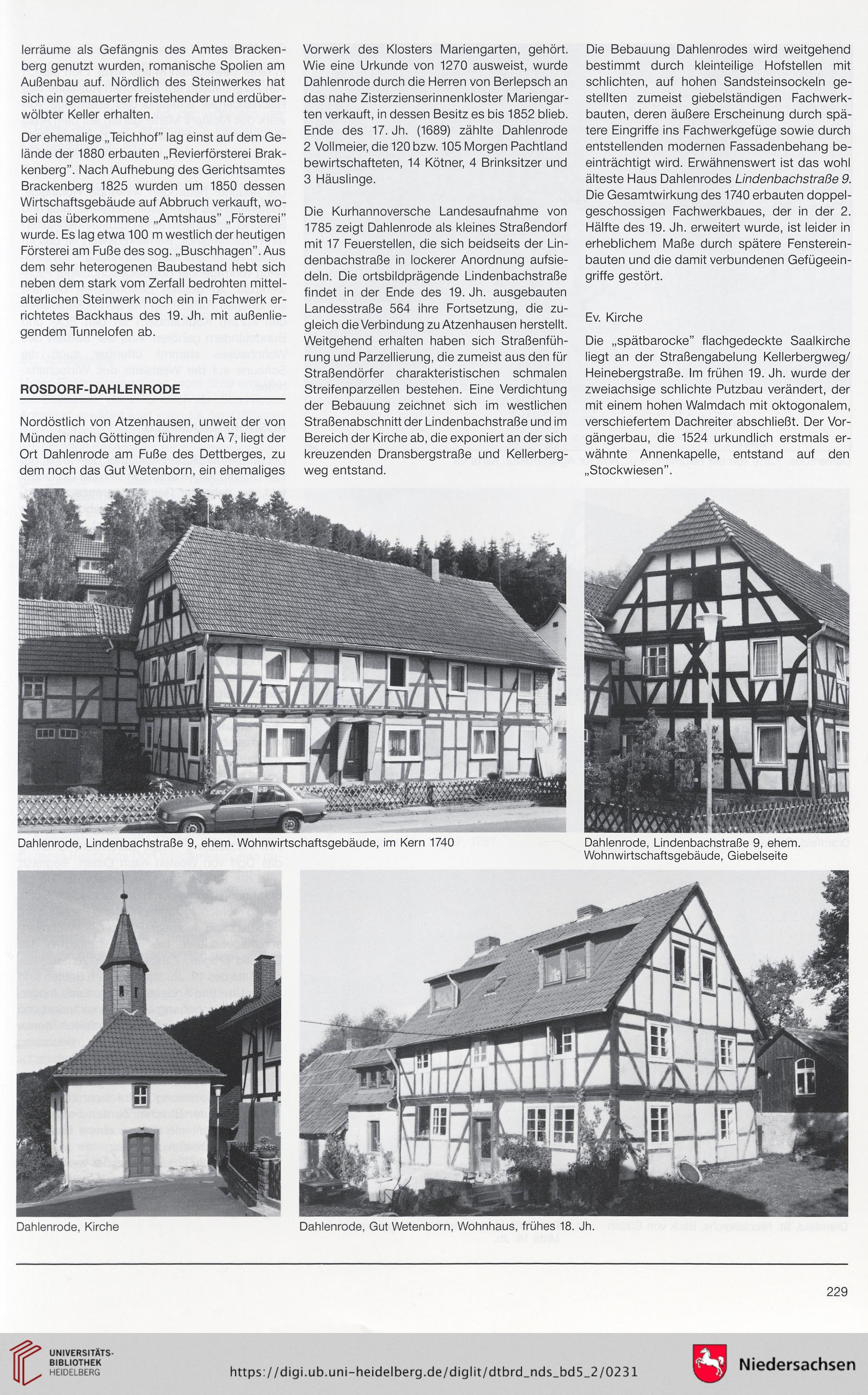lerräume als Gefängnis des Amtes Bracken-
berg genutzt wurden, romanische Spolien am
Außenbau auf. Nördlich des Steinwerkes hat
sich ein gemauerter freistehender und erdüber-
wölbter Keller erhalten.
Der ehemalige „Teichhof” lag einst auf dem Ge-
lände der 1880 erbauten „Revierförsterei Brak-
kenberg”. Nach Aufhebung des Gerichtsamtes
Brackenberg 1825 wurden um 1850 dessen
Wirtschaftsgebäude auf Abbruch verkauft, wo-
bei das überkommene „Amtshaus” „Försterei”
wurde. Es lag etwa 100 m westlich der heutigen
Försterei am Fuße des sog. „Buschhagen”. Aus
dem sehr heterogenen Baubestand hebt sich
neben dem stark vom Zerfall bedrohten mittel-
alterlichen Steinwerk noch ein in Fachwerk er-
richtetes Backhaus des 19. Jh. mit außenlie-
gendem Tunnelofen ab.
ROSDORF-DAHLENRODE
Nordöstlich von Atzenhausen, unweit der von
Münden nach Göttingen führenden A 7, liegt der
Ort Dahlenrode am Fuße des Dettberges, zu
dem noch das Gut Wetenborn, ein ehemaliges
Vorwerk des Klosters Mariengarten, gehört.
Wie eine Urkunde von 1270 ausweist, wurde
Dahlenrode durch die Herren von Berlepsch an
das nahe Zisterzienserinnenkloster Mariengar-
ten verkauft, in dessen Besitz es bis 1852 blieb.
Ende des 17. Jh. (1689) zählte Dahlenrode
2 Vollmeier, die 120 bzw. 105 Morgen Pachtland
bewirtschafteten, 14 Kötner, 4 Brinksitzer und
3 Häuslinge.
Die Kurhannoversche Landesaufnahme von
1785 zeigt Dahlenrode als kleines Straßendorf
mit 17 Feuerstellen, die sich beidseits der Lin-
denbachstraße in lockerer Anordnung aufsie-
deln. Die ortsbildprägende Lindenbachstraße
findet in der Ende des 19. Jh. ausgebauten
Landesstraße 564 ihre Fortsetzung, die zu-
gleich die Verbindung zu Atzenhausen herstellt.
Weitgehend erhalten haben sich Straßenfüh-
rung und Parzellierung, die zumeist aus den für
Straßendörfer charakteristischen schmalen
Streifenparzellen bestehen. Eine Verdichtung
der Bebauung zeichnet sich im westlichen
Straßenabschnitt der Lindenbachstraße und im
Bereich der Kirche ab, die exponiert an der sich
kreuzenden Dransbergstraße und Kellerberg-
weg entstand.
Die Bebauung Dahlenrodes wird weitgehend
bestimmt durch kleinteilige Hofstellen mit
schlichten, auf hohen Sandsteinsockeln ge-
stellten zumeist giebelständigen Fachwerk-
bauten, deren äußere Erscheinung durch spä-
tere Eingriffe ins Fachwerkgefüge sowie durch
entstellenden modernen Fassadenbehang be-
einträchtigt wird. Erwähnenswert ist das wohl
älteste Haus Dahlenrodes Lindenbachstraße 9.
Die Gesamtwirkung des 1740 erbauten doppel-
geschossigen Fachwerkbaues, der in der 2.
Hälfte des 19. Jh. erweitert wurde, ist leider in
erheblichem Maße durch spätere Fensterein-
bauten und die damit verbundenen Gefügeein-
griffe gestört.
Ev. Kirche
Die „spätbarocke” flachgedeckte Saalkirche
liegt an der Straßengabelung Kellerbergweg/
Heinebergstraße. Im frühen 19. Jh. wurde der
zweiachsige schlichte Putzbau verändert, der
mit einem hohen Walmdach mit oktogonalem,
verschiefertem Dachreiter abschließt. Der Vor-
gängerbau, die 1524 urkundlich erstmals er-
wähnte Annenkapelle, entstand auf den
„Stockwiesen”.
Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern 1740
Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern.
Wohnwirtschaftsgebäude, Giebelseite
Dahlenrode, Kirche
Dahlenrode, Gut Wetenborn, Wohnhaus, frühes 18. Jh.
229
berg genutzt wurden, romanische Spolien am
Außenbau auf. Nördlich des Steinwerkes hat
sich ein gemauerter freistehender und erdüber-
wölbter Keller erhalten.
Der ehemalige „Teichhof” lag einst auf dem Ge-
lände der 1880 erbauten „Revierförsterei Brak-
kenberg”. Nach Aufhebung des Gerichtsamtes
Brackenberg 1825 wurden um 1850 dessen
Wirtschaftsgebäude auf Abbruch verkauft, wo-
bei das überkommene „Amtshaus” „Försterei”
wurde. Es lag etwa 100 m westlich der heutigen
Försterei am Fuße des sog. „Buschhagen”. Aus
dem sehr heterogenen Baubestand hebt sich
neben dem stark vom Zerfall bedrohten mittel-
alterlichen Steinwerk noch ein in Fachwerk er-
richtetes Backhaus des 19. Jh. mit außenlie-
gendem Tunnelofen ab.
ROSDORF-DAHLENRODE
Nordöstlich von Atzenhausen, unweit der von
Münden nach Göttingen führenden A 7, liegt der
Ort Dahlenrode am Fuße des Dettberges, zu
dem noch das Gut Wetenborn, ein ehemaliges
Vorwerk des Klosters Mariengarten, gehört.
Wie eine Urkunde von 1270 ausweist, wurde
Dahlenrode durch die Herren von Berlepsch an
das nahe Zisterzienserinnenkloster Mariengar-
ten verkauft, in dessen Besitz es bis 1852 blieb.
Ende des 17. Jh. (1689) zählte Dahlenrode
2 Vollmeier, die 120 bzw. 105 Morgen Pachtland
bewirtschafteten, 14 Kötner, 4 Brinksitzer und
3 Häuslinge.
Die Kurhannoversche Landesaufnahme von
1785 zeigt Dahlenrode als kleines Straßendorf
mit 17 Feuerstellen, die sich beidseits der Lin-
denbachstraße in lockerer Anordnung aufsie-
deln. Die ortsbildprägende Lindenbachstraße
findet in der Ende des 19. Jh. ausgebauten
Landesstraße 564 ihre Fortsetzung, die zu-
gleich die Verbindung zu Atzenhausen herstellt.
Weitgehend erhalten haben sich Straßenfüh-
rung und Parzellierung, die zumeist aus den für
Straßendörfer charakteristischen schmalen
Streifenparzellen bestehen. Eine Verdichtung
der Bebauung zeichnet sich im westlichen
Straßenabschnitt der Lindenbachstraße und im
Bereich der Kirche ab, die exponiert an der sich
kreuzenden Dransbergstraße und Kellerberg-
weg entstand.
Die Bebauung Dahlenrodes wird weitgehend
bestimmt durch kleinteilige Hofstellen mit
schlichten, auf hohen Sandsteinsockeln ge-
stellten zumeist giebelständigen Fachwerk-
bauten, deren äußere Erscheinung durch spä-
tere Eingriffe ins Fachwerkgefüge sowie durch
entstellenden modernen Fassadenbehang be-
einträchtigt wird. Erwähnenswert ist das wohl
älteste Haus Dahlenrodes Lindenbachstraße 9.
Die Gesamtwirkung des 1740 erbauten doppel-
geschossigen Fachwerkbaues, der in der 2.
Hälfte des 19. Jh. erweitert wurde, ist leider in
erheblichem Maße durch spätere Fensterein-
bauten und die damit verbundenen Gefügeein-
griffe gestört.
Ev. Kirche
Die „spätbarocke” flachgedeckte Saalkirche
liegt an der Straßengabelung Kellerbergweg/
Heinebergstraße. Im frühen 19. Jh. wurde der
zweiachsige schlichte Putzbau verändert, der
mit einem hohen Walmdach mit oktogonalem,
verschiefertem Dachreiter abschließt. Der Vor-
gängerbau, die 1524 urkundlich erstmals er-
wähnte Annenkapelle, entstand auf den
„Stockwiesen”.
Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern 1740
Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern.
Wohnwirtschaftsgebäude, Giebelseite
Dahlenrode, Kirche
Dahlenrode, Gut Wetenborn, Wohnhaus, frühes 18. Jh.
229