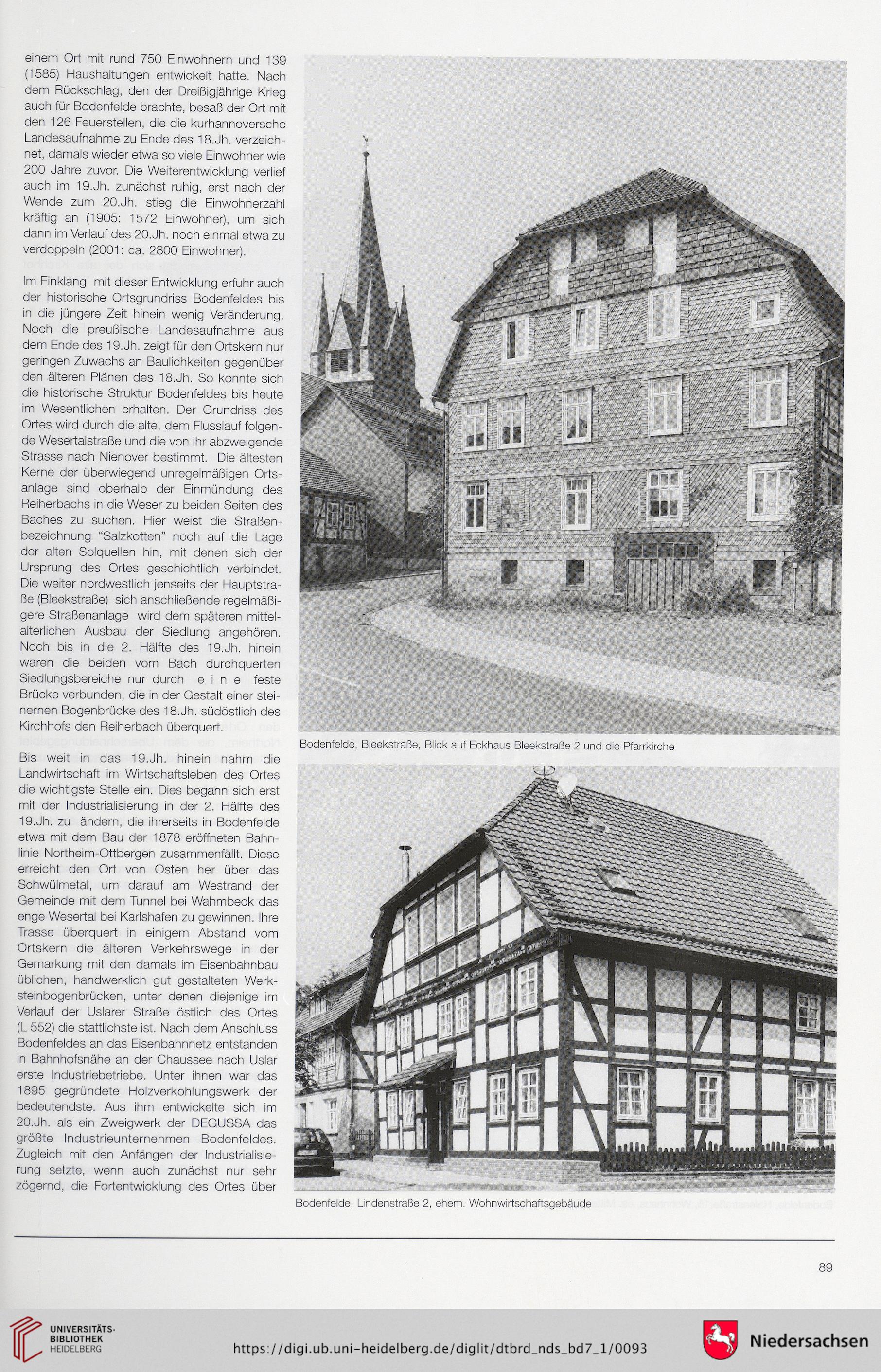einem Ort mit rund 750 Einwohnern und 139
(1585) Haushaltungen entwickelt hatte. Nach
dem Rückschlag, den der Dreißigjährige Krieg
auch für Bodenfelde brachte, besaß der Ort mit
den 126 Feuerstellen, die die kurhannoversche
Landesaufnahme zu Ende des 18.Jh. verzeich-
net, damals wieder etwa so viele Einwohner wie
200 Jahre zuvor. Die Weiterentwicklung verlief
auch im 19.Jh. zunächst ruhig, erst nach der
Wende zum 20.Jh. stieg die Einwohnerzahl
kräftig an (1905: 1572 Einwohner), um sich
dann im Verlauf des 20. Jh. noch einmal etwa zu
verdoppeln (2001: ca. 2800 Einwohner).
Im Einklang mit dieser Entwicklung erfuhr auch
der historische Ortsgrundriss Bodenfeldes bis
in die jüngere Zeit hinein wenig Veränderung.
Noch die preußische Landesaufnahme aus
dem Ende des 19. Jh. zeigt für den Ortskern nur
geringen Zuwachs an Baulichkeiten gegenüber
den älteren Plänen des 18.Jh. So konnte sich
die historische Struktur Bodenfeldes bis heute
im Wesentlichen erhalten. Der Grundriss des
Ortes wird durch die alte, dem Flusslauf folgen-
de Wesertalstraße und die von ihr abzweigende
Strasse nach Nienover bestimmt. Die ältesten
Kerne der überwiegend unregelmäßigen Orts-
anlage sind oberhalb der Einmündung des
Reiherbachs in die Weser zu beiden Seiten des
Baches zu suchen. Hier weist die Straßen-
bezeichnung “Salzkotten" noch auf die Lage
der alten Solquellen hin, mit denen sich der
Ursprung des Ortes geschichtlich verbindet.
Die weiter nordwestlich jenseits der Hauptstra-
ße (Bleekstraße) sich anschließende regelmäßi-
gere Straßenanlage wird dem späteren mittel-
alterlichen Ausbau der Siedlung angehören.
Noch bis in die 2. Hälfte des 19.Jh. hinein
waren die beiden vom Bach durchquerten
Siedlungsbereiche nur durch eine feste
Brücke verbunden, die in der Gestalt einer stei-
nernen Bogenbrücke des 18.Jh. südöstlich des
Kirchhofs den Reiherbach überquert.
Bis weit in das 19.Jh. hinein nahm die
Landwirtschaft im Wirtschaftsleben des Ortes
die wichtigste Stelle ein. Dies begann sich erst
mit der Industrialisierung in der 2. Hälfte des
19. Jh. zu ändern, die ihrerseits in Bodenfelde
etwa mit dem Bau der 1878 eröffneten Bahn-
linie Northeim-Ottbergen zusammenfällt. Diese
erreicht den Ort von Osten her über das
Schwülmetal, um darauf am Westrand der
Gemeinde mit dem Tunnel bei Wahmbeck das
enge Wesertal bei Karlshafen zu gewinnen. Ihre
Trasse überquert in einigem Abstand vom
Ortskern die älteren Verkehrswege in der
Gemarkung mit den damals im Eisenbahnbau
üblichen, handwerklich gut gestalteten Werk-
steinbogenbrücken, unter denen diejenige im
Verlauf der Uslarer Straße östlich des Ortes
(L 552) die stattlichste ist. Nach dem Anschluss
Bodenfeldes an das Eisenbahnnetz entstanden
in Bahnhofsnähe an der Chaussee nach Uslar
erste Industriebetriebe. Unter ihnen war das
1895 gegründete Holzverkohlungswerk der
bedeutendste. Aus ihm entwickelte sich im
20. Jh. als ein Zweigwerk der DEGUSSA das
größte Industrieunternehmen Bodenfeldes.
Zugleich mit den Anfängen der Industrialisie-
rung setzte, wenn auch zunächst nur sehr
zögernd, die Fortentwicklung des Ortes über
Bodenfelde, Bleekstraße, Blick auf Eckhaus Bleekstraße 2 und die Pfarrkirche
CP '
Bodenfelde, Lindenstraße 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude
89
(1585) Haushaltungen entwickelt hatte. Nach
dem Rückschlag, den der Dreißigjährige Krieg
auch für Bodenfelde brachte, besaß der Ort mit
den 126 Feuerstellen, die die kurhannoversche
Landesaufnahme zu Ende des 18.Jh. verzeich-
net, damals wieder etwa so viele Einwohner wie
200 Jahre zuvor. Die Weiterentwicklung verlief
auch im 19.Jh. zunächst ruhig, erst nach der
Wende zum 20.Jh. stieg die Einwohnerzahl
kräftig an (1905: 1572 Einwohner), um sich
dann im Verlauf des 20. Jh. noch einmal etwa zu
verdoppeln (2001: ca. 2800 Einwohner).
Im Einklang mit dieser Entwicklung erfuhr auch
der historische Ortsgrundriss Bodenfeldes bis
in die jüngere Zeit hinein wenig Veränderung.
Noch die preußische Landesaufnahme aus
dem Ende des 19. Jh. zeigt für den Ortskern nur
geringen Zuwachs an Baulichkeiten gegenüber
den älteren Plänen des 18.Jh. So konnte sich
die historische Struktur Bodenfeldes bis heute
im Wesentlichen erhalten. Der Grundriss des
Ortes wird durch die alte, dem Flusslauf folgen-
de Wesertalstraße und die von ihr abzweigende
Strasse nach Nienover bestimmt. Die ältesten
Kerne der überwiegend unregelmäßigen Orts-
anlage sind oberhalb der Einmündung des
Reiherbachs in die Weser zu beiden Seiten des
Baches zu suchen. Hier weist die Straßen-
bezeichnung “Salzkotten" noch auf die Lage
der alten Solquellen hin, mit denen sich der
Ursprung des Ortes geschichtlich verbindet.
Die weiter nordwestlich jenseits der Hauptstra-
ße (Bleekstraße) sich anschließende regelmäßi-
gere Straßenanlage wird dem späteren mittel-
alterlichen Ausbau der Siedlung angehören.
Noch bis in die 2. Hälfte des 19.Jh. hinein
waren die beiden vom Bach durchquerten
Siedlungsbereiche nur durch eine feste
Brücke verbunden, die in der Gestalt einer stei-
nernen Bogenbrücke des 18.Jh. südöstlich des
Kirchhofs den Reiherbach überquert.
Bis weit in das 19.Jh. hinein nahm die
Landwirtschaft im Wirtschaftsleben des Ortes
die wichtigste Stelle ein. Dies begann sich erst
mit der Industrialisierung in der 2. Hälfte des
19. Jh. zu ändern, die ihrerseits in Bodenfelde
etwa mit dem Bau der 1878 eröffneten Bahn-
linie Northeim-Ottbergen zusammenfällt. Diese
erreicht den Ort von Osten her über das
Schwülmetal, um darauf am Westrand der
Gemeinde mit dem Tunnel bei Wahmbeck das
enge Wesertal bei Karlshafen zu gewinnen. Ihre
Trasse überquert in einigem Abstand vom
Ortskern die älteren Verkehrswege in der
Gemarkung mit den damals im Eisenbahnbau
üblichen, handwerklich gut gestalteten Werk-
steinbogenbrücken, unter denen diejenige im
Verlauf der Uslarer Straße östlich des Ortes
(L 552) die stattlichste ist. Nach dem Anschluss
Bodenfeldes an das Eisenbahnnetz entstanden
in Bahnhofsnähe an der Chaussee nach Uslar
erste Industriebetriebe. Unter ihnen war das
1895 gegründete Holzverkohlungswerk der
bedeutendste. Aus ihm entwickelte sich im
20. Jh. als ein Zweigwerk der DEGUSSA das
größte Industrieunternehmen Bodenfeldes.
Zugleich mit den Anfängen der Industrialisie-
rung setzte, wenn auch zunächst nur sehr
zögernd, die Fortentwicklung des Ortes über
Bodenfelde, Bleekstraße, Blick auf Eckhaus Bleekstraße 2 und die Pfarrkirche
CP '
Bodenfelde, Lindenstraße 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude
89