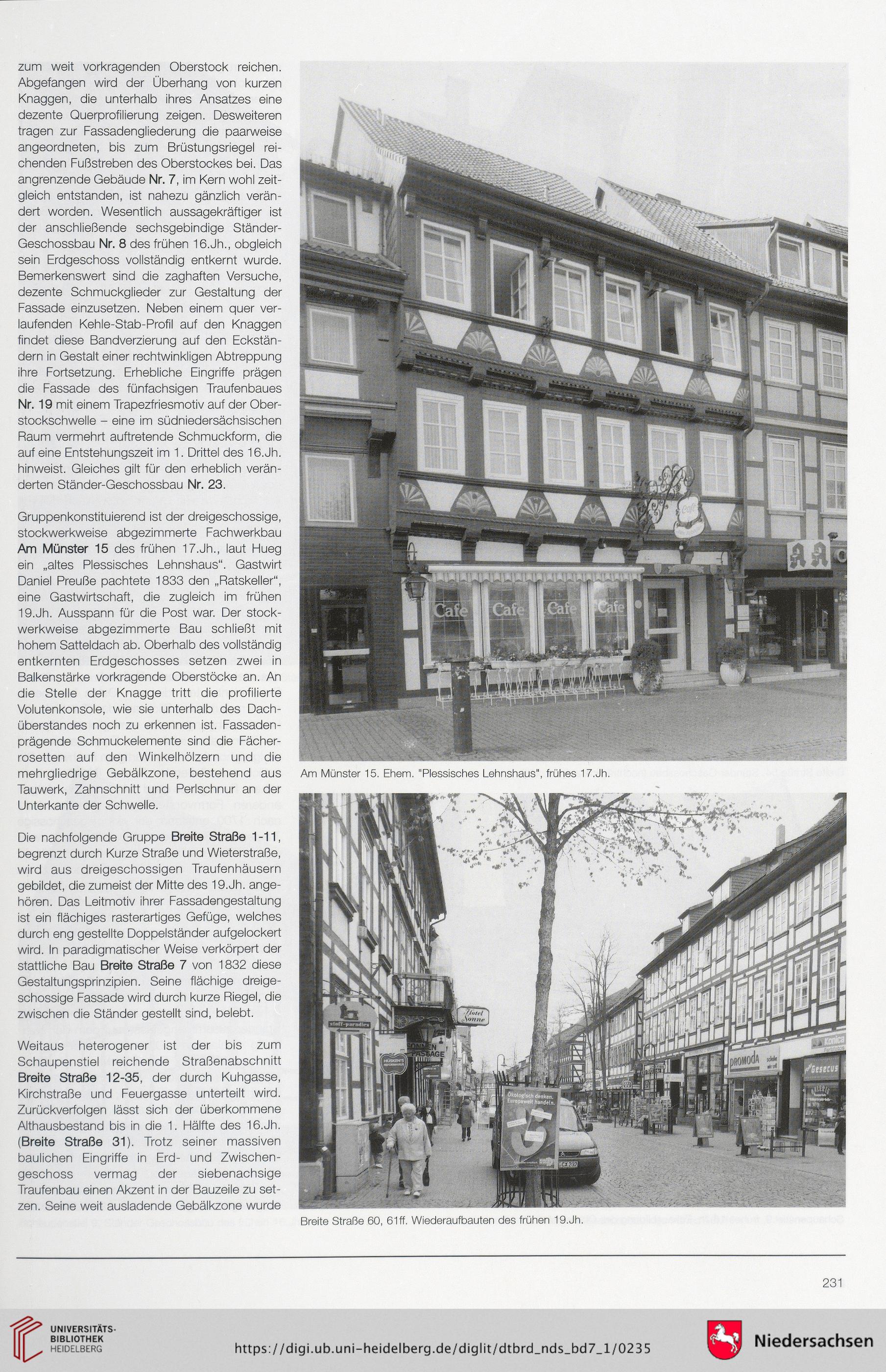zum weit vorkragenden Oberstock reichen.
Abgefangen wird der Überhang von kurzen
Knaggen, die unterhalb ihres Ansatzes eine
dezente Querprofilierung zeigen. Desweiteren
tragen zur Fassadengliederung die paarweise
angeordneten, bis zum Brüstungsriegel rei-
chenden Fußstreben des Oberstockes bei. Das
angrenzende Gebäude Nr. 7, im Kern wohl zeit-
gleich entstanden, ist nahezu gänzlich verän-
dert worden. Wesentlich aussagekräftiger ist
der anschließende sechsgebindige Ständer-
Geschossbau Nr. 8 des frühen 16.Jh., obgleich
sein Erdgeschoss vollständig entkernt wurde.
Bemerkenswert sind die zaghaften Versuche,
dezente Schmuckglieder zur Gestaltung der
Fassade einzusetzen. Neben einem quer ver-
laufenden Kehle-Stab-Profil auf den Knaggen
findet diese Bandverzierung auf den Eckstän-
dern in Gestalt einer rechtwinkligen Abtreppung
ihre Fortsetzung. Erhebliche Eingriffe prägen
die Fassade des fünfachsigen Traufenbaues
Nr. 19 mit einem Trapezfriesmotiv auf der Ober-
stockschwelle - eine im südniedersächsischen
Raum vermehrt auftretende Schmuckform, die
auf eine Entstehungszeit im 1. Drittel des 16.Jh.
hinweist. Gleiches gilt für den erheblich verän-
derten Ständer-Geschossbau Nr. 23.
Gruppenkonstituierend ist der dreigeschossige,
stockwerkweise abgezimmerte Fachwerkbau
Am Münster 15 des frühen 17.Jh., laut Hueg
ein „altes Plessisches Lehnshaus“. Gastwirt
Daniel Preuße pachtete 1833 den „Ratskeller“,
eine Gastwirtschaft, die zugleich im frühen
19.Jh. Ausspann für die Post war. Der stock-
werkweise abgezimmerte Bau schließt mit
hohem Satteldach ab. Oberhalb des vollständig
entkernten Erdgeschosses setzen zwei in
Balkenstärke vorkragende Oberstöcke an. An
die Stelle der Knagge tritt die profilierte
Volutenkonsole, wie sie unterhalb des Dach-
überstandes noch zu erkennen ist. Fassaden-
prägende Schmuckeiemente sind die Fächer-
rosetten auf den Winkelhölzern und die
mehrgliedrige Gebälkzone, bestehend aus
Tauwerk, Zahnschnitt und Perlschnur an der
Unterkante der Schwelle.
Die nachfolgende Gruppe Breite Straße 1-11,
begrenzt durch Kurze Straße und Wieterstraße,
wird aus dreigeschossigen Traufenhäusern
gebildet, die zumeist der Mitte des 19.Jh. ange-
hören. Das Leitmotiv ihrer Fassadengestaltung
ist ein flächiges rasterartiges Gefüge, welches
durch eng gestellte Doppelständer aufgelockert
wird. In paradigmatischer Weise verkörpert der
stattliche Bau Breite Straße 7 von 1832 diese
Gestaltungsprinzipien. Seine flächige dreige-
schossige Fassade wird durch kurze Riegel, die
zwischen die Ständer gestellt sind, belebt.
Weitaus heterogener ist der bis zum
Schaupenstiel reichende Straßenabschnitt
Breite Straße 12-35, der durch Kuhgasse,
Kirchstraße und Feuergasse unterteilt wird.
Zurückverfolgen lässt sich der überkommene
Althausbestand bis in die 1. Hälfte des 16.Jh.
(Breite Straße 31). Trotz seiner massiven
baulichen Eingriffe in Erd- und Zwischen-
geschoss vermag der siebenachsige
Traufenbau einen Akzent in der Bauzeile zu set-
zen. Seine weit ausladende Gebälkzone wurde
Am Münster 15. Ehern. "Plessisches Lehnshaus", frühes 17.Jh.
Breite Straße 60, 61 ff. Wiederaufbauten des frühen 19.Jh.
231
Abgefangen wird der Überhang von kurzen
Knaggen, die unterhalb ihres Ansatzes eine
dezente Querprofilierung zeigen. Desweiteren
tragen zur Fassadengliederung die paarweise
angeordneten, bis zum Brüstungsriegel rei-
chenden Fußstreben des Oberstockes bei. Das
angrenzende Gebäude Nr. 7, im Kern wohl zeit-
gleich entstanden, ist nahezu gänzlich verän-
dert worden. Wesentlich aussagekräftiger ist
der anschließende sechsgebindige Ständer-
Geschossbau Nr. 8 des frühen 16.Jh., obgleich
sein Erdgeschoss vollständig entkernt wurde.
Bemerkenswert sind die zaghaften Versuche,
dezente Schmuckglieder zur Gestaltung der
Fassade einzusetzen. Neben einem quer ver-
laufenden Kehle-Stab-Profil auf den Knaggen
findet diese Bandverzierung auf den Eckstän-
dern in Gestalt einer rechtwinkligen Abtreppung
ihre Fortsetzung. Erhebliche Eingriffe prägen
die Fassade des fünfachsigen Traufenbaues
Nr. 19 mit einem Trapezfriesmotiv auf der Ober-
stockschwelle - eine im südniedersächsischen
Raum vermehrt auftretende Schmuckform, die
auf eine Entstehungszeit im 1. Drittel des 16.Jh.
hinweist. Gleiches gilt für den erheblich verän-
derten Ständer-Geschossbau Nr. 23.
Gruppenkonstituierend ist der dreigeschossige,
stockwerkweise abgezimmerte Fachwerkbau
Am Münster 15 des frühen 17.Jh., laut Hueg
ein „altes Plessisches Lehnshaus“. Gastwirt
Daniel Preuße pachtete 1833 den „Ratskeller“,
eine Gastwirtschaft, die zugleich im frühen
19.Jh. Ausspann für die Post war. Der stock-
werkweise abgezimmerte Bau schließt mit
hohem Satteldach ab. Oberhalb des vollständig
entkernten Erdgeschosses setzen zwei in
Balkenstärke vorkragende Oberstöcke an. An
die Stelle der Knagge tritt die profilierte
Volutenkonsole, wie sie unterhalb des Dach-
überstandes noch zu erkennen ist. Fassaden-
prägende Schmuckeiemente sind die Fächer-
rosetten auf den Winkelhölzern und die
mehrgliedrige Gebälkzone, bestehend aus
Tauwerk, Zahnschnitt und Perlschnur an der
Unterkante der Schwelle.
Die nachfolgende Gruppe Breite Straße 1-11,
begrenzt durch Kurze Straße und Wieterstraße,
wird aus dreigeschossigen Traufenhäusern
gebildet, die zumeist der Mitte des 19.Jh. ange-
hören. Das Leitmotiv ihrer Fassadengestaltung
ist ein flächiges rasterartiges Gefüge, welches
durch eng gestellte Doppelständer aufgelockert
wird. In paradigmatischer Weise verkörpert der
stattliche Bau Breite Straße 7 von 1832 diese
Gestaltungsprinzipien. Seine flächige dreige-
schossige Fassade wird durch kurze Riegel, die
zwischen die Ständer gestellt sind, belebt.
Weitaus heterogener ist der bis zum
Schaupenstiel reichende Straßenabschnitt
Breite Straße 12-35, der durch Kuhgasse,
Kirchstraße und Feuergasse unterteilt wird.
Zurückverfolgen lässt sich der überkommene
Althausbestand bis in die 1. Hälfte des 16.Jh.
(Breite Straße 31). Trotz seiner massiven
baulichen Eingriffe in Erd- und Zwischen-
geschoss vermag der siebenachsige
Traufenbau einen Akzent in der Bauzeile zu set-
zen. Seine weit ausladende Gebälkzone wurde
Am Münster 15. Ehern. "Plessisches Lehnshaus", frühes 17.Jh.
Breite Straße 60, 61 ff. Wiederaufbauten des frühen 19.Jh.
231