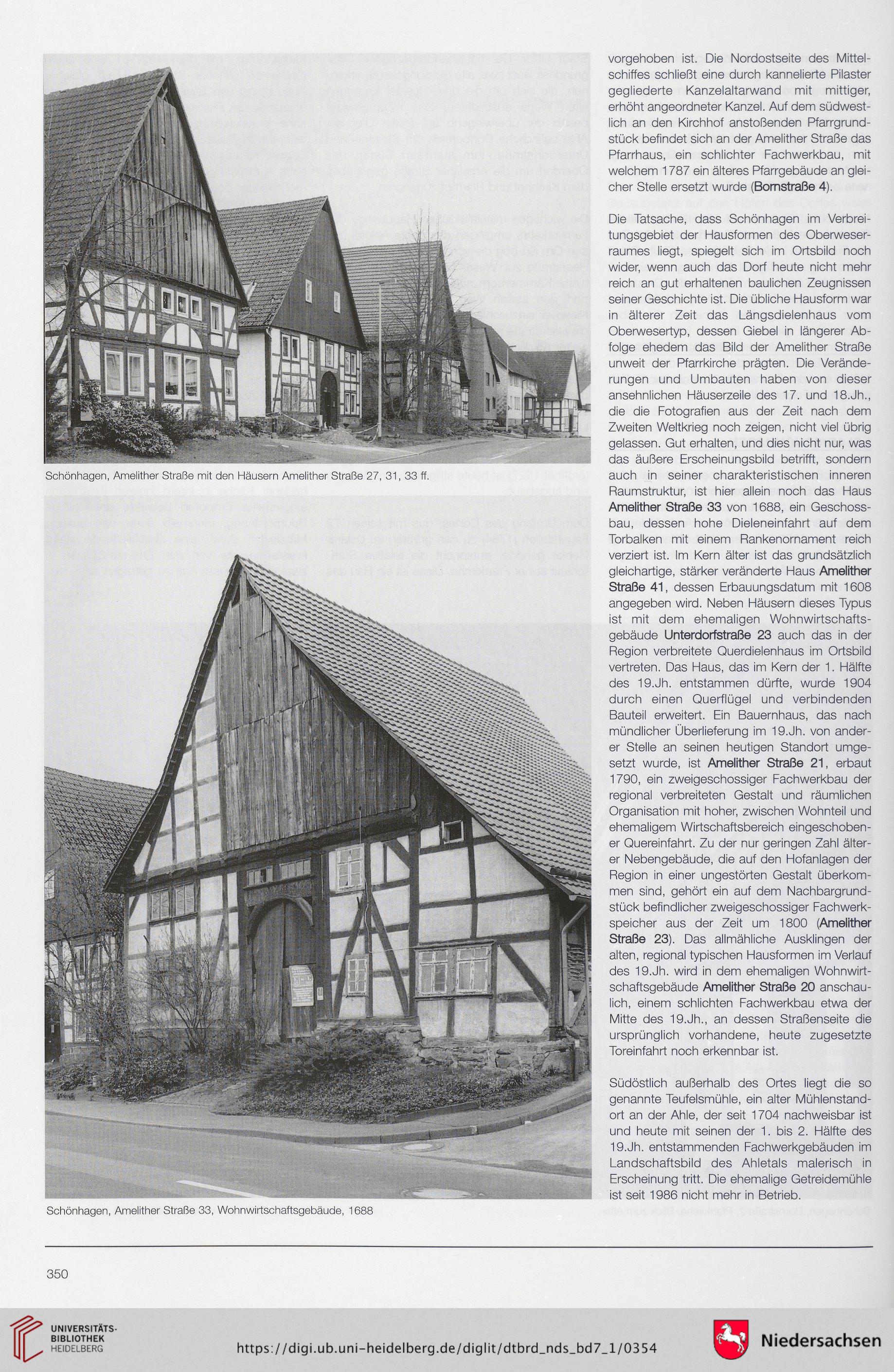Schönhagen, Amelither Straße mit den Häusern Amelither Straße 27, 31,33 ff.
Schönhagen, Amelither Straße 33, Wohnwirtschaftsgebäude, 1688
vorgehoben ist. Die Nordostseite des Mittel-
schiffes schließt eine durch kannelierte Pilaster
gegliederte Kanzelaltarwand mit mittiger,
erhöht angeordneter Kanzel. Auf dem südwest-
lich an den Kirchhof anstoßenden Pfarrgrund-
stück befindet sich an der Amelither Straße das
Pfarrhaus, ein schlichter Fachwerkbau, mit
welchem 1787 ein älteres Pfarrgebäude an glei-
cher Stelle ersetzt wurde (Bomstraße 4).
Die Tatsache, dass Schönhagen im Verbrei-
tungsgebiet der Hausformen des Oberweser-
raumes liegt, spiegelt sich im Ortsbild noch
wider, wenn auch das Dorf heute nicht mehr
reich an gut erhaltenen baulichen Zeugnissen
seiner Geschichte ist. Die übliche Hausform war
in älterer Zeit das Längsdielenhaus vom
Oberwesertyp, dessen Giebel in längerer Ab-
folge ehedem das Bild der Amelither Straße
unweit der Pfarrkirche prägten. Die Verände-
rungen und Umbauten haben von dieser
ansehnlichen Häuserzeile des 17. und 18.Jh.,
die die Fotografien aus der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg noch zeigen, nicht viel übrig
gelassen. Gut erhalten, und dies nicht nur, was
das äußere Erscheinungsbild betrifft, sondern
auch in seiner charakteristischen inneren
Raumstruktur, ist hier allein noch das Haus
Amelither Straße 33 von 1688, ein Geschoss-
bau, dessen hohe Dieleneinfahrt auf dem
Torbalken mit einem Rankenornament reich
verziert ist. Im Kern älter ist das grundsätzlich
gleichartige, stärker veränderte Haus Amelither
Straße 41, dessen Erbauungsdatum mit 1608
angegeben wird. Neben Häusern dieses Typus
ist mit dem ehemaligen Wohnwirtschafts-
gebäude Unterdorfstraße 23 auch das in der
Region verbreitete Querdielenhaus im Ortsbild
vertreten. Das Haus, das im Kern der 1. Hälfte
des 19,Jh. entstammen dürfte, wurde 1904
durch einen Querflügel und verbindenden
Bauteil erweitert. Ein Bauernhaus, das nach
mündlicher Überlieferung im 19.Jh. von ander-
er Stelle an seinen heutigen Standort umge-
setzt wurde, ist Amelither Straße 21, erbaut
1790, ein zweigeschossiger Fachwerkbau der
regional verbreiteten Gestalt und räumlichen
Organisation mit hoher, zwischen Wohnteil und
ehemaligem Wirtschaftsbereich eingeschoben-
er Quereinfahrt. Zu der nur geringen Zahl älter-
er Nebengebäude, die auf den Hofanlagen der
Region in einer ungestörten Gestalt überkom-
men sind, gehört ein auf dem Nachbargrund-
stück befindlicher zweigeschossiger Fachwerk-
speicher aus der Zeit um 1800 (Amelither
Straße 23). Das allmähliche Ausklingen der
alten, regional typischen Hausformen im Verlauf
des 19.Jh. wird in dem ehemaligen Wohnwirt-
schaftsgebäude Amelither Straße 20 anschau-
lich, einem schlichten Fachwerkbau etwa der
Mitte des 19.Jh., an dessen Straßenseite die
ursprünglich vorhandene, heute zugesetzte
Toreinfahrt noch erkennbar ist.
Südöstlich außerhalb des Ortes liegt die so
genannte Teufelsmühle, ein alter Mühlenstand-
ort an der Ahle, der seit 1704 nachweisbar ist
und heute mit seinen der 1. bis 2. Hälfte des
19.Jh. entstammenden Fachwerkgebäuden im
Landschaftsbild des Ahletals malerisch in
Erscheinung tritt. Die ehemalige Getreidemühle
ist seit 1986 nicht mehr in Betrieb.
350
Schönhagen, Amelither Straße 33, Wohnwirtschaftsgebäude, 1688
vorgehoben ist. Die Nordostseite des Mittel-
schiffes schließt eine durch kannelierte Pilaster
gegliederte Kanzelaltarwand mit mittiger,
erhöht angeordneter Kanzel. Auf dem südwest-
lich an den Kirchhof anstoßenden Pfarrgrund-
stück befindet sich an der Amelither Straße das
Pfarrhaus, ein schlichter Fachwerkbau, mit
welchem 1787 ein älteres Pfarrgebäude an glei-
cher Stelle ersetzt wurde (Bomstraße 4).
Die Tatsache, dass Schönhagen im Verbrei-
tungsgebiet der Hausformen des Oberweser-
raumes liegt, spiegelt sich im Ortsbild noch
wider, wenn auch das Dorf heute nicht mehr
reich an gut erhaltenen baulichen Zeugnissen
seiner Geschichte ist. Die übliche Hausform war
in älterer Zeit das Längsdielenhaus vom
Oberwesertyp, dessen Giebel in längerer Ab-
folge ehedem das Bild der Amelither Straße
unweit der Pfarrkirche prägten. Die Verände-
rungen und Umbauten haben von dieser
ansehnlichen Häuserzeile des 17. und 18.Jh.,
die die Fotografien aus der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg noch zeigen, nicht viel übrig
gelassen. Gut erhalten, und dies nicht nur, was
das äußere Erscheinungsbild betrifft, sondern
auch in seiner charakteristischen inneren
Raumstruktur, ist hier allein noch das Haus
Amelither Straße 33 von 1688, ein Geschoss-
bau, dessen hohe Dieleneinfahrt auf dem
Torbalken mit einem Rankenornament reich
verziert ist. Im Kern älter ist das grundsätzlich
gleichartige, stärker veränderte Haus Amelither
Straße 41, dessen Erbauungsdatum mit 1608
angegeben wird. Neben Häusern dieses Typus
ist mit dem ehemaligen Wohnwirtschafts-
gebäude Unterdorfstraße 23 auch das in der
Region verbreitete Querdielenhaus im Ortsbild
vertreten. Das Haus, das im Kern der 1. Hälfte
des 19,Jh. entstammen dürfte, wurde 1904
durch einen Querflügel und verbindenden
Bauteil erweitert. Ein Bauernhaus, das nach
mündlicher Überlieferung im 19.Jh. von ander-
er Stelle an seinen heutigen Standort umge-
setzt wurde, ist Amelither Straße 21, erbaut
1790, ein zweigeschossiger Fachwerkbau der
regional verbreiteten Gestalt und räumlichen
Organisation mit hoher, zwischen Wohnteil und
ehemaligem Wirtschaftsbereich eingeschoben-
er Quereinfahrt. Zu der nur geringen Zahl älter-
er Nebengebäude, die auf den Hofanlagen der
Region in einer ungestörten Gestalt überkom-
men sind, gehört ein auf dem Nachbargrund-
stück befindlicher zweigeschossiger Fachwerk-
speicher aus der Zeit um 1800 (Amelither
Straße 23). Das allmähliche Ausklingen der
alten, regional typischen Hausformen im Verlauf
des 19.Jh. wird in dem ehemaligen Wohnwirt-
schaftsgebäude Amelither Straße 20 anschau-
lich, einem schlichten Fachwerkbau etwa der
Mitte des 19.Jh., an dessen Straßenseite die
ursprünglich vorhandene, heute zugesetzte
Toreinfahrt noch erkennbar ist.
Südöstlich außerhalb des Ortes liegt die so
genannte Teufelsmühle, ein alter Mühlenstand-
ort an der Ahle, der seit 1704 nachweisbar ist
und heute mit seinen der 1. bis 2. Hälfte des
19.Jh. entstammenden Fachwerkgebäuden im
Landschaftsbild des Ahletals malerisch in
Erscheinung tritt. Die ehemalige Getreidemühle
ist seit 1986 nicht mehr in Betrieb.
350