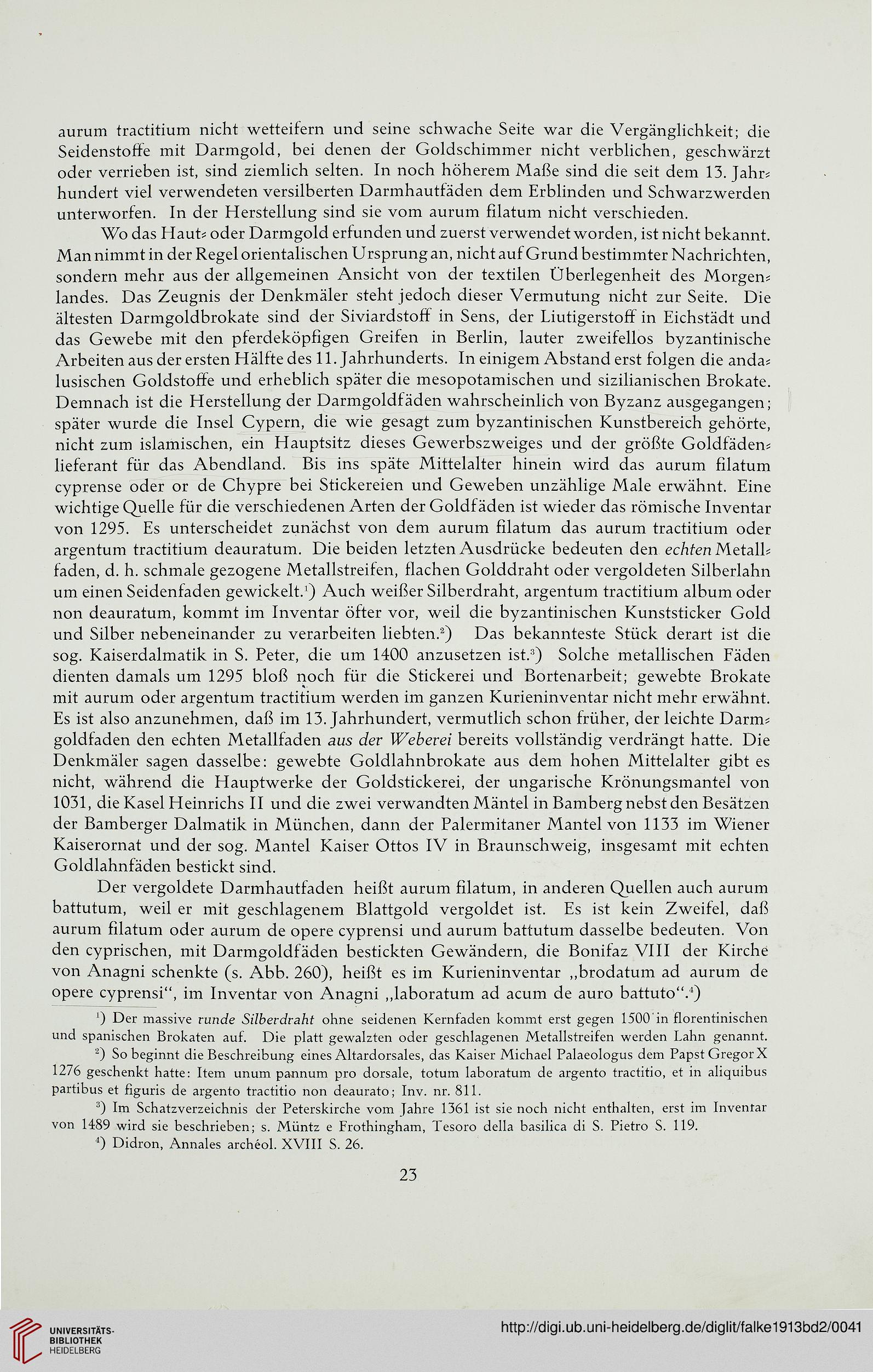aurum tractitium nicht wetteifern und seine schwache Seite war die Vergänglichkeit; die
Seidenstoffe mit Darmgold, bei denen der Goldschimmer nicht verblichen, geschwärzt
oder verrieben ist, sind ziemlich selten. In noch höherem Maße sind die seit dem 13. Jahr*
hundert viel verwendeten versilberten Darmhautfäden dem Erblinden und Schwarzwerden
unterworfen. In der Herstellung sind sie vom aurum filatum nicht verschieden.
Wo das Haut* oder Darmgold erfunden und zuerst verwendet worden, ist nicht bekannt.
Man nimmt in der Regel orientalischen Ursprung an, nicht auf Grund bestimmter Nachrichten,
sondern mehr aus der allgemeinen Ansicht von der textilen Überlegenheit des Morgen?
landes. Das Zeugnis der Denkmäler steht jedoch dieser Vermutung nicht zur Seite. Die
ältesten Darmgoldbrokate sind der Siviardstoff in Sens, der Liutigerstoff in Eichstädt und
das Gewebe mit den pferdeköpfigen Greifen in Berlin, lauter zweifellos byzantinische
Arbeiten aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. In einigem Abstand erst folgen die anda*
lusischen Goldstoffe und erheblich später die mesopotamischen und sizilianischen Brokate.
Demnach ist die Herstellung der Darmgoldfäden wahrscheinlich von Byzanz ausgegangen;
später wurde die Insel Cypern, die wie gesagt zum byzantinischen Kunstbereich gehörte,
nicht zum islamischen, ein Hauptsitz dieses Gewerbszweiges und der größte Goldfäden*
lieferant für das Abendland. Bis ins späte Mittelalter hinein wird das aurum filatum
cyprense oder or de Chypre bei Stickereien und Geweben unzählige Male erwähnt. Eine
wichtige Quelle für die verschiedenen Arten der Goldfäden ist wieder das römische Inventar
von 1295. Es unterscheidet zunächst von dem aurum filatum das aurum tractitium oder
argentum tractitium deauratum. Die beiden letzten Ausdrücke bedeuten den echten Metall*
faden, d. h. schmale gezogene Metallstreifen, flachen Golddraht oder vergoldeten Silberlahn
um einen Seidenfaden gewickelt.1) Auch weißer Silberdraht, argentum tractitium album oder
non deauratum, kommt im Inventar öfter vor, weil die byzantinischen Kunststicker Gold
und Silber nebeneinander zu verarbeiten liebten.2) Das bekannteste Stück derart ist die
sog. Kaiserdalmatik in S. Peter, die um 1400 anzusetzen ist.3) Solche metallischen Fäden
dienten damals um 1295 bloß noch für die Stickerei und Bortenarbeit; gewebte Brokate
mit aurum oder argentum tractitium werden im ganzen Kurieninventar nicht mehr erwähnt.
Es ist also anzunehmen, daß im 13. Jahrhundert, vermutlich schon früher, der leichte Darm*
goldfaden den echten Metallfaden aus der Weberei bereits vollständig verdrängt hatte. Die
Denkmäler sagen dasselbe: gewebte Goldlahnbrokate aus dem hohen Mittelalter gibt es
nicht, während die Hauptwerke der Goldstickerei, der ungarische Krönungsmantel von
1031, die Kasel Heinrichs II und die zwei verwandten Mäntel in Bamberg nebst den Besätzen
der Bamberger Dalmatik in München, dann der Palermitaner Mantel von 1133 im Wiener
Kaiserornat und der sog. Mantel Kaiser Ottos IV in Braunschweig, insgesamt mit echten
Goldlahnfäden bestickt sind.
Der vergoldete Darmhautfaden heißt aurum filatum, in anderen Quellen auch aurum
battutum, weil er mit geschlagenem Blattgold vergoldet ist. Es ist kein Zweifel, daß
aurum filatum oder aurum de opere cyprensi und aurum battutum dasselbe bedeuten. Von
den cyprischen, mit Darmgoldfäden bestickten Gewändern, die Bonifaz VIII der Kirche
von Anagni schenkte (s. Abb. 260), heißt es im Kurieninventar ,,brodatum ad aurum de
opere cyprensi", im Inventar von Anagni „laboratum ad acum de auro battuto".4)
') Der massive runde Silberdraht ohne seidenen Kernfaden kommt erst gegen 1500 in florentinischen
und spanischen Brokaten auf. Die platt gewalzten oder geschlagenen Metallstreifen werden Lahn genannt.
2) So beginnt die Beschreibung eines Altardorsales, das Kaiser Michael Palaeologus dem Papst Gregor X
1276 geschenkt hatte: Item unum pannum pro dorsale, totum laboratum de argento tractitio, et in aliquibus
partibus et figuris de argento tractitio non deaurato; Inv. nr. 811.
') Im Schatzverzeichnis der Peterskirche vom Jahre 1361 ist sie noch nicht enthalten, erst im Inventar
von 1489 wird sie beschrieben; s. Müntz e Frothingham, Tesoro della basilica di S. Pietro S. 119.
') Didron, Annales archeol. XVIII S. 26.
23
Seidenstoffe mit Darmgold, bei denen der Goldschimmer nicht verblichen, geschwärzt
oder verrieben ist, sind ziemlich selten. In noch höherem Maße sind die seit dem 13. Jahr*
hundert viel verwendeten versilberten Darmhautfäden dem Erblinden und Schwarzwerden
unterworfen. In der Herstellung sind sie vom aurum filatum nicht verschieden.
Wo das Haut* oder Darmgold erfunden und zuerst verwendet worden, ist nicht bekannt.
Man nimmt in der Regel orientalischen Ursprung an, nicht auf Grund bestimmter Nachrichten,
sondern mehr aus der allgemeinen Ansicht von der textilen Überlegenheit des Morgen?
landes. Das Zeugnis der Denkmäler steht jedoch dieser Vermutung nicht zur Seite. Die
ältesten Darmgoldbrokate sind der Siviardstoff in Sens, der Liutigerstoff in Eichstädt und
das Gewebe mit den pferdeköpfigen Greifen in Berlin, lauter zweifellos byzantinische
Arbeiten aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. In einigem Abstand erst folgen die anda*
lusischen Goldstoffe und erheblich später die mesopotamischen und sizilianischen Brokate.
Demnach ist die Herstellung der Darmgoldfäden wahrscheinlich von Byzanz ausgegangen;
später wurde die Insel Cypern, die wie gesagt zum byzantinischen Kunstbereich gehörte,
nicht zum islamischen, ein Hauptsitz dieses Gewerbszweiges und der größte Goldfäden*
lieferant für das Abendland. Bis ins späte Mittelalter hinein wird das aurum filatum
cyprense oder or de Chypre bei Stickereien und Geweben unzählige Male erwähnt. Eine
wichtige Quelle für die verschiedenen Arten der Goldfäden ist wieder das römische Inventar
von 1295. Es unterscheidet zunächst von dem aurum filatum das aurum tractitium oder
argentum tractitium deauratum. Die beiden letzten Ausdrücke bedeuten den echten Metall*
faden, d. h. schmale gezogene Metallstreifen, flachen Golddraht oder vergoldeten Silberlahn
um einen Seidenfaden gewickelt.1) Auch weißer Silberdraht, argentum tractitium album oder
non deauratum, kommt im Inventar öfter vor, weil die byzantinischen Kunststicker Gold
und Silber nebeneinander zu verarbeiten liebten.2) Das bekannteste Stück derart ist die
sog. Kaiserdalmatik in S. Peter, die um 1400 anzusetzen ist.3) Solche metallischen Fäden
dienten damals um 1295 bloß noch für die Stickerei und Bortenarbeit; gewebte Brokate
mit aurum oder argentum tractitium werden im ganzen Kurieninventar nicht mehr erwähnt.
Es ist also anzunehmen, daß im 13. Jahrhundert, vermutlich schon früher, der leichte Darm*
goldfaden den echten Metallfaden aus der Weberei bereits vollständig verdrängt hatte. Die
Denkmäler sagen dasselbe: gewebte Goldlahnbrokate aus dem hohen Mittelalter gibt es
nicht, während die Hauptwerke der Goldstickerei, der ungarische Krönungsmantel von
1031, die Kasel Heinrichs II und die zwei verwandten Mäntel in Bamberg nebst den Besätzen
der Bamberger Dalmatik in München, dann der Palermitaner Mantel von 1133 im Wiener
Kaiserornat und der sog. Mantel Kaiser Ottos IV in Braunschweig, insgesamt mit echten
Goldlahnfäden bestickt sind.
Der vergoldete Darmhautfaden heißt aurum filatum, in anderen Quellen auch aurum
battutum, weil er mit geschlagenem Blattgold vergoldet ist. Es ist kein Zweifel, daß
aurum filatum oder aurum de opere cyprensi und aurum battutum dasselbe bedeuten. Von
den cyprischen, mit Darmgoldfäden bestickten Gewändern, die Bonifaz VIII der Kirche
von Anagni schenkte (s. Abb. 260), heißt es im Kurieninventar ,,brodatum ad aurum de
opere cyprensi", im Inventar von Anagni „laboratum ad acum de auro battuto".4)
') Der massive runde Silberdraht ohne seidenen Kernfaden kommt erst gegen 1500 in florentinischen
und spanischen Brokaten auf. Die platt gewalzten oder geschlagenen Metallstreifen werden Lahn genannt.
2) So beginnt die Beschreibung eines Altardorsales, das Kaiser Michael Palaeologus dem Papst Gregor X
1276 geschenkt hatte: Item unum pannum pro dorsale, totum laboratum de argento tractitio, et in aliquibus
partibus et figuris de argento tractitio non deaurato; Inv. nr. 811.
') Im Schatzverzeichnis der Peterskirche vom Jahre 1361 ist sie noch nicht enthalten, erst im Inventar
von 1489 wird sie beschrieben; s. Müntz e Frothingham, Tesoro della basilica di S. Pietro S. 119.
') Didron, Annales archeol. XVIII S. 26.
23