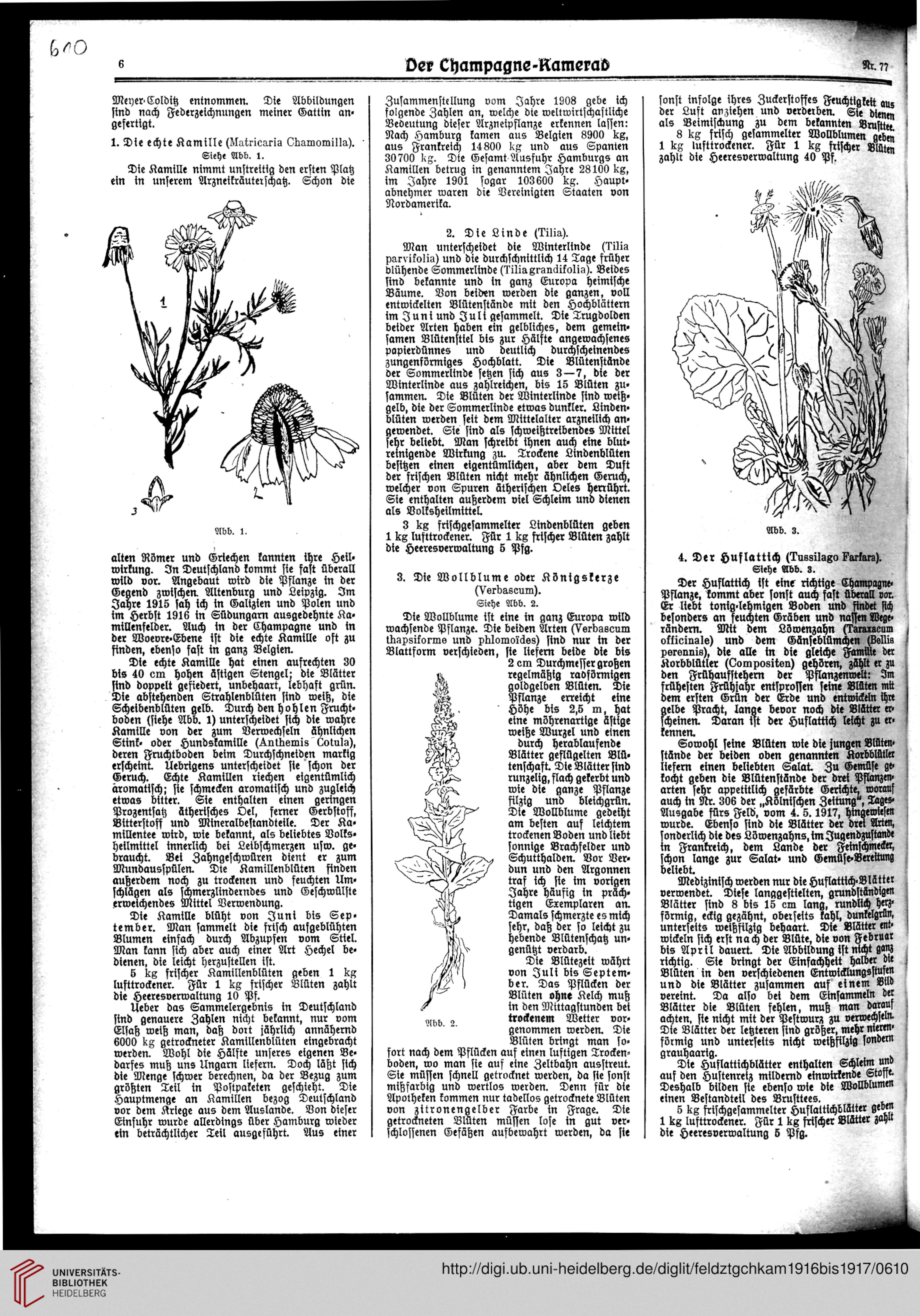6
Oer champagne-Nameraö
Meyer-Colditz entnommen. Die Abbildungen
stnd nach Federzeichnungen meiner Gattin an-
gefertigt.
1. Die echte Kamille (Llati-icaris OLLmomillg.).
Siehe Abb. 1.
Die Kamille nimmt unstreitig den ersten Platz
ein in unserem Arzneikräuterschatz. Schon die
alten Römer und Griechen kannten ihre Heil-
wirkung. Jn Deutschland kommt sie fast überall
wild vor. Angebaut wird dte Pflanze in der
Eegend zwischen. Altenburg und Leipzig. Jm
Jahre 1915 sah ich in Galtzien und Polen und
im Herbst 1916 in Südungarn ausgedehnte Ka«
millenfelder. Auch in der Champagne und in
der Woevre-Ebene ist die echte Kamille oft zu
finden, ebenso fast in ganz Belgien.
Die echte Kamille hat einen aufrechten 30
bis 40 em hohen Lstigen Stengel; die Blätter
stnd doppelt gefiedert, unbehaart, lebhaft grün.
Die abstehenden Strahlenblüten sind weitz, die
Scheibenblüten gelb. Durch den hohlen Frucht-
boden (siehe Abb. 1) unterscheidet sich die wahre
Kamille von der zum Verwechseln Shnlichen
Stink- oder Hundskamille (^nldkmis Ootulg),
deren Fruchtboden beim Durchschneiden markig
erscheint. Uebrigens unterscheidet sie schon der
Geruch. Echte Kamillen riechen eigentümlich
äromatisch; sie schmecken aromatisch und zugleich
etwas bitter. Sie enthalten einen geringen
Prozentsatz Stherisches Oel, ferner Gerbstoff,
Bitterstoff und Mineralbestandteile. Der Ka>
millentee wird, wie bekannt, als beliebtes Volks«
heilmittel innerlich bei Leibschmerzen usw. ge-
braucht. Bei Zahngeschwüren dient er zum
Mundausspülen. Dte Kamillenblüten finden
autzerdem noch zu trockenen und feuchten Um-
schlSgen als schmerzlinderndes und Geschwülste
erweichendes Mittel Verwendung.
Die Kamille blüht von Juni bis Sep«
tember. Man sammelt die frtsch aufgeblühten
Blumen einfach durch Abzupfen vom Sttel.
Man kann sich aber auch einer Art Hechel be-
dienen, die leicht herzustellen ist.
6 kg frischer Kamillenblüten geben 1 kj;
lufttrockener. Für 1 frtscher Vlüten zahlt
die Heeresverwaltung 10 Pf.
Ueber das Sammelergebnis in Deutschland
sind genauere Zahlen nicht bekannt, nur vom
Elsatz weitz man, datz dort jährlich annähernd
6000 getrockneter Kamillenblüten eingebracht
werden. Wohl die HSlfte unseres eigenen Be-
darfes muh uns Ungarn liefern. Doch lätzt sich
die Menge schwer berechnen, da der Bezug zum
gröhten Teil in Postpaketen geschieht. Die
Hauptmenge an Kamillen bezog Deutschland
vor dem Kriege aus dem Auslande. Von dieser
Einfuhr wurde allerdings über Hamburg wieder
ein beträchtlicher Teil ausgeführt. Aus einer
Zusammenstellung vom Jahre 1908 gebe ich
folgende Zahlen an. welche dte weltwirtschaftliche
Bedeutung dieser Arzneipflanze erkennen lassen:
Nach Hamburg kamen aus Belgien 8900 kx,
aus Frankreich 14800 kx und aus Spanten
30700 IiF. Dte Gesamt Ausfuhr Hamburgs an
Kamillen betrug in genanntem Jahre 28100 Icg,
im Jahre 1901 sogar 103600 Irx. Haupt-
2. Die Linde Crilia).
Man unterscheidet die Winterlinde Csilia
parvikolia) und die durchschnittlich 14 Tage früher
dlühende Sommerlinde ('I'iliLxi'guclikolia). Beides
sind bekannte und in ganz Europa heimische
Däume. Von beiden werden die ganzen, voll
entwickelten Blütenstände mit den Hochblättern
im Iuni und Iuli gesammelt. Die Trugdolden
beider Arten haben ein gelbliches, dem gemetn-
samen Blütenstiel bis zur Hälfte angewachsenes
papierdünnes und deutlich durchscheinendes
zungenförmiges Hochblatt. Die Blütenstände
der Sommerlinde setzen sich aus 3—7, die der
Winterlinde aus zahlreichen, bis 15 Blüten zu-
sammen. Die Blüten der Winterlinde sind weitz«
gelb, die der Sommerlinde etwas dunkler. Linden-
blüten werden selt dem Mtttelalter arzneilich an>
gewendet. Sie sind als schweitztreibendes Mittel
sebr beliebt. Man schreibt ihnen auch eine blut«
reinigende Wirkung zu. Trockene Lindenblüten
besitzen einen eigentümlichen, aber dem Duft
der frischen Blüten nicht mehr ähnlichen Geruch,
welcher von Spuren Stherischen Oeles henührt.
Sie enthalten autzerdem viel Schleim und dienen
als Volksheilmittel.
3 Icß frischgesammelter Lindenblüten geben
1 KZ lufttrockener. Für 1 kg ftischer Blüten zahlt
die Heeresverwaltung 5 Psg.
3. Die Wollblume oder Königskerze
(Vsrdaseum).
Siehe Abb. 2.
Die Wollblume ist eine in ganz Europa wild
wachsende Pslanze. Die beiden Arten (Vsrbssoum
tbapsikorws und xblomoickss) sind nur in der
Blattform verschieden, ste liefern beide die bis
2 em Durchmessergrohen
regelmähtg raoförmigen
goldgelben Blüten. Die
Pflanze erreicht eine
Höhe bis 2,6 m, hat
etne möhrenartige Sstige
weitze Wurzel und einen
durch herablaufende
Blätter geflügelten Blü-
tenschast. Dte Blätter sind
runzelig.flach gekerbt und
wie die ganze Pflanze
filzig und bleichgrün.
Die Wollblume gedeiht
am besten auf letchtem
trockenen Boden und liebt
sonnige Brachfelder und
Schutthalden. Vor Ver«
dun und den Argonnen
traf ich sie im vorigen
Jahre häufig in präch«
ttgen Eremplaren an.
Damals schmerzte es mich
sehr, datz der so leicht zu
hebende Blütenschah un«
genützt verdarb.
Die Blütezeit währt
von Juli bis Septem-
ber. Das Pflücken der
Blüten ohne Kelch mutz
in den Mittagstunden bei
trockenem Wetter vor«
genommen werden. Die
Blüten bringt man so-
fort nach dem Pflücken auf einen luftigen Trocken-
boden, wo man sie auf eine Zeltbahn ausstreut.
Sie müffen schnell getrocknet werden, da sie sonst
mitzfarbig und wertlos werden. Denn für die
Apotheken kommen nur tadellos getrocknete Vlüten
von zitronengelber Farbe in Frage. Dte
getrockneten Vlüten müffen lose in gut ver-
schlossenen Gefätzen aufbewahrt werden, da sie
Nr. 77
sonst infolge ihres Zuckerstoffes Feuchtigkeit aus
der Luft anziehen und verderben. Sie dienen
als Beimisckung zu dem bekannten Brusttee.
8 frisch gesammelter Wollblumen aebrn
1 k§ lufttrockener. Jür 1 Icg ftischer Blüten
zahlt die Heeresverwaltung 40 Pf.
4. Der Huflattich (^ussilsxo karkars).
Siehe Abb. 8.
Der Huflattich ist eine richtige Champagne«
Pflanze, kommt aber sonst auch sast überall vor.
Er liebt tonig-lehmigen Boden und findet sich
besonders an seuchten Gräben und naffen Wege-
rändern. Mit dem Löwenzahn frsrarseuin
okkieiusls) und dem Gänseblümchen (Lsllis
xsrsnnis), die alle tn die gleiche Famllie drr
Korbblütler (Oompositsn) gehören, zählt er zu
den Frühaufstehern der Pflanzenwelt: Jm
frühesten Frühjahr entsproffen seine Blüten mtt
dem ersten Grün der Erde und entwickeln ihre
gelbe Pracht, lana« bevor noch die Blätter er>
scheinen. Daran ist der Huflattich leicht zu er-
kennen.
Sowohl seine Blüten wie die jungen Blüten-
stände der beiden oben genannten Korbblütler
liefern einen beliebten Salat. Zu Gemüse ge>
kocht geben die Blütenstände der drei Pflanzen«
arten sehr appetitlich gefärbte Gerichte, worauf
auch in Nr. 306 der „Kölnischen Zeitung , Tages-
Ausgabe fürs Feld, vom 4. 5.1917, htnaewiesen
wurde. Ebenso slnd die Blätter der drn Arten,
sonderlich die des Löwenzahns.imJugendzustandr
in Frankreich, dem Lande der Feinschmecker,
schon lange zur Salat- und Gemüse-Bereitung
beliebt.
Medizinisch werden nur die Huflattich-Blätter
verwendet. Diese langgestielten, grundständigen
Blätter sind 8 bis 15 om lang, rundlich herz-
förmig, ecktg gezähnt, oberseits kahl, dunkelgrün,
unterseits weihfilzig behaart. Die Blätter ent«
wickeln sich erst nach der Blüte, die von Februar
bis April dauert. Die Abbildung ist nicht ganz
richtig. Sie bringt der Einfachheit halber dte
Blüten in den oerschiedenen Entwicklungsstusen
und die Blätter zusammen auf einem Btld
vereint. Da also bei dem Einsammeln der
Blätter die Blüten fehlen, mutz man daraus
achten, sie nicht mit der Pestwurz zu verwechseln.
Die Blätter der letzteren sind grötzer, mehr nieren«
förmig und unterseits nicht weitzfilzig sondem
grauhaarig. .
Dte Huflattichblätter enthalten Schleim und
auf den Hustenreiz mildernd einwirkende Stosse.
Deshalb bilden ste ebenso wie die Wollblumen
einen Bestandteil des Brusttees.
5 k§ frischgesammelter Huflattichblätter geben
11cx lufttrockener. Für 11cx ftischer Blätter zahu
die Heeresverwaltung 5 Pfg.
Oer champagne-Nameraö
Meyer-Colditz entnommen. Die Abbildungen
stnd nach Federzeichnungen meiner Gattin an-
gefertigt.
1. Die echte Kamille (Llati-icaris OLLmomillg.).
Siehe Abb. 1.
Die Kamille nimmt unstreitig den ersten Platz
ein in unserem Arzneikräuterschatz. Schon die
alten Römer und Griechen kannten ihre Heil-
wirkung. Jn Deutschland kommt sie fast überall
wild vor. Angebaut wird dte Pflanze in der
Eegend zwischen. Altenburg und Leipzig. Jm
Jahre 1915 sah ich in Galtzien und Polen und
im Herbst 1916 in Südungarn ausgedehnte Ka«
millenfelder. Auch in der Champagne und in
der Woevre-Ebene ist die echte Kamille oft zu
finden, ebenso fast in ganz Belgien.
Die echte Kamille hat einen aufrechten 30
bis 40 em hohen Lstigen Stengel; die Blätter
stnd doppelt gefiedert, unbehaart, lebhaft grün.
Die abstehenden Strahlenblüten sind weitz, die
Scheibenblüten gelb. Durch den hohlen Frucht-
boden (siehe Abb. 1) unterscheidet sich die wahre
Kamille von der zum Verwechseln Shnlichen
Stink- oder Hundskamille (^nldkmis Ootulg),
deren Fruchtboden beim Durchschneiden markig
erscheint. Uebrigens unterscheidet sie schon der
Geruch. Echte Kamillen riechen eigentümlich
äromatisch; sie schmecken aromatisch und zugleich
etwas bitter. Sie enthalten einen geringen
Prozentsatz Stherisches Oel, ferner Gerbstoff,
Bitterstoff und Mineralbestandteile. Der Ka>
millentee wird, wie bekannt, als beliebtes Volks«
heilmittel innerlich bei Leibschmerzen usw. ge-
braucht. Bei Zahngeschwüren dient er zum
Mundausspülen. Dte Kamillenblüten finden
autzerdem noch zu trockenen und feuchten Um-
schlSgen als schmerzlinderndes und Geschwülste
erweichendes Mittel Verwendung.
Die Kamille blüht von Juni bis Sep«
tember. Man sammelt die frtsch aufgeblühten
Blumen einfach durch Abzupfen vom Sttel.
Man kann sich aber auch einer Art Hechel be-
dienen, die leicht herzustellen ist.
6 kg frischer Kamillenblüten geben 1 kj;
lufttrockener. Für 1 frtscher Vlüten zahlt
die Heeresverwaltung 10 Pf.
Ueber das Sammelergebnis in Deutschland
sind genauere Zahlen nicht bekannt, nur vom
Elsatz weitz man, datz dort jährlich annähernd
6000 getrockneter Kamillenblüten eingebracht
werden. Wohl die HSlfte unseres eigenen Be-
darfes muh uns Ungarn liefern. Doch lätzt sich
die Menge schwer berechnen, da der Bezug zum
gröhten Teil in Postpaketen geschieht. Die
Hauptmenge an Kamillen bezog Deutschland
vor dem Kriege aus dem Auslande. Von dieser
Einfuhr wurde allerdings über Hamburg wieder
ein beträchtlicher Teil ausgeführt. Aus einer
Zusammenstellung vom Jahre 1908 gebe ich
folgende Zahlen an. welche dte weltwirtschaftliche
Bedeutung dieser Arzneipflanze erkennen lassen:
Nach Hamburg kamen aus Belgien 8900 kx,
aus Frankreich 14800 kx und aus Spanten
30700 IiF. Dte Gesamt Ausfuhr Hamburgs an
Kamillen betrug in genanntem Jahre 28100 Icg,
im Jahre 1901 sogar 103600 Irx. Haupt-
2. Die Linde Crilia).
Man unterscheidet die Winterlinde Csilia
parvikolia) und die durchschnittlich 14 Tage früher
dlühende Sommerlinde ('I'iliLxi'guclikolia). Beides
sind bekannte und in ganz Europa heimische
Däume. Von beiden werden die ganzen, voll
entwickelten Blütenstände mit den Hochblättern
im Iuni und Iuli gesammelt. Die Trugdolden
beider Arten haben ein gelbliches, dem gemetn-
samen Blütenstiel bis zur Hälfte angewachsenes
papierdünnes und deutlich durchscheinendes
zungenförmiges Hochblatt. Die Blütenstände
der Sommerlinde setzen sich aus 3—7, die der
Winterlinde aus zahlreichen, bis 15 Blüten zu-
sammen. Die Blüten der Winterlinde sind weitz«
gelb, die der Sommerlinde etwas dunkler. Linden-
blüten werden selt dem Mtttelalter arzneilich an>
gewendet. Sie sind als schweitztreibendes Mittel
sebr beliebt. Man schreibt ihnen auch eine blut«
reinigende Wirkung zu. Trockene Lindenblüten
besitzen einen eigentümlichen, aber dem Duft
der frischen Blüten nicht mehr ähnlichen Geruch,
welcher von Spuren Stherischen Oeles henührt.
Sie enthalten autzerdem viel Schleim und dienen
als Volksheilmittel.
3 Icß frischgesammelter Lindenblüten geben
1 KZ lufttrockener. Für 1 kg ftischer Blüten zahlt
die Heeresverwaltung 5 Psg.
3. Die Wollblume oder Königskerze
(Vsrdaseum).
Siehe Abb. 2.
Die Wollblume ist eine in ganz Europa wild
wachsende Pslanze. Die beiden Arten (Vsrbssoum
tbapsikorws und xblomoickss) sind nur in der
Blattform verschieden, ste liefern beide die bis
2 em Durchmessergrohen
regelmähtg raoförmigen
goldgelben Blüten. Die
Pflanze erreicht eine
Höhe bis 2,6 m, hat
etne möhrenartige Sstige
weitze Wurzel und einen
durch herablaufende
Blätter geflügelten Blü-
tenschast. Dte Blätter sind
runzelig.flach gekerbt und
wie die ganze Pflanze
filzig und bleichgrün.
Die Wollblume gedeiht
am besten auf letchtem
trockenen Boden und liebt
sonnige Brachfelder und
Schutthalden. Vor Ver«
dun und den Argonnen
traf ich sie im vorigen
Jahre häufig in präch«
ttgen Eremplaren an.
Damals schmerzte es mich
sehr, datz der so leicht zu
hebende Blütenschah un«
genützt verdarb.
Die Blütezeit währt
von Juli bis Septem-
ber. Das Pflücken der
Blüten ohne Kelch mutz
in den Mittagstunden bei
trockenem Wetter vor«
genommen werden. Die
Blüten bringt man so-
fort nach dem Pflücken auf einen luftigen Trocken-
boden, wo man sie auf eine Zeltbahn ausstreut.
Sie müffen schnell getrocknet werden, da sie sonst
mitzfarbig und wertlos werden. Denn für die
Apotheken kommen nur tadellos getrocknete Vlüten
von zitronengelber Farbe in Frage. Dte
getrockneten Vlüten müffen lose in gut ver-
schlossenen Gefätzen aufbewahrt werden, da sie
Nr. 77
sonst infolge ihres Zuckerstoffes Feuchtigkeit aus
der Luft anziehen und verderben. Sie dienen
als Beimisckung zu dem bekannten Brusttee.
8 frisch gesammelter Wollblumen aebrn
1 k§ lufttrockener. Jür 1 Icg ftischer Blüten
zahlt die Heeresverwaltung 40 Pf.
4. Der Huflattich (^ussilsxo karkars).
Siehe Abb. 8.
Der Huflattich ist eine richtige Champagne«
Pflanze, kommt aber sonst auch sast überall vor.
Er liebt tonig-lehmigen Boden und findet sich
besonders an seuchten Gräben und naffen Wege-
rändern. Mit dem Löwenzahn frsrarseuin
okkieiusls) und dem Gänseblümchen (Lsllis
xsrsnnis), die alle tn die gleiche Famllie drr
Korbblütler (Oompositsn) gehören, zählt er zu
den Frühaufstehern der Pflanzenwelt: Jm
frühesten Frühjahr entsproffen seine Blüten mtt
dem ersten Grün der Erde und entwickeln ihre
gelbe Pracht, lana« bevor noch die Blätter er>
scheinen. Daran ist der Huflattich leicht zu er-
kennen.
Sowohl seine Blüten wie die jungen Blüten-
stände der beiden oben genannten Korbblütler
liefern einen beliebten Salat. Zu Gemüse ge>
kocht geben die Blütenstände der drei Pflanzen«
arten sehr appetitlich gefärbte Gerichte, worauf
auch in Nr. 306 der „Kölnischen Zeitung , Tages-
Ausgabe fürs Feld, vom 4. 5.1917, htnaewiesen
wurde. Ebenso slnd die Blätter der drn Arten,
sonderlich die des Löwenzahns.imJugendzustandr
in Frankreich, dem Lande der Feinschmecker,
schon lange zur Salat- und Gemüse-Bereitung
beliebt.
Medizinisch werden nur die Huflattich-Blätter
verwendet. Diese langgestielten, grundständigen
Blätter sind 8 bis 15 om lang, rundlich herz-
förmig, ecktg gezähnt, oberseits kahl, dunkelgrün,
unterseits weihfilzig behaart. Die Blätter ent«
wickeln sich erst nach der Blüte, die von Februar
bis April dauert. Die Abbildung ist nicht ganz
richtig. Sie bringt der Einfachheit halber dte
Blüten in den oerschiedenen Entwicklungsstusen
und die Blätter zusammen auf einem Btld
vereint. Da also bei dem Einsammeln der
Blätter die Blüten fehlen, mutz man daraus
achten, sie nicht mit der Pestwurz zu verwechseln.
Die Blätter der letzteren sind grötzer, mehr nieren«
förmig und unterseits nicht weitzfilzig sondem
grauhaarig. .
Dte Huflattichblätter enthalten Schleim und
auf den Hustenreiz mildernd einwirkende Stosse.
Deshalb bilden ste ebenso wie die Wollblumen
einen Bestandteil des Brusttees.
5 k§ frischgesammelter Huflattichblätter geben
11cx lufttrockener. Für 11cx ftischer Blätter zahu
die Heeresverwaltung 5 Pfg.