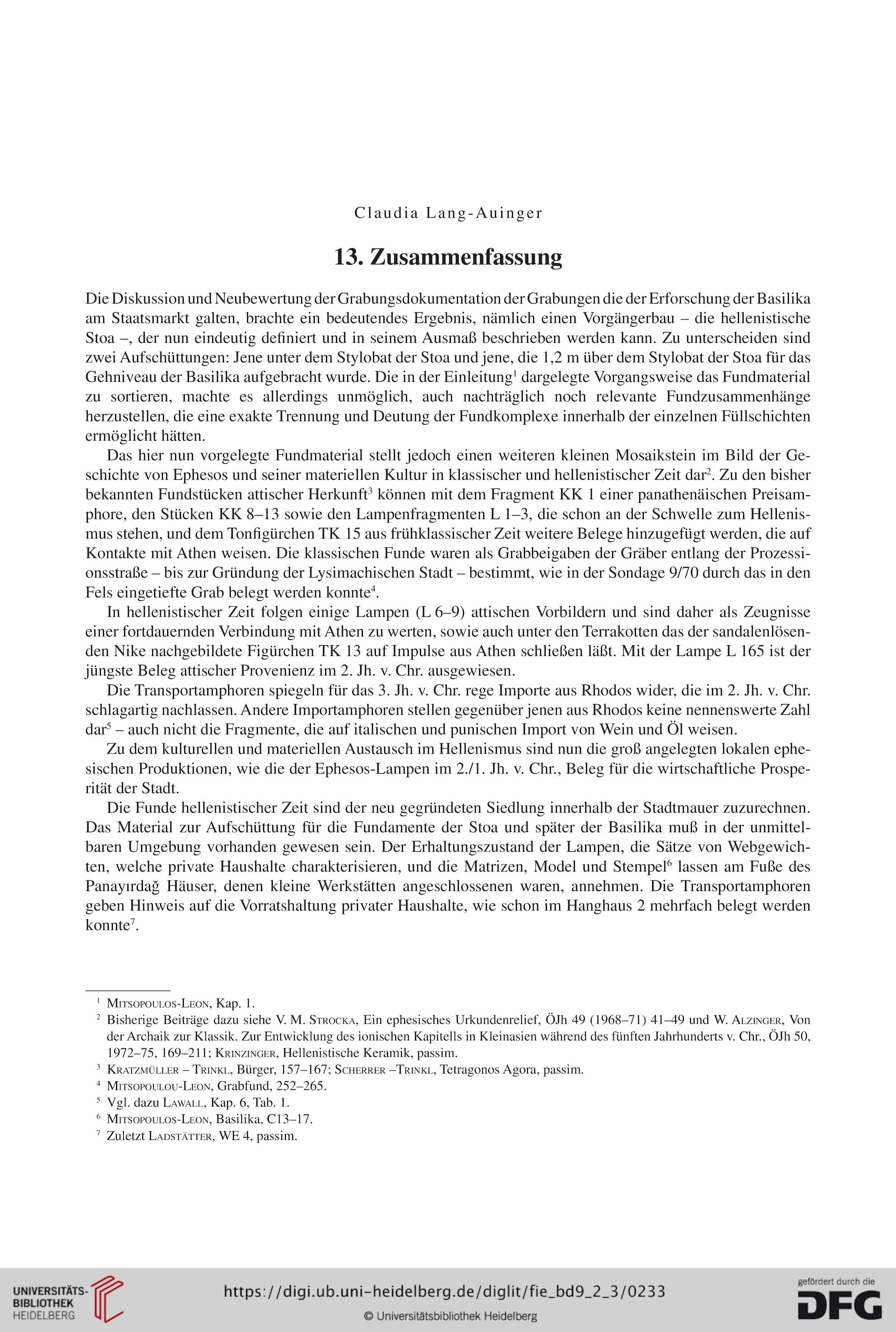Claudia Lang-Auinger
13. Zusammenfassung
Die Diskussion und Neubewertung der Grabungsdokumentation der Grabungen die der Erforschung der Basilika
am Staatsmarkt galten, brachte ein bedeutendes Ergebnis, nämlich einen Vorgängerbau - die hellenistische
Stoa -, der nun eindeutig definiert und in seinem Ausmaß beschrieben werden kann. Zu unterscheiden sind
zwei Aufschüttungen: Jene unter dem Stylobat der Stoa und jene, die 1,2 m über dem Stylobat der Stoa für das
Gehniveau der Basilika aufgebracht wurde. Die in der Einleitung1 dargelegte Vorgangsweise das Fundmaterial
zu sortieren, machte es allerdings unmöglich, auch nachträglich noch relevante Fundzusammenhänge
herzustellen, die eine exakte Trennung und Deutung der Fundkomplexe innerhalb der einzelnen Füllschichten
ermöglicht hätten.
Das hier nun vorgelegte Fundmaterial stellt jedoch einen weiteren kleinen Mosaikstein im Bild der Ge-
schichte von Ephesos und seiner materiellen Kultur in klassischer und hellenistischer Zeit dar2. Zu den bisher
bekannten Fundstücken attischer Herkunft3 können mit dem Fragment KK 1 einer panathenäischen Preisam-
phore, den Stücken KK 8-13 sowie den Eampenfragmenten L 1-3, die schon an der Schwelle zum Hellenis-
mus stehen, und dem Tonfigürchen TK 15 aus frühklassischer Zeit weitere Belege hinzugefügt werden, die auf
Kontakte mit Athen weisen. Die klassischen Funde waren als Grabbeigaben der Gräber entlang der Prozessi-
onsstraße - bis zur Gründung der Lysimachischen Stadt - bestimmt, wie in der Sondage 9/70 durch das in den
Fels eingetiefte Grab belegt werden konnte4.
In hellenistischer Zeit folgen einige Lampen (L 6-9) attischen Vorbildern und sind daher als Zeugnisse
einer fortdauernden Verbindung mit Athen zu werten, sowie auch unter den Terrakotten das der sandalenlösen-
den Nike nachgebildete Figürchen TK 13 auf Impulse aus Athen schließen läßt. Mit der Lampe L 165 ist der
jüngste Beleg attischer Provenienz im 2. Jh. v. Chr. ausgewiesen.
Die Transportamphoren spiegeln für das 3. Jh. v. Chr. rege Importe aus Rhodos wider, die im 2. Jh. v. Chr.
schlagartig nachlassen. Andere Importamphoren stellen gegenüber jenen aus Rhodos keine nennenswerte Zahl
dar5 - auch nicht die Fragmente, die auf italischen und punischen Import von Wein und Öl weisen.
Zu dem kulturellen und materiellen Austausch im Hellenismus sind nun die groß angelegten lokalen ephe-
sischen Produktionen, wie die der Ephesos-Lampen im 2./1. Jh. v. Chr., Beleg für die wirtschaftliche Prospe-
rität der Stadt.
Die Funde hellenistischer Zeit sind der neu gegründeten Siedlung innerhalb der Stadtmauer zuzurechnen.
Das Material zur Aufschüttung für die Fundamente der Stoa und später der Basilika muß in der unmittel-
baren Umgebung vorhanden gewesen sein. Der Erhaltungszustand der Lampen, die Sätze von Webgewich-
ten, welche private Haushalte charakterisieren, und die Matrizen, Model und Stempel6 lassen am Fuße des
Panayirdag Häuser, denen kleine Werkstätten angeschlossenen waren, annehmen. Die Transportamphoren
geben Hinweis auf die Vorratshaltung privater Haushalte, wie schon im Hanghaus 2 mehrfach belegt werden
konnte7.
1 Mitsopoulos-Leon, Kap. 1.
2 Bisherige Beiträge dazu siehe V. M. Strocka, Ein ephesisches Urkundenrelief, ÖJh 49 (1968-71) 41-49 und W. Alzinger, Von
der Archaik zur Klassik. Zur Entwicklung des ionischen Kapitells in Kleinasien während des fünften Jahrhunderts v. Chr., ÖJh 50,
1972-75, 169-211; Krinzinger, Hellenistische Keramik, passim.
3 Kratzmüller - Trinkl, Bürger, 157-167; Scherrer -Trinkl, Tetragonos Agora, passim.
4 Mitsopoulou-Leon, Grabfund, 252-265.
5 Vgl. dazu Lawall, Kap. 6, Tab. 1.
6 Mitsopoulos-Leon, Basilika, C13-17.
7 Zuletzt Ladstätter, WE 4, passim.
13. Zusammenfassung
Die Diskussion und Neubewertung der Grabungsdokumentation der Grabungen die der Erforschung der Basilika
am Staatsmarkt galten, brachte ein bedeutendes Ergebnis, nämlich einen Vorgängerbau - die hellenistische
Stoa -, der nun eindeutig definiert und in seinem Ausmaß beschrieben werden kann. Zu unterscheiden sind
zwei Aufschüttungen: Jene unter dem Stylobat der Stoa und jene, die 1,2 m über dem Stylobat der Stoa für das
Gehniveau der Basilika aufgebracht wurde. Die in der Einleitung1 dargelegte Vorgangsweise das Fundmaterial
zu sortieren, machte es allerdings unmöglich, auch nachträglich noch relevante Fundzusammenhänge
herzustellen, die eine exakte Trennung und Deutung der Fundkomplexe innerhalb der einzelnen Füllschichten
ermöglicht hätten.
Das hier nun vorgelegte Fundmaterial stellt jedoch einen weiteren kleinen Mosaikstein im Bild der Ge-
schichte von Ephesos und seiner materiellen Kultur in klassischer und hellenistischer Zeit dar2. Zu den bisher
bekannten Fundstücken attischer Herkunft3 können mit dem Fragment KK 1 einer panathenäischen Preisam-
phore, den Stücken KK 8-13 sowie den Eampenfragmenten L 1-3, die schon an der Schwelle zum Hellenis-
mus stehen, und dem Tonfigürchen TK 15 aus frühklassischer Zeit weitere Belege hinzugefügt werden, die auf
Kontakte mit Athen weisen. Die klassischen Funde waren als Grabbeigaben der Gräber entlang der Prozessi-
onsstraße - bis zur Gründung der Lysimachischen Stadt - bestimmt, wie in der Sondage 9/70 durch das in den
Fels eingetiefte Grab belegt werden konnte4.
In hellenistischer Zeit folgen einige Lampen (L 6-9) attischen Vorbildern und sind daher als Zeugnisse
einer fortdauernden Verbindung mit Athen zu werten, sowie auch unter den Terrakotten das der sandalenlösen-
den Nike nachgebildete Figürchen TK 13 auf Impulse aus Athen schließen läßt. Mit der Lampe L 165 ist der
jüngste Beleg attischer Provenienz im 2. Jh. v. Chr. ausgewiesen.
Die Transportamphoren spiegeln für das 3. Jh. v. Chr. rege Importe aus Rhodos wider, die im 2. Jh. v. Chr.
schlagartig nachlassen. Andere Importamphoren stellen gegenüber jenen aus Rhodos keine nennenswerte Zahl
dar5 - auch nicht die Fragmente, die auf italischen und punischen Import von Wein und Öl weisen.
Zu dem kulturellen und materiellen Austausch im Hellenismus sind nun die groß angelegten lokalen ephe-
sischen Produktionen, wie die der Ephesos-Lampen im 2./1. Jh. v. Chr., Beleg für die wirtschaftliche Prospe-
rität der Stadt.
Die Funde hellenistischer Zeit sind der neu gegründeten Siedlung innerhalb der Stadtmauer zuzurechnen.
Das Material zur Aufschüttung für die Fundamente der Stoa und später der Basilika muß in der unmittel-
baren Umgebung vorhanden gewesen sein. Der Erhaltungszustand der Lampen, die Sätze von Webgewich-
ten, welche private Haushalte charakterisieren, und die Matrizen, Model und Stempel6 lassen am Fuße des
Panayirdag Häuser, denen kleine Werkstätten angeschlossenen waren, annehmen. Die Transportamphoren
geben Hinweis auf die Vorratshaltung privater Haushalte, wie schon im Hanghaus 2 mehrfach belegt werden
konnte7.
1 Mitsopoulos-Leon, Kap. 1.
2 Bisherige Beiträge dazu siehe V. M. Strocka, Ein ephesisches Urkundenrelief, ÖJh 49 (1968-71) 41-49 und W. Alzinger, Von
der Archaik zur Klassik. Zur Entwicklung des ionischen Kapitells in Kleinasien während des fünften Jahrhunderts v. Chr., ÖJh 50,
1972-75, 169-211; Krinzinger, Hellenistische Keramik, passim.
3 Kratzmüller - Trinkl, Bürger, 157-167; Scherrer -Trinkl, Tetragonos Agora, passim.
4 Mitsopoulou-Leon, Grabfund, 252-265.
5 Vgl. dazu Lawall, Kap. 6, Tab. 1.
6 Mitsopoulos-Leon, Basilika, C13-17.
7 Zuletzt Ladstätter, WE 4, passim.