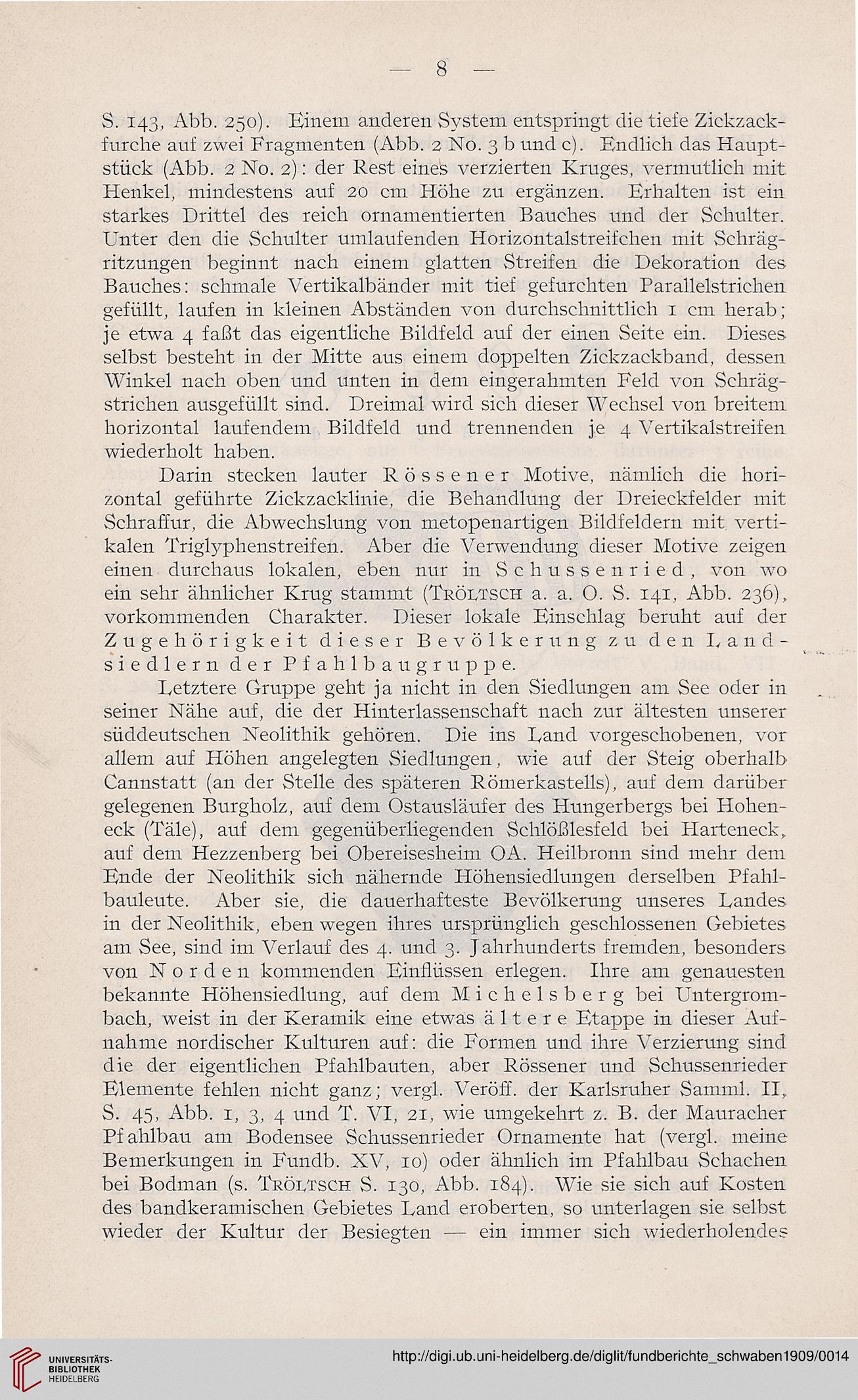— 8 —
S. 143, Abb. 250). Einem anderen System entspringt die tiefe Zickzack-
furche auf zwei Fragmenten (Abb. 2 No. 3 b und c). Endlich das Haupt-
stück (Abb. 2 No. 2): der Rest eines verzierten Kruges, vermutlich mit.
Henkel, mindestens auf 20 cm Höhe zu ergänzen. Erhalten ist ein
starkes Drittel des reich ornamentierten Bauches und der Schulter.
Unter den die Schulter umlaufenden Horizontalstreifchen mit Schräg-
ritzungen beginnt nach einem glatten Streifen die Dekoration des
Bauches: schmale Vertikalbänder mit tief gefurchten Parallelstrichen
gefüllt, laufen in kleinen Abständen von durchschnittlich 1 cm herab;
je etwa 4 faßt das eigentliche Bildfeld auf der einen Seite ein. Dieses
selbst besteht in der Mitte aus einem doppelten Zickzackband, dessen
Winkel nach oben und unten in dem eingerahmten Feld von Schräg-
strichen ausgefüllt sind. Dreimal wird sich dieser Wechsel von breitem
horizontal laufendem Bildfeld und trennenden je 4 Vertikalstreifen
wiederholt haben.
Darin stecken lauter Rössener Motive, nämlich die hori-
zontal geführte Zickzacklinie, die Behandlung der Dreieckfelder mit
Schraffur, die Abwechslung von metopenartigen Bildfeldern mit verti-
kalen Triglyphenstreifen. Aber die Verwendung dieser Motive zeigen
einen durchaus lokalen, eben nur in Schussenried, von wo
ein sehr ähnlicher Krug stammt (TrÖLTSCH a. a. O. S. 141, Abb. 236),
vorkommenden Charakter. Dieser lokale Einschlag beruht auf der
Zugehörigkeit dieser Bevölkerung zu den Land-
siedlern der Pfahlbaugruppe.
Letztere Gruppe geht ja nicht in den Siedlungen am See oder in
seiner Nähe auf, die der Hinterlassenschaft nach zur ältesten unserer
süddeutschen Neolithik gehören. Die ins Land vorgeschobenen, vor
allem auf Höhen angelegten Siedlungen, wie auf der Steig oberhalb
Cannstatt (an der Stelle des späteren Römerkastells), auf dem darüber
gelegenen Burgholz, auf dem Ostausläufer des Hungerbergs bei Hohen-
eck (Täle), auf dem gegenüberliegenden Schlößlesfeld bei Harteneck,
auf dem Hezzenberg bei Obereisesheim OA. Heilbronn sind mehr dem
Ende der Neolithik sich nähernde Höhensiedlungen derselben Pfahl-
bauleute. Aber sie, die dauerhafteste Bevölkerung unseres Landes
in der Neolithik, eben wegen ihres ursprünglich geschlossenen Gebietes
am See, sind im Verlauf des 4. und 3. Jahrhunderts fremden, besonders
von Norden kommenden Einflüssen erlegen. Ihre am genauesten
bekannte Höhensiedlung, auf dem Michelsberg bei Untergrom-
bach, weist in der Keramik eine etwas ältere Etappe in dieser Auf-
nahme nordischer Kulturen auf: die Formen und ihre Verzierung sind
die der eigentlichen Pfahlbauten, aber Rössener und Schussenrieder
Elemente fehlen nicht ganz; vergl. Veröff. der Karlsruher Samml. II,
S. 45, Abb. 1, 3, 4 und T. VI, 21, wie umgekehrt z. B. der Mauracher
Pfahlbau am Bodensee Schussenrieder Ornamente hat (vergl. meine
Bemerkungen in Fundb. XV, 10) oder ähnlich im Pfahlbau Schachen
bei Bodman (s. Tröltsch S. 130, Abb. 184). Wie sie sich auf Kosten
des bandkeramischen Gebietes Land eroberten, so unterlagen sie selbst
wieder der Kultur der Besiegten — ein immer sich wiederholendes
S. 143, Abb. 250). Einem anderen System entspringt die tiefe Zickzack-
furche auf zwei Fragmenten (Abb. 2 No. 3 b und c). Endlich das Haupt-
stück (Abb. 2 No. 2): der Rest eines verzierten Kruges, vermutlich mit.
Henkel, mindestens auf 20 cm Höhe zu ergänzen. Erhalten ist ein
starkes Drittel des reich ornamentierten Bauches und der Schulter.
Unter den die Schulter umlaufenden Horizontalstreifchen mit Schräg-
ritzungen beginnt nach einem glatten Streifen die Dekoration des
Bauches: schmale Vertikalbänder mit tief gefurchten Parallelstrichen
gefüllt, laufen in kleinen Abständen von durchschnittlich 1 cm herab;
je etwa 4 faßt das eigentliche Bildfeld auf der einen Seite ein. Dieses
selbst besteht in der Mitte aus einem doppelten Zickzackband, dessen
Winkel nach oben und unten in dem eingerahmten Feld von Schräg-
strichen ausgefüllt sind. Dreimal wird sich dieser Wechsel von breitem
horizontal laufendem Bildfeld und trennenden je 4 Vertikalstreifen
wiederholt haben.
Darin stecken lauter Rössener Motive, nämlich die hori-
zontal geführte Zickzacklinie, die Behandlung der Dreieckfelder mit
Schraffur, die Abwechslung von metopenartigen Bildfeldern mit verti-
kalen Triglyphenstreifen. Aber die Verwendung dieser Motive zeigen
einen durchaus lokalen, eben nur in Schussenried, von wo
ein sehr ähnlicher Krug stammt (TrÖLTSCH a. a. O. S. 141, Abb. 236),
vorkommenden Charakter. Dieser lokale Einschlag beruht auf der
Zugehörigkeit dieser Bevölkerung zu den Land-
siedlern der Pfahlbaugruppe.
Letztere Gruppe geht ja nicht in den Siedlungen am See oder in
seiner Nähe auf, die der Hinterlassenschaft nach zur ältesten unserer
süddeutschen Neolithik gehören. Die ins Land vorgeschobenen, vor
allem auf Höhen angelegten Siedlungen, wie auf der Steig oberhalb
Cannstatt (an der Stelle des späteren Römerkastells), auf dem darüber
gelegenen Burgholz, auf dem Ostausläufer des Hungerbergs bei Hohen-
eck (Täle), auf dem gegenüberliegenden Schlößlesfeld bei Harteneck,
auf dem Hezzenberg bei Obereisesheim OA. Heilbronn sind mehr dem
Ende der Neolithik sich nähernde Höhensiedlungen derselben Pfahl-
bauleute. Aber sie, die dauerhafteste Bevölkerung unseres Landes
in der Neolithik, eben wegen ihres ursprünglich geschlossenen Gebietes
am See, sind im Verlauf des 4. und 3. Jahrhunderts fremden, besonders
von Norden kommenden Einflüssen erlegen. Ihre am genauesten
bekannte Höhensiedlung, auf dem Michelsberg bei Untergrom-
bach, weist in der Keramik eine etwas ältere Etappe in dieser Auf-
nahme nordischer Kulturen auf: die Formen und ihre Verzierung sind
die der eigentlichen Pfahlbauten, aber Rössener und Schussenrieder
Elemente fehlen nicht ganz; vergl. Veröff. der Karlsruher Samml. II,
S. 45, Abb. 1, 3, 4 und T. VI, 21, wie umgekehrt z. B. der Mauracher
Pfahlbau am Bodensee Schussenrieder Ornamente hat (vergl. meine
Bemerkungen in Fundb. XV, 10) oder ähnlich im Pfahlbau Schachen
bei Bodman (s. Tröltsch S. 130, Abb. 184). Wie sie sich auf Kosten
des bandkeramischen Gebietes Land eroberten, so unterlagen sie selbst
wieder der Kultur der Besiegten — ein immer sich wiederholendes