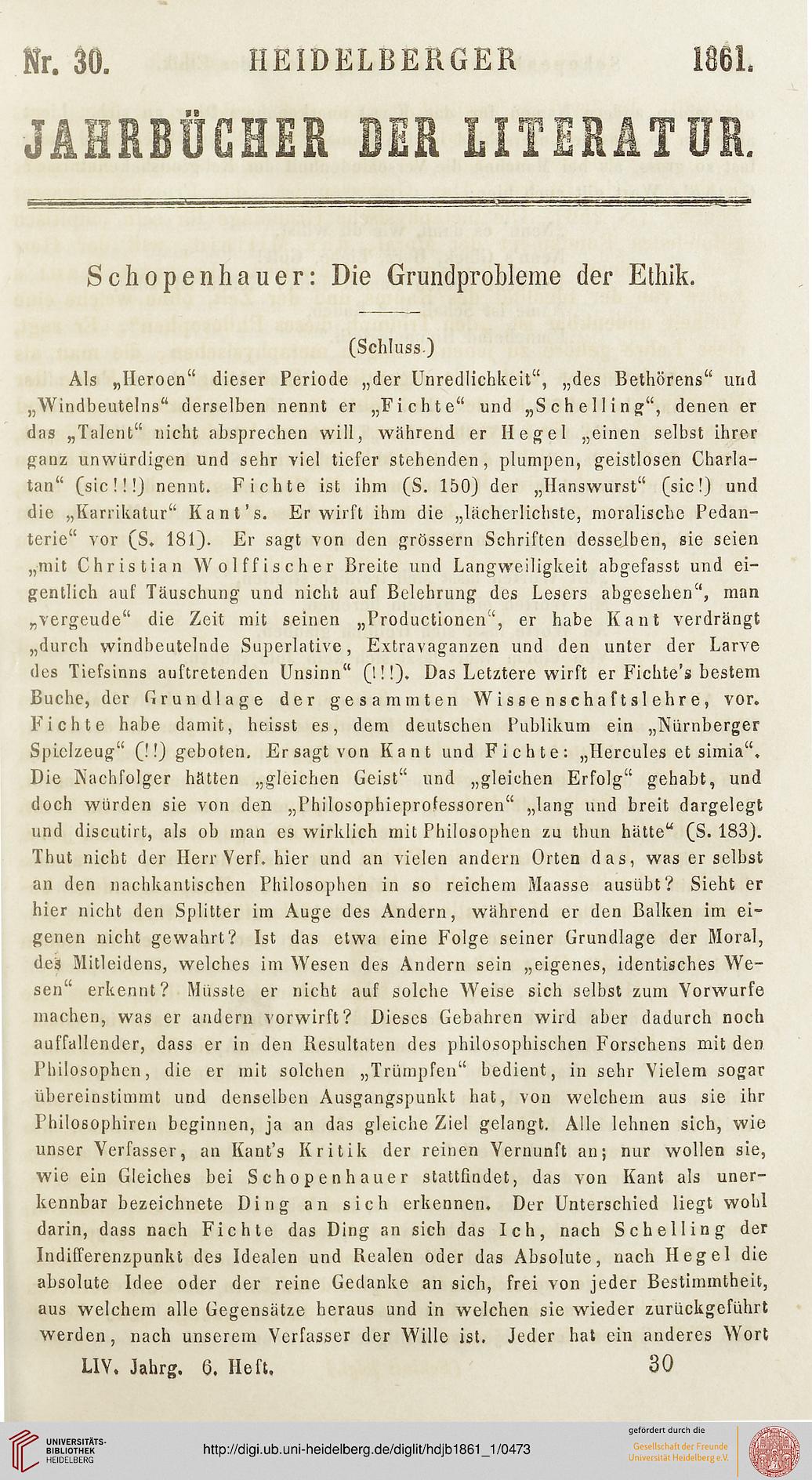Nr. 30. HEIDELBERGER 1861.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Schopenhauer: Die Grundprobleme der Ethik.
(Schluss)
Als „Heroen“ dieser Periode „der Unredlichkeit“, „des Bethörens“ und
„Windbeutelns“ derselben nennt er „Fichte“ und „Schelling“, denen er
das „Talent“ nicht absprechen will, während er Hegel „einen selbst ihrer
ganz unwürdigen und sehr viel tiefer stehenden, plumpen, geistlosen Charla-
tan“ (sic!!!) nennt. Fichte ist ihm (S. 150) der „Hanswurst“ (sic!) und
die „Karrikatur“ Kant’s. Er wirft ihm die „lächerlichste, moralische Pedan-
terie“ vor (S. 181). Er sagt von den grossem Schriften desselben, sie seien
„mit Christian Wolffischer Breite und Langweiligkeit abgefasst und ei-
gentlich auf Täuschung und nicht auf Belehrung des Lesers abgesehen“, man
„vergeude“ die Zeit mit seinen „Productionen“, er habe Kant verdrängt
„durch windbeutelnde Superlative, Extravaganzen und den unter der Larve
des Tiefsinns auftretenden Unsinn“ (l!!). Das Letztere wirft er Fichte's bestem
Buche, der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, vor.
Fichte habe damit, heisst es, dem deutschen Publikum ein „Nürnberger
Spielzeug“ (!!) geboten. Er sagt von Kant und Fichte: „Hercules et simia“.
Die Nachfolger hätten „gleichen Geist“ und „gleichen Erfolg“ gehabt, und
doch würden sie von den „Philosophieprofessoren“ „lang und breit dargelegt
und discutirt, als ob man es wirklich mit Philosophen zu thun hätte“ (S. 183).
Thut nicht der Herr Verf. hier und an vielen andern Orten das, was er selbst
an den nachkantischen Philosophen in so reichem Maasse ausübt? Sieht er
hier nicht den Splitter im Auge des Andern, während er den Balken im ei-
genen nicht gewahrt? Ist das etwa eine Folge seiner Grundlage der Moral,
des Mitleidens, welches im Wesen des Andern sein „eigenes, identisches We-
sen“ erkennt? Müsste er nicht auf solche Weise sich selbst zum Vorwürfe
machen, was er andern vorwirft? Dieses Gebahren wird aber dadurch noch
auffallender, dass er in den Resultaten des philosophischen Forschens mit den
Philosophen, die er mit solchen „Trümpfen“ bedient, in sehr Vielem sogar
übereinstimmt und denselben Ausgangspunkt hat, von welchem aus sie ihr
Philosophiren beginnen, ja an das gleiche Ziel gelangt. Alle lehnen sich, wie
unser Verfasser, an Kant’s Kritik der reinen Vernunft an; nur wollen sie,
wie ein Gleiches bei Schopenhauer stattfindet, das von Kant als uner-
kennbar bezeichnete Ding an sich erkennen. Der Unterschied liegt wohl
darin, dass nach Fichte das Ding an sich das Ich, nach Schelling der
Indifferenzpunkt des Idealen und Realen oder das Absolute, nach Hegel die
absolute Idee oder der reine Gedanke an sich, frei von jeder Bestimmtheit,
aus welchem alle Gegensätze heraus und in welchen sie wieder zurückgeführt
werden, nach unserem Verfasser der Wille ist. Jeder hat ein anderes Wort
LIV. Jahrg. 6. Heft. 30
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Schopenhauer: Die Grundprobleme der Ethik.
(Schluss)
Als „Heroen“ dieser Periode „der Unredlichkeit“, „des Bethörens“ und
„Windbeutelns“ derselben nennt er „Fichte“ und „Schelling“, denen er
das „Talent“ nicht absprechen will, während er Hegel „einen selbst ihrer
ganz unwürdigen und sehr viel tiefer stehenden, plumpen, geistlosen Charla-
tan“ (sic!!!) nennt. Fichte ist ihm (S. 150) der „Hanswurst“ (sic!) und
die „Karrikatur“ Kant’s. Er wirft ihm die „lächerlichste, moralische Pedan-
terie“ vor (S. 181). Er sagt von den grossem Schriften desselben, sie seien
„mit Christian Wolffischer Breite und Langweiligkeit abgefasst und ei-
gentlich auf Täuschung und nicht auf Belehrung des Lesers abgesehen“, man
„vergeude“ die Zeit mit seinen „Productionen“, er habe Kant verdrängt
„durch windbeutelnde Superlative, Extravaganzen und den unter der Larve
des Tiefsinns auftretenden Unsinn“ (l!!). Das Letztere wirft er Fichte's bestem
Buche, der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, vor.
Fichte habe damit, heisst es, dem deutschen Publikum ein „Nürnberger
Spielzeug“ (!!) geboten. Er sagt von Kant und Fichte: „Hercules et simia“.
Die Nachfolger hätten „gleichen Geist“ und „gleichen Erfolg“ gehabt, und
doch würden sie von den „Philosophieprofessoren“ „lang und breit dargelegt
und discutirt, als ob man es wirklich mit Philosophen zu thun hätte“ (S. 183).
Thut nicht der Herr Verf. hier und an vielen andern Orten das, was er selbst
an den nachkantischen Philosophen in so reichem Maasse ausübt? Sieht er
hier nicht den Splitter im Auge des Andern, während er den Balken im ei-
genen nicht gewahrt? Ist das etwa eine Folge seiner Grundlage der Moral,
des Mitleidens, welches im Wesen des Andern sein „eigenes, identisches We-
sen“ erkennt? Müsste er nicht auf solche Weise sich selbst zum Vorwürfe
machen, was er andern vorwirft? Dieses Gebahren wird aber dadurch noch
auffallender, dass er in den Resultaten des philosophischen Forschens mit den
Philosophen, die er mit solchen „Trümpfen“ bedient, in sehr Vielem sogar
übereinstimmt und denselben Ausgangspunkt hat, von welchem aus sie ihr
Philosophiren beginnen, ja an das gleiche Ziel gelangt. Alle lehnen sich, wie
unser Verfasser, an Kant’s Kritik der reinen Vernunft an; nur wollen sie,
wie ein Gleiches bei Schopenhauer stattfindet, das von Kant als uner-
kennbar bezeichnete Ding an sich erkennen. Der Unterschied liegt wohl
darin, dass nach Fichte das Ding an sich das Ich, nach Schelling der
Indifferenzpunkt des Idealen und Realen oder das Absolute, nach Hegel die
absolute Idee oder der reine Gedanke an sich, frei von jeder Bestimmtheit,
aus welchem alle Gegensätze heraus und in welchen sie wieder zurückgeführt
werden, nach unserem Verfasser der Wille ist. Jeder hat ein anderes Wort
LIV. Jahrg. 6. Heft. 30