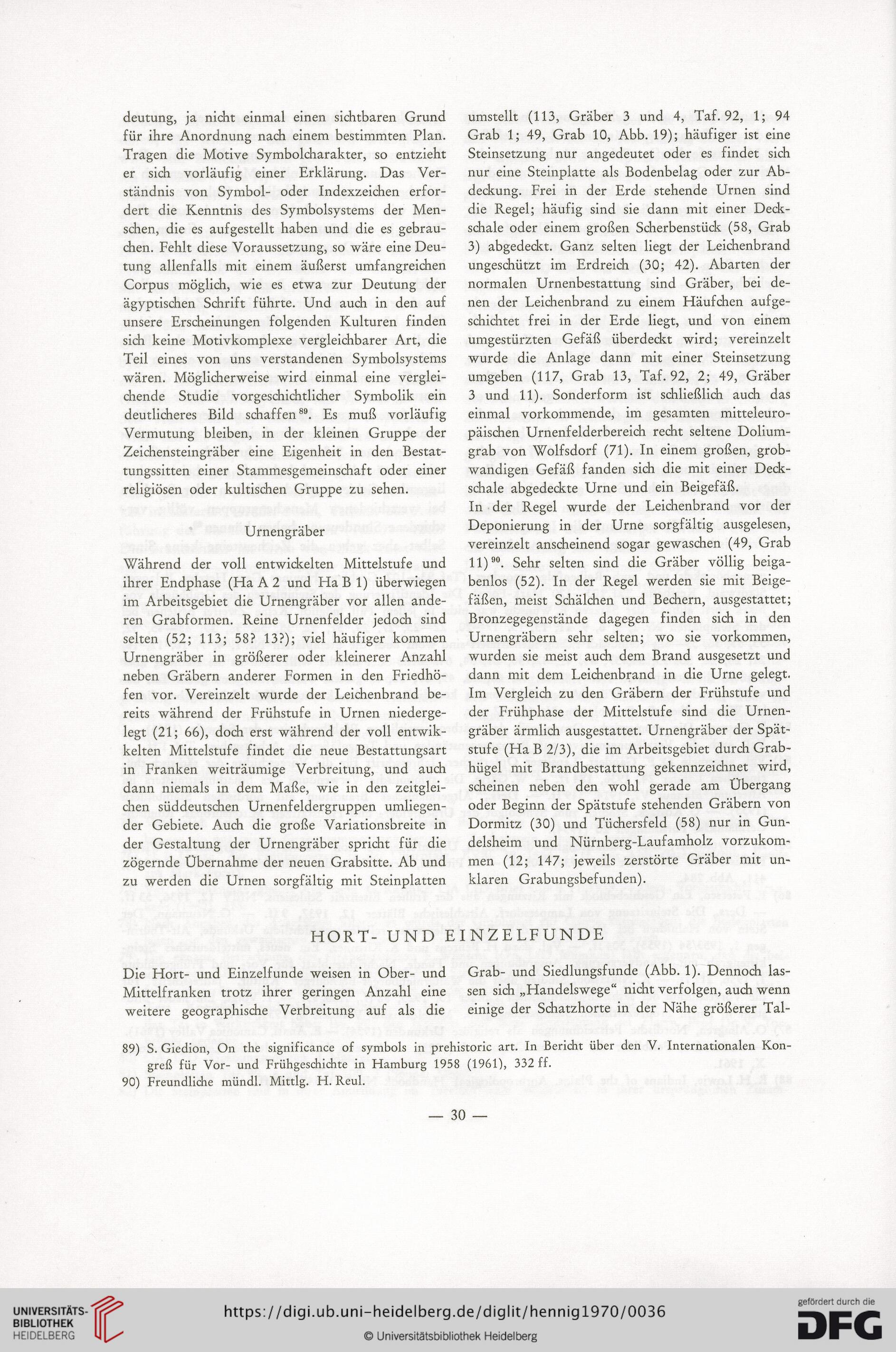deutung, ja nicht einmal einen sichtbaren Grund
für ihre Anordnung nach einem bestimmten Plan.
Tragen die Motive Symbolcharakter, so entzieht
er sich vorläufig einer Erklärung. Das Ver-
ständnis von Symbol- oder Indexzeichen erfor-
dert die Kenntnis des Symbolsystems der Men-
schen, die es aufgestellt haben und die es gebrau-
chen. Fehlt diese Voraussetzung, so wäre eine Deu-
tung allenfalls mit einem äußerst umfangreichen
Corpus möglich, wie es etwa zur Deutung der
ägyptischen Schrift führte. Und auch in den auf
unsere Erscheinungen folgenden Kulturen finden
sich keine Motivkomplexe vergleichbarer Art, die
Teil eines von uns verstandenen Symbolsystems
wären. Möglicherweise wird einmal eine verglei-
chende Studie vorgeschichtlicher Symbolile ein
deutlicheres Bild schaffen89. Es muß vorläufig
Vermutung bleiben, in der kleinen Gruppe der
Zeichensteingräber eine Eigenheit in den Bestat-
tungssitten einer Stammesgemeinschaft oder einer
religiösen oder kultischen Gruppe zu sehen.
Urnengräber
Während der voll entwickelten Mittelstufe und
ihrer Endphase (Ha A 2 und Ha B 1) überwiegen
im Arbeitsgebiet die Urnengräber vor allen ande-
ren Grabformen. Reine Urnenfelder jedoch sind
selten (52; 113; 58? 13?); viel häufiger kommen
Urnengräber in größerer oder kleinerer Anzahl
neben Gräbern anderer Formen in den Friedhö-
fen vor. Vereinzelt wurde der Leichenbrand be-
reits während der Frühstufe in Urnen niederge-
legt (21; 66), doch erst während der voll entwik-
kelten Mittelstufe findet die neue Bestattungsart
in Franken weiträumige Verbreitung, und auch
dann niemals in dem Maße, wie in den zeitglei-
chen süddeutschen Urnenfeldergruppen umliegen-
der Gebiete. Auch die große Variationsbreite in
der Gestaltung der Urnengräber spricht für die
zögernde Übernahme der neuen Grabsitte. Ab und
zu werden die Urnen sorgfältig mit Steinplatten
umstellt (113, Gräber 3 und 4, Taf. 92, 1; 94
Grab 1; 49, Grab 10, Abb. 19); häufiger ist eine
Steinsetzung nur angedeutet oder es findet sich
nur eine Steinplatte als Bodenbelag oder zur Ab-
deckung. Frei in der Erde stehende Urnen sind
die Regel; häufig sind sie dann mit einer Deck-
schale oder einem großen Scherbenstück (58, Grab
3) abgedeckt. Ganz selten liegt der Leichenbrand
ungeschützt im Erdreich (30; 42). Abarten der
normalen Urnenbestattung sind Gräber, bei de-
nen der Leichenbrand zu einem Häufchen aufge-
schichtet frei in der Erde liegt, und von einem
umgestürzten Gefäß überdeckt wird; vereinzelt
wurde die Anlage dann mit einer Steinsetzung
umgeben (117, Grab 13, Taf. 92, 2; 49, Gräber
3 und 11). Sonderform ist schließlich auch das
einmal vorkommende, im gesamten mitteleuro-
päischen Urnenfelderbereich recht seltene Dolium-
grab von Wolfsdorf (71). In einem großen, grob-
wandigen Gefäß fanden sich die mit einer Deck-
schale abgedeckte Urne und ein Beigefäß.
In der Regel wurde der Leichenbrand vor der
Deponierung in der Urne sorgfältig ausgelesen,
vereinzelt anscheinend sogar gewaschen (49, Grab
11)9°. Sehr selten sind die Gräber völlig beiga-
benlos (52). In der Regel werden sie mit Beige-
fäßen, meist Schälchen und Bechern, ausgestattet;
Bronzegegenstände dagegen finden sich in den
Urnengräbern sehr selten; wo sie vorkommen,
wurden sie meist auch dem Brand ausgesetzt und
dann mit dem Leichenbrand in die Urne gelegt.
Im Vergleich zu den Gräbern der Frühstufe und
der Frühphase der Mittelstufe sind die Urnen-
gräber ärmlich ausgestattet. Urnengräber der Spät-
stufe (Ha B 2/3), die im Arbeitsgebiet durch Grab-
hügel mit Brandbestattung gekennzeichnet wird,
scheinen neben den wohl gerade am Übergang
oder Beginn der Spätstufe stehenden Gräbern von
Dormitz (30) und Tüchersfeld (58) nur in Gun-
deisheim und Nürnberg-Laufamholz vorzukom-
men (12; 147; jeweils zerstörte Gräber mit un-
klaren Grabungsbefunden).
HORT- UND EINZELFUNDE
Die Hort- und Einzelfunde weisen in Ober- und
Mittelfranken trotz ihrer geringen Anzahl eine
weitere geographische Verbreitung auf als die
Grab- und Siedlungsfunde (Abb. 1). Dennoch las-
sen sich „Handelswege" nicht verfolgen, auch wenn
einige der Schatzhorte in der Nähe größerer Tal-
89) S. Giedion, On the significance of symbols in prehistoric art. In Bericht über den V. Internationalen Kon-
greß für Vor- und Frühgeschichte in Hamburg 1958 (1961), 332 ff.
90) Freundliche mündl. Mittig. H. Reul.
— 30 —
für ihre Anordnung nach einem bestimmten Plan.
Tragen die Motive Symbolcharakter, so entzieht
er sich vorläufig einer Erklärung. Das Ver-
ständnis von Symbol- oder Indexzeichen erfor-
dert die Kenntnis des Symbolsystems der Men-
schen, die es aufgestellt haben und die es gebrau-
chen. Fehlt diese Voraussetzung, so wäre eine Deu-
tung allenfalls mit einem äußerst umfangreichen
Corpus möglich, wie es etwa zur Deutung der
ägyptischen Schrift führte. Und auch in den auf
unsere Erscheinungen folgenden Kulturen finden
sich keine Motivkomplexe vergleichbarer Art, die
Teil eines von uns verstandenen Symbolsystems
wären. Möglicherweise wird einmal eine verglei-
chende Studie vorgeschichtlicher Symbolile ein
deutlicheres Bild schaffen89. Es muß vorläufig
Vermutung bleiben, in der kleinen Gruppe der
Zeichensteingräber eine Eigenheit in den Bestat-
tungssitten einer Stammesgemeinschaft oder einer
religiösen oder kultischen Gruppe zu sehen.
Urnengräber
Während der voll entwickelten Mittelstufe und
ihrer Endphase (Ha A 2 und Ha B 1) überwiegen
im Arbeitsgebiet die Urnengräber vor allen ande-
ren Grabformen. Reine Urnenfelder jedoch sind
selten (52; 113; 58? 13?); viel häufiger kommen
Urnengräber in größerer oder kleinerer Anzahl
neben Gräbern anderer Formen in den Friedhö-
fen vor. Vereinzelt wurde der Leichenbrand be-
reits während der Frühstufe in Urnen niederge-
legt (21; 66), doch erst während der voll entwik-
kelten Mittelstufe findet die neue Bestattungsart
in Franken weiträumige Verbreitung, und auch
dann niemals in dem Maße, wie in den zeitglei-
chen süddeutschen Urnenfeldergruppen umliegen-
der Gebiete. Auch die große Variationsbreite in
der Gestaltung der Urnengräber spricht für die
zögernde Übernahme der neuen Grabsitte. Ab und
zu werden die Urnen sorgfältig mit Steinplatten
umstellt (113, Gräber 3 und 4, Taf. 92, 1; 94
Grab 1; 49, Grab 10, Abb. 19); häufiger ist eine
Steinsetzung nur angedeutet oder es findet sich
nur eine Steinplatte als Bodenbelag oder zur Ab-
deckung. Frei in der Erde stehende Urnen sind
die Regel; häufig sind sie dann mit einer Deck-
schale oder einem großen Scherbenstück (58, Grab
3) abgedeckt. Ganz selten liegt der Leichenbrand
ungeschützt im Erdreich (30; 42). Abarten der
normalen Urnenbestattung sind Gräber, bei de-
nen der Leichenbrand zu einem Häufchen aufge-
schichtet frei in der Erde liegt, und von einem
umgestürzten Gefäß überdeckt wird; vereinzelt
wurde die Anlage dann mit einer Steinsetzung
umgeben (117, Grab 13, Taf. 92, 2; 49, Gräber
3 und 11). Sonderform ist schließlich auch das
einmal vorkommende, im gesamten mitteleuro-
päischen Urnenfelderbereich recht seltene Dolium-
grab von Wolfsdorf (71). In einem großen, grob-
wandigen Gefäß fanden sich die mit einer Deck-
schale abgedeckte Urne und ein Beigefäß.
In der Regel wurde der Leichenbrand vor der
Deponierung in der Urne sorgfältig ausgelesen,
vereinzelt anscheinend sogar gewaschen (49, Grab
11)9°. Sehr selten sind die Gräber völlig beiga-
benlos (52). In der Regel werden sie mit Beige-
fäßen, meist Schälchen und Bechern, ausgestattet;
Bronzegegenstände dagegen finden sich in den
Urnengräbern sehr selten; wo sie vorkommen,
wurden sie meist auch dem Brand ausgesetzt und
dann mit dem Leichenbrand in die Urne gelegt.
Im Vergleich zu den Gräbern der Frühstufe und
der Frühphase der Mittelstufe sind die Urnen-
gräber ärmlich ausgestattet. Urnengräber der Spät-
stufe (Ha B 2/3), die im Arbeitsgebiet durch Grab-
hügel mit Brandbestattung gekennzeichnet wird,
scheinen neben den wohl gerade am Übergang
oder Beginn der Spätstufe stehenden Gräbern von
Dormitz (30) und Tüchersfeld (58) nur in Gun-
deisheim und Nürnberg-Laufamholz vorzukom-
men (12; 147; jeweils zerstörte Gräber mit un-
klaren Grabungsbefunden).
HORT- UND EINZELFUNDE
Die Hort- und Einzelfunde weisen in Ober- und
Mittelfranken trotz ihrer geringen Anzahl eine
weitere geographische Verbreitung auf als die
Grab- und Siedlungsfunde (Abb. 1). Dennoch las-
sen sich „Handelswege" nicht verfolgen, auch wenn
einige der Schatzhorte in der Nähe größerer Tal-
89) S. Giedion, On the significance of symbols in prehistoric art. In Bericht über den V. Internationalen Kon-
greß für Vor- und Frühgeschichte in Hamburg 1958 (1961), 332 ff.
90) Freundliche mündl. Mittig. H. Reul.
— 30 —