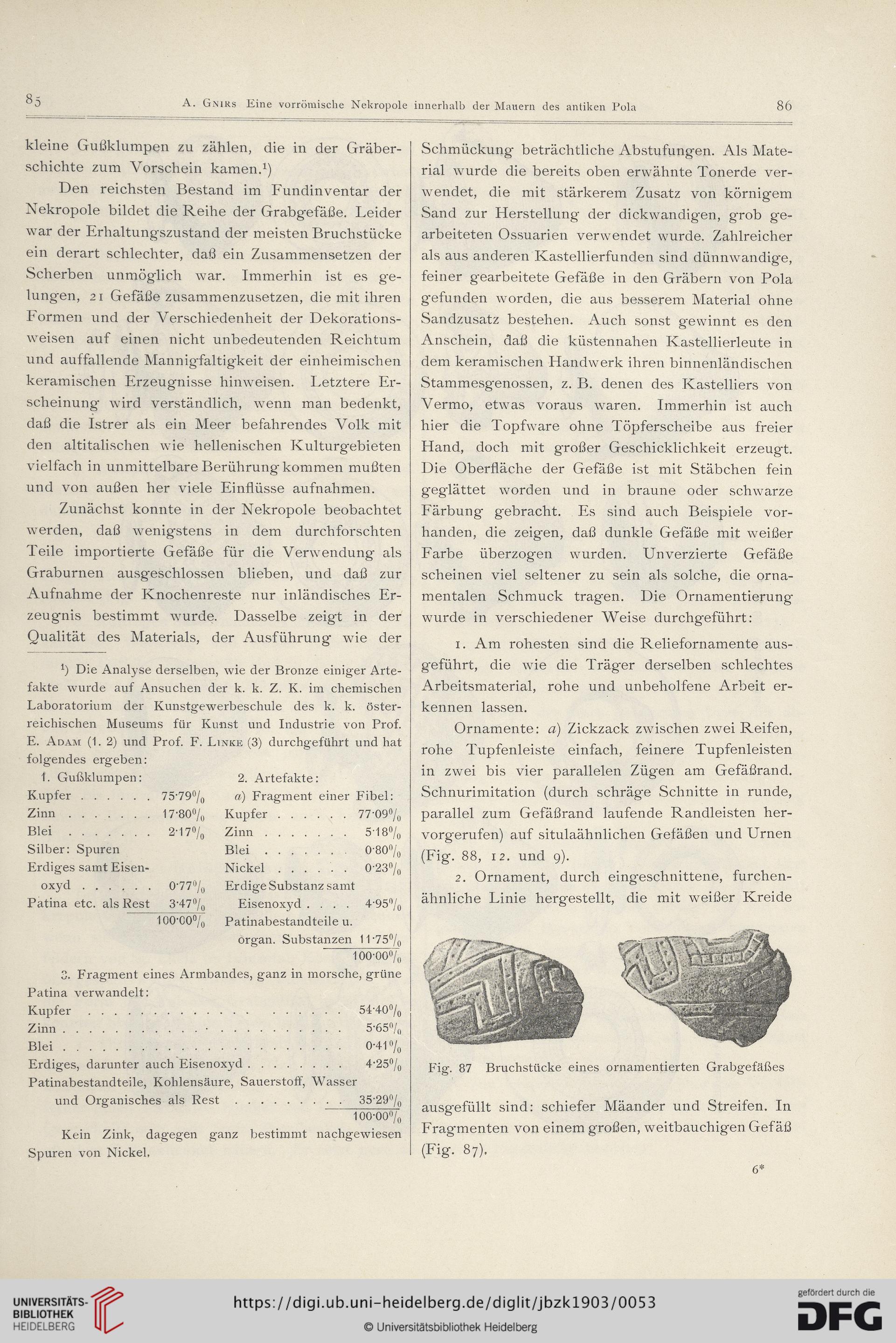85
A. Gnirs Eine vorrömische Nekropole innerhalb der Mauern des antiken Bola
86
kleine Gußklumpen zu zählen, die in der Gräber-
schichte zum Vorschein kamen.1)
Den reichsten Bestand im Fundinventar der
Nekropole bildet die Reihe der Grabgefäße. Leider
war der Erhaltungszustand der meisten Bruchstücke
ein derart schlechter, daß ein Zusammensetzen der
Scherben unmöglich war. Immerhin ist es ge-
lungen, 21 Gefäße zusammenzusetzen, die mit ihren
Formen und der Verschiedenheit der Dekorations-
weisen auf einen nicht unbedeutenden Reichtum
und auffallende Mannigfaltigkeit der einheimischen
keramischen Erzeugnisse hinweisen. Letztere Er-
scheinung wird verständlich, wenn man bedenkt,
daß die Istrer als ein Meer befahrendes Volk mit
den altitalischen wie hellenischen Kulturgebieten
vielfach in unmittelbare Berührung kommen mußten
und von außen her viele Einflüsse aufnahmen.
Zunächst konnte in der Nekropole beobachtet
werden, daß wenigstens in dem durchforschten
Teile importierte Gefäße für die Verwendung als
Graburnen ausgeschlossen blieben, und daß zur
Aufnahme der Knochenreste nur inländisches Er-
zeugnis bestimmt wurde. Dasselbe zeigt in der
Qualität des Materials, der Ausführung wie der
J) Die Analyse derselben, wie der Bronze einiger Arte-
fakte wurde auf Ansuchen der k. k. Z. K. im chemischen
Laboratorium der Kunstgewerbeschule des k. k. öster-
reichischen Museums für Kunst und Industrie von Prof.
E. Adam (1. 2) und Prof. F. Linke (3) durchgeführt und hat
folgendes ergeben:
1. Gußklumpen:
2. Artefakte:
Kupfer.
75’79%
a) Fragment einer
Fibel:
Zinn.
17-80%
Kupfer.
77-09%
Blei .
2'17%
Zinn.
5-18%
Silber: Spuren
Blei.
0-80%
Erdiges samt Eisen-
Nickel.
0-23%
oxyd.
0-77%
Erdige Substanz samt
Patina etc. als Rest
3-47%
Eisenoxyd ....
4'95%
100-00%
Patinabestandteile u.
organ. Substanzen
11-75%
1 oo-oo°/u
3. Fragment eines Armbandes, ganz in morsche, grüne
Patina verwandelt:
Kupfer. 54-40%
Zinn.•. 5’65%
Blei. 0*41 °/0
Erdiges, darunter auch Eisenoxyd. 4-25%
Patinabestandteile, Kohlensäure, Sauerstoff, Wasser
und Organisches als Rest. 35'29%
~~ ioo-oo%
Kein Zink, dagegen ganz bestimmt nachgewiesen
Spuren von Nickel,
Schmückung beträchtliche Abstufungen. Als Mate-
rial wurde die bereits oben erwähnte Tonerde ver-
wendet, die mit stärkerem Zusatz von körnigem
Sand zur Herstellung der dickwandigen, grob ge-
arbeiteten Ossuarien verwendet wurde. Zahlreicher
als aus anderen Kastellierfunden sind dünnwandige,
feiner gearbeitete Gefäße in den Gräbern von Pola
gefunden worden, die aus besserem Material ohne
Sandzusatz bestehen. Auch sonst gewinnt es den
Anschein, daß die küstennahen Kastellierleute in
dem keramischen Handwerk ihren binnenländischen
Stammesg'enossen, z. B. denen des Kastelliers von
Vermo, etwas voraus wraren. Immerhin ist auch
hier die Topfware ohne Töpferscheibe aus freier
Hand, doch mit großer Geschicklichkeit erzeugt.
Die Oberfläche der Gefäße ist mit Stäbchen fein
geglättet worden und in braune oder schwarze
Färbung gebracht. Es sind auch Beispiele vor-
handen, die zeigen, daß dunkle Gefäße mit weißer
Farbe überzogen wurden. Unverzierte Gefäße
scheinen viel seltener zu sein als solche, die orna-
mentalen Schmuck tragen. Die Ornamentierung
wurde in verschiedener Weise durchgeführt:
1. Am rohesten sind die Reliefornamente aus-
geführt, die wie die Träger derselben schlechtes
Arbeitsmaterial, rohe und unbeholfene Arbeit er-
kennen lassen.
Ornamente: «) Zickzack zwischen zwei Reifen,
rohe Tupfenleiste einfach, feinere Tupfenleisten
in zwei bis vier parallelen Zügen am Gefäßrand.
Schnurimitation (durch schräge Schnitte in runde,
parallel zum Gefäßrand laufende Randleisten her-
vorgerufen) auf situlaähnlichen Gefäßen und Urnen
(Fig. 88, 12. und 9).
2. Ornament, durch eingeschnittene, furchen-
ähnliche Linie hergestellt, die mit weißer Kreide
Fig. 87 Bruchstücke eines ornamentierten Grabgefäßes
ausgefüllt sind: schiefer Mäander und Streifen. In
Fragmenten von einem großen, weitbauchigen Gefäß
(Fig. 87).
6
A. Gnirs Eine vorrömische Nekropole innerhalb der Mauern des antiken Bola
86
kleine Gußklumpen zu zählen, die in der Gräber-
schichte zum Vorschein kamen.1)
Den reichsten Bestand im Fundinventar der
Nekropole bildet die Reihe der Grabgefäße. Leider
war der Erhaltungszustand der meisten Bruchstücke
ein derart schlechter, daß ein Zusammensetzen der
Scherben unmöglich war. Immerhin ist es ge-
lungen, 21 Gefäße zusammenzusetzen, die mit ihren
Formen und der Verschiedenheit der Dekorations-
weisen auf einen nicht unbedeutenden Reichtum
und auffallende Mannigfaltigkeit der einheimischen
keramischen Erzeugnisse hinweisen. Letztere Er-
scheinung wird verständlich, wenn man bedenkt,
daß die Istrer als ein Meer befahrendes Volk mit
den altitalischen wie hellenischen Kulturgebieten
vielfach in unmittelbare Berührung kommen mußten
und von außen her viele Einflüsse aufnahmen.
Zunächst konnte in der Nekropole beobachtet
werden, daß wenigstens in dem durchforschten
Teile importierte Gefäße für die Verwendung als
Graburnen ausgeschlossen blieben, und daß zur
Aufnahme der Knochenreste nur inländisches Er-
zeugnis bestimmt wurde. Dasselbe zeigt in der
Qualität des Materials, der Ausführung wie der
J) Die Analyse derselben, wie der Bronze einiger Arte-
fakte wurde auf Ansuchen der k. k. Z. K. im chemischen
Laboratorium der Kunstgewerbeschule des k. k. öster-
reichischen Museums für Kunst und Industrie von Prof.
E. Adam (1. 2) und Prof. F. Linke (3) durchgeführt und hat
folgendes ergeben:
1. Gußklumpen:
2. Artefakte:
Kupfer.
75’79%
a) Fragment einer
Fibel:
Zinn.
17-80%
Kupfer.
77-09%
Blei .
2'17%
Zinn.
5-18%
Silber: Spuren
Blei.
0-80%
Erdiges samt Eisen-
Nickel.
0-23%
oxyd.
0-77%
Erdige Substanz samt
Patina etc. als Rest
3-47%
Eisenoxyd ....
4'95%
100-00%
Patinabestandteile u.
organ. Substanzen
11-75%
1 oo-oo°/u
3. Fragment eines Armbandes, ganz in morsche, grüne
Patina verwandelt:
Kupfer. 54-40%
Zinn.•. 5’65%
Blei. 0*41 °/0
Erdiges, darunter auch Eisenoxyd. 4-25%
Patinabestandteile, Kohlensäure, Sauerstoff, Wasser
und Organisches als Rest. 35'29%
~~ ioo-oo%
Kein Zink, dagegen ganz bestimmt nachgewiesen
Spuren von Nickel,
Schmückung beträchtliche Abstufungen. Als Mate-
rial wurde die bereits oben erwähnte Tonerde ver-
wendet, die mit stärkerem Zusatz von körnigem
Sand zur Herstellung der dickwandigen, grob ge-
arbeiteten Ossuarien verwendet wurde. Zahlreicher
als aus anderen Kastellierfunden sind dünnwandige,
feiner gearbeitete Gefäße in den Gräbern von Pola
gefunden worden, die aus besserem Material ohne
Sandzusatz bestehen. Auch sonst gewinnt es den
Anschein, daß die küstennahen Kastellierleute in
dem keramischen Handwerk ihren binnenländischen
Stammesg'enossen, z. B. denen des Kastelliers von
Vermo, etwas voraus wraren. Immerhin ist auch
hier die Topfware ohne Töpferscheibe aus freier
Hand, doch mit großer Geschicklichkeit erzeugt.
Die Oberfläche der Gefäße ist mit Stäbchen fein
geglättet worden und in braune oder schwarze
Färbung gebracht. Es sind auch Beispiele vor-
handen, die zeigen, daß dunkle Gefäße mit weißer
Farbe überzogen wurden. Unverzierte Gefäße
scheinen viel seltener zu sein als solche, die orna-
mentalen Schmuck tragen. Die Ornamentierung
wurde in verschiedener Weise durchgeführt:
1. Am rohesten sind die Reliefornamente aus-
geführt, die wie die Träger derselben schlechtes
Arbeitsmaterial, rohe und unbeholfene Arbeit er-
kennen lassen.
Ornamente: «) Zickzack zwischen zwei Reifen,
rohe Tupfenleiste einfach, feinere Tupfenleisten
in zwei bis vier parallelen Zügen am Gefäßrand.
Schnurimitation (durch schräge Schnitte in runde,
parallel zum Gefäßrand laufende Randleisten her-
vorgerufen) auf situlaähnlichen Gefäßen und Urnen
(Fig. 88, 12. und 9).
2. Ornament, durch eingeschnittene, furchen-
ähnliche Linie hergestellt, die mit weißer Kreide
Fig. 87 Bruchstücke eines ornamentierten Grabgefäßes
ausgefüllt sind: schiefer Mäander und Streifen. In
Fragmenten von einem großen, weitbauchigen Gefäß
(Fig. 87).
6