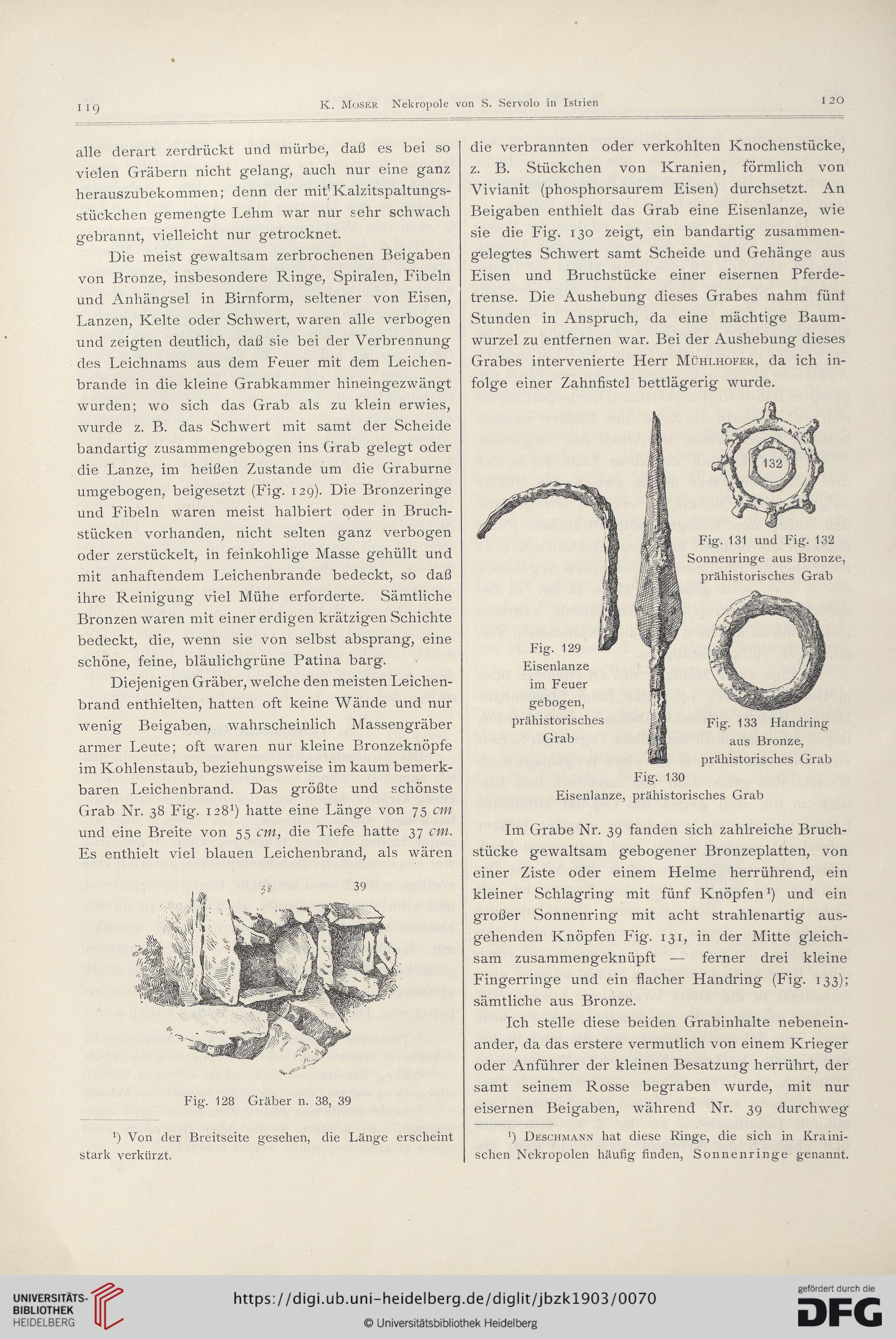119
K. Moser Nekropole von S. Servolo in Istrien
I 20
alle derart zerdrückt und mürbe, daß es bei so
vielen Gräbern nicht gelang, auch nur eine ganz
herauszubekommen; denn der mit'Kalzitspaltungs-
stückchen gemengte Lehm war nur sehr schwach
gebrannt, vielleicht nur getrocknet.
Die meist gewaltsam zerbrochenen Beigaben
von Bronze, insbesondere Ringe, .Spiralen, Fibeln
und Anhängsel in Birnform, seltener von Eisen,
Lanzen, Kelte oder Schwert, waren alle verbogen
und zeigten deutlich, daß sie bei der Verbrennung
des Leichnams aus dem Feuer mit dem Leichen-
brande in die kleine Grabkammer hineing'ezwängt
wurden; wo sich das Grab als zu klein erwies,
wurde z. B. das Schwert mit samt der Scheide
bandartig zusammengebogen ins Grab gelegt oder
die Lanze, im heißen Zustande um die Graburne
umgebogen, beig'esetzt (Fig. 129). Die Bronzeringe
und Fibeln waren meist halbiert oder in Bruch-
stücken vorhanden, nicht selten ganz verbogen
oder zerstückelt, in feinkohlige Masse gehüllt und
mit anhaftendem Leichenbrande bedeckt, so daß
ihre Reinigung viel Mühe erforderte. Sämtliche
Bronzen waren mit einer erdigen krätzigen Schichte
bedeckt, die, wenn sie von selbst absprang, eine
schöne, feine, bläulichgrüne Patina barg.
Diejenigen Gräber, welche den meisten Leichen-
brand enthielten, hatten oft keine Wände und nur
wenig Beigaben, wahrscheinlich Massengräber
armer Leute; oft waren nur kleine Bronzeknöpfe
im Kohlenstaub, beziehungsweise im kaum bemerk-
baren Leichenbrand. Das größte und schönste
Grab Nr. 38 Fig. 1281) hatte eine Länge von 75 cm
und eine Breite von 55 cm, die Tiefe hatte 37 cm.
Es enthielt viel blauen Leichenbrand, als wären
Fig. 128 Gräber n. 38, 39
b Von der Breitseite gesehen, die Länge erscheint
stark verkürzt.
die verbrannten oder verkohlten Knochenstücke,
z. B. Stückchen von Kranien, förmlich von
Vivianit (phosphorsaurem Eisen) durchsetzt. An
Beigaben enthielt das Grab eine Eisenlanze, wie
sie die Fig. 130 zeigt, ein bandartig zusammen-
gelegtes Schwert samt Scheide und Gehänge aus
Eisen und Bruchstücke einer eisernen Pferde-
trense. Die Aushebung dieses Grabes nahm fünf
Stunden in Anspruch, da eine mächtige Baum-
wurzel zu entfernen war. Bei der Aushebung dieses
Grabes intervenierte Herr Mühlhofer, da ich in-
folge einer Zahnfistcl bettlägerig wurde.
Eisenlanze
im Feuer
gebogen,
prähistorisches
Grab
Eisenlanze,
Fig. 131 und Fig. 132
Sonnenringe aus Bronze,
prähistorisches Grab
Fig. 133 Handring
aus Bronze,
prähistorisches Grab
Fig. 130
prähistorisches Grab
Im Grabe Nr. 39 fanden sich zahlreiche Bruch-
stücke gewaltsam gebogener Bronzeplatten, von
einer Ziste oder einem Helme herrührend, ein
kleiner Schlagring mit fünf Knöpfen1) und ein
großer Sonnenring mit acht strahlenartig aus-
gehenden Knöpfen Fig. 131, in der Mitte gleich-
sam zusammengeknüpft — ferner drei kleine
Fingerringe und ein flacher Handring (Fig. 133);
sämtliche aus Bronze.
Ich stelle diese beiden Grabinhalte nebenein-
ander, da das erstere vermutlich von einem Krieger
oder Anführer der kleinen Besatzung herrührt, der
samt seinem Rosse begraben wurde, mit nur
eisernen Beigaben, während Nr. 39 durchweg'
b Deschmann hat diese Ringe, die sich in Kra mi-
schen Nekropolen häufig finden, Sonnenringe genannt.
K. Moser Nekropole von S. Servolo in Istrien
I 20
alle derart zerdrückt und mürbe, daß es bei so
vielen Gräbern nicht gelang, auch nur eine ganz
herauszubekommen; denn der mit'Kalzitspaltungs-
stückchen gemengte Lehm war nur sehr schwach
gebrannt, vielleicht nur getrocknet.
Die meist gewaltsam zerbrochenen Beigaben
von Bronze, insbesondere Ringe, .Spiralen, Fibeln
und Anhängsel in Birnform, seltener von Eisen,
Lanzen, Kelte oder Schwert, waren alle verbogen
und zeigten deutlich, daß sie bei der Verbrennung
des Leichnams aus dem Feuer mit dem Leichen-
brande in die kleine Grabkammer hineing'ezwängt
wurden; wo sich das Grab als zu klein erwies,
wurde z. B. das Schwert mit samt der Scheide
bandartig zusammengebogen ins Grab gelegt oder
die Lanze, im heißen Zustande um die Graburne
umgebogen, beig'esetzt (Fig. 129). Die Bronzeringe
und Fibeln waren meist halbiert oder in Bruch-
stücken vorhanden, nicht selten ganz verbogen
oder zerstückelt, in feinkohlige Masse gehüllt und
mit anhaftendem Leichenbrande bedeckt, so daß
ihre Reinigung viel Mühe erforderte. Sämtliche
Bronzen waren mit einer erdigen krätzigen Schichte
bedeckt, die, wenn sie von selbst absprang, eine
schöne, feine, bläulichgrüne Patina barg.
Diejenigen Gräber, welche den meisten Leichen-
brand enthielten, hatten oft keine Wände und nur
wenig Beigaben, wahrscheinlich Massengräber
armer Leute; oft waren nur kleine Bronzeknöpfe
im Kohlenstaub, beziehungsweise im kaum bemerk-
baren Leichenbrand. Das größte und schönste
Grab Nr. 38 Fig. 1281) hatte eine Länge von 75 cm
und eine Breite von 55 cm, die Tiefe hatte 37 cm.
Es enthielt viel blauen Leichenbrand, als wären
Fig. 128 Gräber n. 38, 39
b Von der Breitseite gesehen, die Länge erscheint
stark verkürzt.
die verbrannten oder verkohlten Knochenstücke,
z. B. Stückchen von Kranien, förmlich von
Vivianit (phosphorsaurem Eisen) durchsetzt. An
Beigaben enthielt das Grab eine Eisenlanze, wie
sie die Fig. 130 zeigt, ein bandartig zusammen-
gelegtes Schwert samt Scheide und Gehänge aus
Eisen und Bruchstücke einer eisernen Pferde-
trense. Die Aushebung dieses Grabes nahm fünf
Stunden in Anspruch, da eine mächtige Baum-
wurzel zu entfernen war. Bei der Aushebung dieses
Grabes intervenierte Herr Mühlhofer, da ich in-
folge einer Zahnfistcl bettlägerig wurde.
Eisenlanze
im Feuer
gebogen,
prähistorisches
Grab
Eisenlanze,
Fig. 131 und Fig. 132
Sonnenringe aus Bronze,
prähistorisches Grab
Fig. 133 Handring
aus Bronze,
prähistorisches Grab
Fig. 130
prähistorisches Grab
Im Grabe Nr. 39 fanden sich zahlreiche Bruch-
stücke gewaltsam gebogener Bronzeplatten, von
einer Ziste oder einem Helme herrührend, ein
kleiner Schlagring mit fünf Knöpfen1) und ein
großer Sonnenring mit acht strahlenartig aus-
gehenden Knöpfen Fig. 131, in der Mitte gleich-
sam zusammengeknüpft — ferner drei kleine
Fingerringe und ein flacher Handring (Fig. 133);
sämtliche aus Bronze.
Ich stelle diese beiden Grabinhalte nebenein-
ander, da das erstere vermutlich von einem Krieger
oder Anführer der kleinen Besatzung herrührt, der
samt seinem Rosse begraben wurde, mit nur
eisernen Beigaben, während Nr. 39 durchweg'
b Deschmann hat diese Ringe, die sich in Kra mi-
schen Nekropolen häufig finden, Sonnenringe genannt.