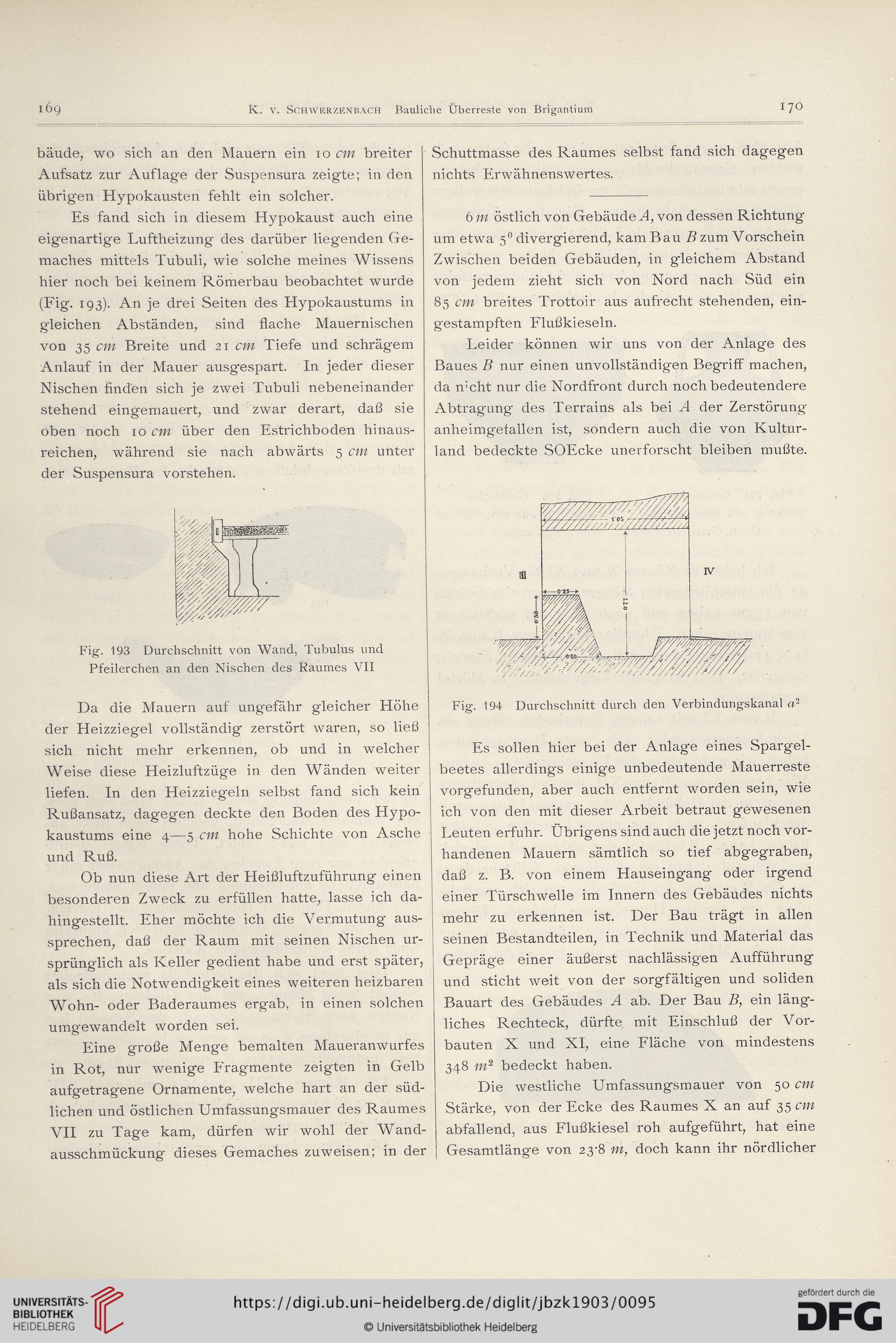169
K. v. Schwerzenbach Bauliche Überreste von Brigantium
bäude, wo sich an den Mauern ein 10 cm breiter
Aufsatz zur Auflag'e der Suspensura zeigte; in den
übrigen Hypokausten fehlt ein solcher.
Es fand sich in diesem Hypokaust auch eine
eigenartige Luftheizung des darüber liegenden Ge-
maches mittels Tubuli, wie solche meines Wissens
hier noch bei keinem Römerbau beobachtet wurde
(Fig. 193). An je drei Seiten des Hypokaustums in
gleichen Abständen, sind flache Mauernischen
von 35 cm Breite und 21 cm Tiefe und schrägem
Anlauf in der Mauer ausgespart. In jeder dieser
Nischen finden sich je zwei Tubuli nebeneinander
stehend eingemauert, und zwar derart, daß sie
oben noch 10 cm über den Estrichboden hinaus-
reichen, während sie nach abwärts 5 «w unter
der Suspensura vorstehen.
Fig. 193 Durchschnitt von Wand, Tubulus und
Pfeilerchen an den Nischen des Raumes VII
Schuttmasse des Raumes selbst fand sich dagegen
nichts Erwähnenswertes.
6 m östlich von Gebäude A, von dessen Richtung
um etwa 50 divergierend, kam Bau B zum Vorschein
Zwischen beiden Gebäuden, in gleichem Abstand
von jedem zieht sich von Nord nach Süd ein
85 cm breites Trottoir aus aufrecht stehenden, ein-
gestampften Flußkieseln.
Leider können wir uns von der Anlage des
Baues B nur einen unvollständigen Begriff machen,
da n;cht nur die Nordfront durch noch bedeutendere
Abtragung des Terrains als bei A der Zerstörung
anheimg'etallen ist, sondern auch die von Kultur-
land bedeckte SOEcke unerforscht bleiben mußte.
Da die Mauern auf ungefähr gleicher Höhe
der Heizziegel vollständig zerstört waren, so ließ
sich nicht mehr erkennen, ob und in welcher
Weise diese Heizluftzüge in den Wänden weiter
liefen. In den Heizziegeln selbst fand sich kein
Rußansatz, dagegen deckte den Boden des Hypo-
kaustums eine 4—5 cm hohe Schichte von Asche
und Ruß.
Ob nun diese Art der Heißluftzuführung einen
besonderen Zweck zu erfüllen hatte, lasse ich da-
hingestellt. Eher möchte ich die Vermutung aus-
sprechen, daß der Raum mit seinen Nischen ur-
sprünglich als Keller gedient habe und erst später,
als sich die Notwendigkeit eines weiteren heizbaren
Wohn- oder Baderaumes ergab, in einen solchen
umgewandelt worden sei.
Eine große Menge bemalten Maueranwurfes
in Rot, nur wenige Fragmente zeigten in Gelb
aufgetragene Ornamente, welche hart an der süd-
lichen und östlichen Umfassungsmauer des Raumes
VII zu Tage kam, dürfen wir wohl der Wand-
ausschmückung dieses Gemaches zuweisen; in der
Fig. 194 Durchschnitt durch den Verbindungskanal a2
Es sollen hier bei der Anlage eines Spargel-
beetes allerdings einige unbedeutende Mauerreste
vorgefunden, aber auch entfernt worden sein, wie
ich von den mit dieser Arbeit betraut gewesenen
Leuten erfuhr. Übrigens sind auch die jetzt noch vor-
handenen Mauern sämtlich so tief abgegraben,
daß z. B. von einem Hauseingang oder irgend
einer Türschwelle im Innern des Gebäudes nichts
mehr zu erkennen ist. Der Bau trägt in allen
seinen Bestandteilen, in Technik und Material das
Gepräge einer äußerst nachlässigen Aufführung
und sticht weit von der sorgfältigen und soliden
Bauart des Gebäudes A ab. Der Bau B, ein läng-
liches Rechteck, dürfte mit Einschluß der Vor-
bauten X und XI, eine Fläche von mindestens
348 m? bedeckt haben.
Die westliche Umfassungsmauer von 50 cm
Stärke, von der Ecke des Raumes X an auf 35 cm
abfallend, aus Flußkiesel roh aufgeführt, hat eine
Gesamtlänge von 23-8 m, doch kann ihr nördlicher
K. v. Schwerzenbach Bauliche Überreste von Brigantium
bäude, wo sich an den Mauern ein 10 cm breiter
Aufsatz zur Auflag'e der Suspensura zeigte; in den
übrigen Hypokausten fehlt ein solcher.
Es fand sich in diesem Hypokaust auch eine
eigenartige Luftheizung des darüber liegenden Ge-
maches mittels Tubuli, wie solche meines Wissens
hier noch bei keinem Römerbau beobachtet wurde
(Fig. 193). An je drei Seiten des Hypokaustums in
gleichen Abständen, sind flache Mauernischen
von 35 cm Breite und 21 cm Tiefe und schrägem
Anlauf in der Mauer ausgespart. In jeder dieser
Nischen finden sich je zwei Tubuli nebeneinander
stehend eingemauert, und zwar derart, daß sie
oben noch 10 cm über den Estrichboden hinaus-
reichen, während sie nach abwärts 5 «w unter
der Suspensura vorstehen.
Fig. 193 Durchschnitt von Wand, Tubulus und
Pfeilerchen an den Nischen des Raumes VII
Schuttmasse des Raumes selbst fand sich dagegen
nichts Erwähnenswertes.
6 m östlich von Gebäude A, von dessen Richtung
um etwa 50 divergierend, kam Bau B zum Vorschein
Zwischen beiden Gebäuden, in gleichem Abstand
von jedem zieht sich von Nord nach Süd ein
85 cm breites Trottoir aus aufrecht stehenden, ein-
gestampften Flußkieseln.
Leider können wir uns von der Anlage des
Baues B nur einen unvollständigen Begriff machen,
da n;cht nur die Nordfront durch noch bedeutendere
Abtragung des Terrains als bei A der Zerstörung
anheimg'etallen ist, sondern auch die von Kultur-
land bedeckte SOEcke unerforscht bleiben mußte.
Da die Mauern auf ungefähr gleicher Höhe
der Heizziegel vollständig zerstört waren, so ließ
sich nicht mehr erkennen, ob und in welcher
Weise diese Heizluftzüge in den Wänden weiter
liefen. In den Heizziegeln selbst fand sich kein
Rußansatz, dagegen deckte den Boden des Hypo-
kaustums eine 4—5 cm hohe Schichte von Asche
und Ruß.
Ob nun diese Art der Heißluftzuführung einen
besonderen Zweck zu erfüllen hatte, lasse ich da-
hingestellt. Eher möchte ich die Vermutung aus-
sprechen, daß der Raum mit seinen Nischen ur-
sprünglich als Keller gedient habe und erst später,
als sich die Notwendigkeit eines weiteren heizbaren
Wohn- oder Baderaumes ergab, in einen solchen
umgewandelt worden sei.
Eine große Menge bemalten Maueranwurfes
in Rot, nur wenige Fragmente zeigten in Gelb
aufgetragene Ornamente, welche hart an der süd-
lichen und östlichen Umfassungsmauer des Raumes
VII zu Tage kam, dürfen wir wohl der Wand-
ausschmückung dieses Gemaches zuweisen; in der
Fig. 194 Durchschnitt durch den Verbindungskanal a2
Es sollen hier bei der Anlage eines Spargel-
beetes allerdings einige unbedeutende Mauerreste
vorgefunden, aber auch entfernt worden sein, wie
ich von den mit dieser Arbeit betraut gewesenen
Leuten erfuhr. Übrigens sind auch die jetzt noch vor-
handenen Mauern sämtlich so tief abgegraben,
daß z. B. von einem Hauseingang oder irgend
einer Türschwelle im Innern des Gebäudes nichts
mehr zu erkennen ist. Der Bau trägt in allen
seinen Bestandteilen, in Technik und Material das
Gepräge einer äußerst nachlässigen Aufführung
und sticht weit von der sorgfältigen und soliden
Bauart des Gebäudes A ab. Der Bau B, ein läng-
liches Rechteck, dürfte mit Einschluß der Vor-
bauten X und XI, eine Fläche von mindestens
348 m? bedeckt haben.
Die westliche Umfassungsmauer von 50 cm
Stärke, von der Ecke des Raumes X an auf 35 cm
abfallend, aus Flußkiesel roh aufgeführt, hat eine
Gesamtlänge von 23-8 m, doch kann ihr nördlicher