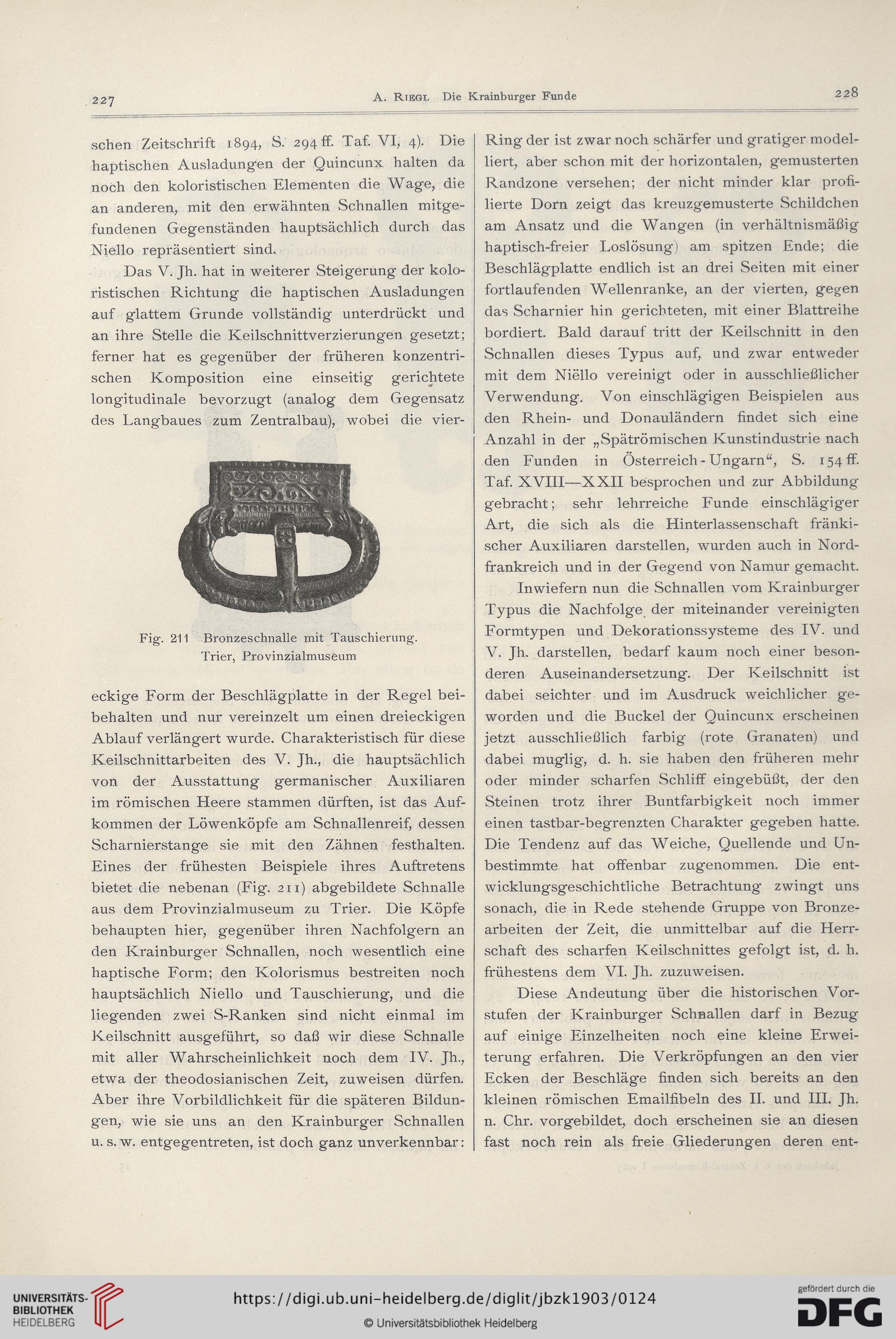227
A. Riegl Die Krainburger Funde
228
sehen Zeitschrift 1894, S. 294 ff. Taf. VI, 4). Die
haptischen Ausladungen der Quincunx halten da
noch den koloristischen Elementen die Wage, die
an anderen, mit den erwähnten Schnallen mitge-
fundenen Gegenständen hauptsächlich durch das
Niello repräsentiert sind.
Das V. Jh. hat in weiterer Steigerung der kolo-
ristischen Richtung die haptischen Ausladungen
auf glattem Grunde vollständig unterdrückt und
an ihre Stelle die Keilschnittverzierungen gesetzt;
ferner hat es gegenüber der früheren konzentri-
schen Komposition eine einseitig gerichtete
longitudinale bevorzugt (analog dem Gegensatz
des Langbaues zum Zentralbau), wobei die vier-
Fig. 211 Bronzeschnalle mit Tauschierung.
Trier, Provinzialmuseum
eckige Form der Beschlägplatte in der Regel bei-
behalten und nur vereinzelt um einen dreieckigen
Ablauf verlängert wurde. Charakteristisch für diese
Keilschnittarbeiten des V. Jh., die hauptsächlich
von der Ausstattung germanischer Auxiliären
im römischen Heere stammen dürften, ist das Auf-
kommen der Löwenköpfe am Schnallenreif, dessen
Scharnierstange sie mit den Zähnen festhalten.
Eines der frühesten Beispiele ihres Auftretens
bietet die nebenan (Fig. 211) abgebildete Schnalle
aus dem Provinzialmuseum zu Trier. Die Köpfe
behaupten hier, gegenüber ihren Nachfolgern an
den Krainburger Schnallen, noch wesentlich eine
haptische Form; den Kolorismus bestreiten noch
hauptsächlich Niello und Tauschierung, und die
liegenden zwei S-Ranken sind nicht einmal im
Keilschnitt ausgeführt, so daß wir diese Schnalle
mit aller Wahrscheinlichkeit noch dem IV. Jh.,
etwa der theodosianischen Zeit, zu weisen dürfen.
Aber ihre Vorbildlichkeit für die späteren Bildun-
gen, wie sie uns an den Krainburger Schnallen
u. s. w. entgegentreten, ist doch ganz unverkennbar:
Ring der ist zwar noch schärfer und grätiger model-
liert, aber schon mit der horizontalen, gemusterten
Randzone versehen; der nicht minder klar profi-
lierte Dorn zeigt das kreuzgemusterte Schildchen
am Ansatz und die Wangen (in verhältnismäßig
haptisch-freier Loslösung) am spitzen Ende; die
Beschlägplatte endlich ist an drei Seiten mit einer
fortlaufenden Wellenranke, an der vierten, gegen
das Scharnier hin gerichteten, mit einer Blattreihe
bordiert. Bald darauf tritt der Keilschnitt in den
Schnallen dieses Typus auf, und zwar entweder
mit dem Niello vereinigt oder in ausschließlicher
Verwendung. Von einschlägig’en Beispielen aus
den Rhein- und Donauländern findet sich eine
Anzahl in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach
den Funden in Österreich - Ungarn“, S. 154 ff.
Taf. XVIII—XXII besprochen und zur Abbildung
gebracht; sehr lehrreiche Funde einschlägiger
Art, die sich als die Hinterlassenschaft fränki-
scher Auxiliären darstellen, wurden auch in Nord-
frankreich und in der Gegend von Namur gemacht.
Inwiefern nun die Schnallen vom Krainburg'er
Typus die Nachfolge der miteinander vereinigten
Formtypen und Dekorationssysteme des IV. und
V. Jh. darstellen, bedarf kaum noch einer beson-
deren Auseinandersetzung. Der Keilschnitt ist
dabei seichter und im Ausdruck weichlicher ge-
worden und die Buckel der Quincunx erscheinen
jetzt ausschließlich farbig (rote Granaten) und
dabei muglig, d. h. sie haben den früheren mehr
oder minder scharfen Schliff eingebüßt, der den
Steinen trotz ihrer Buntfarbigkeit noch immer
einen tastbar-begrenzten Charakter gegeben hatte.
Die Tendenz auf das Weiche, Quellende und Un-
bestimmte hat offenbar zugenommen. Die ent-
wicklungsgeschichtliche Betrachtung zwingt uns
sonach, die in Rede stehende Gruppe von Bronze-
arbeiten der Zeit, die unmittelbar auf die Herr-
schaft des scharfen Keilschnittes gefolgt ist, d. h.
frühestens dem VI. Jh. zuzuweisen.
Diese Andeutung über die historischen Vor-
stufen der Krainburger Schnallen darf in Bezug
auf einige Einzelheiten noch eine kleine Erwei-
terung erfahren. Die Verkröpfungen an den vier
Ecken der Beschläge finden sich bereits an den
kleinen römischen Emailfibeln des II. und III. Jh.
n. Chr. vorgebildet, doch erscheinen sie an diesen
fast noch rein als freie Gliederungen deren ent-
A. Riegl Die Krainburger Funde
228
sehen Zeitschrift 1894, S. 294 ff. Taf. VI, 4). Die
haptischen Ausladungen der Quincunx halten da
noch den koloristischen Elementen die Wage, die
an anderen, mit den erwähnten Schnallen mitge-
fundenen Gegenständen hauptsächlich durch das
Niello repräsentiert sind.
Das V. Jh. hat in weiterer Steigerung der kolo-
ristischen Richtung die haptischen Ausladungen
auf glattem Grunde vollständig unterdrückt und
an ihre Stelle die Keilschnittverzierungen gesetzt;
ferner hat es gegenüber der früheren konzentri-
schen Komposition eine einseitig gerichtete
longitudinale bevorzugt (analog dem Gegensatz
des Langbaues zum Zentralbau), wobei die vier-
Fig. 211 Bronzeschnalle mit Tauschierung.
Trier, Provinzialmuseum
eckige Form der Beschlägplatte in der Regel bei-
behalten und nur vereinzelt um einen dreieckigen
Ablauf verlängert wurde. Charakteristisch für diese
Keilschnittarbeiten des V. Jh., die hauptsächlich
von der Ausstattung germanischer Auxiliären
im römischen Heere stammen dürften, ist das Auf-
kommen der Löwenköpfe am Schnallenreif, dessen
Scharnierstange sie mit den Zähnen festhalten.
Eines der frühesten Beispiele ihres Auftretens
bietet die nebenan (Fig. 211) abgebildete Schnalle
aus dem Provinzialmuseum zu Trier. Die Köpfe
behaupten hier, gegenüber ihren Nachfolgern an
den Krainburger Schnallen, noch wesentlich eine
haptische Form; den Kolorismus bestreiten noch
hauptsächlich Niello und Tauschierung, und die
liegenden zwei S-Ranken sind nicht einmal im
Keilschnitt ausgeführt, so daß wir diese Schnalle
mit aller Wahrscheinlichkeit noch dem IV. Jh.,
etwa der theodosianischen Zeit, zu weisen dürfen.
Aber ihre Vorbildlichkeit für die späteren Bildun-
gen, wie sie uns an den Krainburger Schnallen
u. s. w. entgegentreten, ist doch ganz unverkennbar:
Ring der ist zwar noch schärfer und grätiger model-
liert, aber schon mit der horizontalen, gemusterten
Randzone versehen; der nicht minder klar profi-
lierte Dorn zeigt das kreuzgemusterte Schildchen
am Ansatz und die Wangen (in verhältnismäßig
haptisch-freier Loslösung) am spitzen Ende; die
Beschlägplatte endlich ist an drei Seiten mit einer
fortlaufenden Wellenranke, an der vierten, gegen
das Scharnier hin gerichteten, mit einer Blattreihe
bordiert. Bald darauf tritt der Keilschnitt in den
Schnallen dieses Typus auf, und zwar entweder
mit dem Niello vereinigt oder in ausschließlicher
Verwendung. Von einschlägig’en Beispielen aus
den Rhein- und Donauländern findet sich eine
Anzahl in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach
den Funden in Österreich - Ungarn“, S. 154 ff.
Taf. XVIII—XXII besprochen und zur Abbildung
gebracht; sehr lehrreiche Funde einschlägiger
Art, die sich als die Hinterlassenschaft fränki-
scher Auxiliären darstellen, wurden auch in Nord-
frankreich und in der Gegend von Namur gemacht.
Inwiefern nun die Schnallen vom Krainburg'er
Typus die Nachfolge der miteinander vereinigten
Formtypen und Dekorationssysteme des IV. und
V. Jh. darstellen, bedarf kaum noch einer beson-
deren Auseinandersetzung. Der Keilschnitt ist
dabei seichter und im Ausdruck weichlicher ge-
worden und die Buckel der Quincunx erscheinen
jetzt ausschließlich farbig (rote Granaten) und
dabei muglig, d. h. sie haben den früheren mehr
oder minder scharfen Schliff eingebüßt, der den
Steinen trotz ihrer Buntfarbigkeit noch immer
einen tastbar-begrenzten Charakter gegeben hatte.
Die Tendenz auf das Weiche, Quellende und Un-
bestimmte hat offenbar zugenommen. Die ent-
wicklungsgeschichtliche Betrachtung zwingt uns
sonach, die in Rede stehende Gruppe von Bronze-
arbeiten der Zeit, die unmittelbar auf die Herr-
schaft des scharfen Keilschnittes gefolgt ist, d. h.
frühestens dem VI. Jh. zuzuweisen.
Diese Andeutung über die historischen Vor-
stufen der Krainburger Schnallen darf in Bezug
auf einige Einzelheiten noch eine kleine Erwei-
terung erfahren. Die Verkröpfungen an den vier
Ecken der Beschläge finden sich bereits an den
kleinen römischen Emailfibeln des II. und III. Jh.
n. Chr. vorgebildet, doch erscheinen sie an diesen
fast noch rein als freie Gliederungen deren ent-