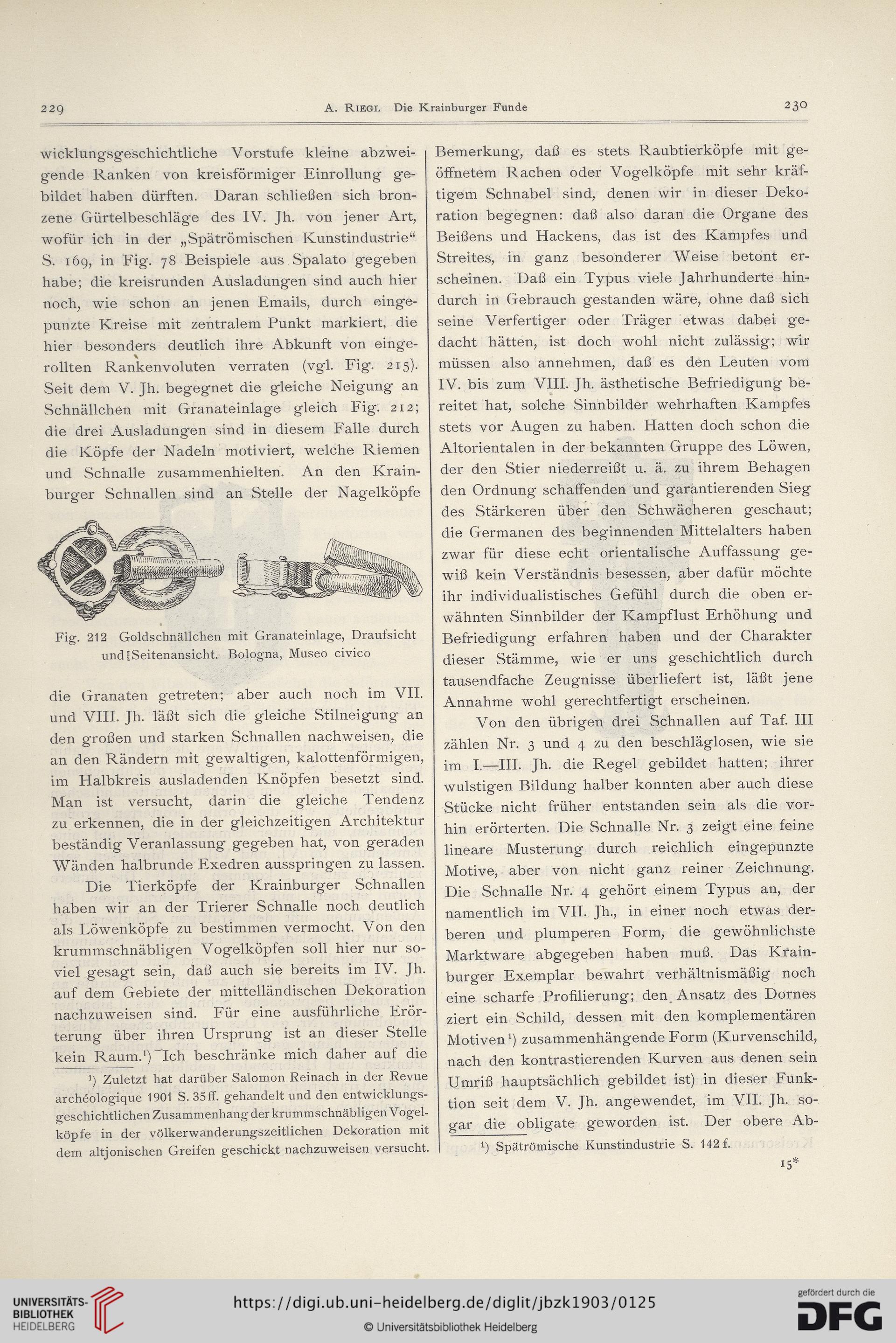229
A. Riegt, Die Krainburger Funde
230
wicklungsgeschichtliche Vorstufe kleine abzwei-
gende Ranken von kreisförmiger Einrollung ge-
bildet haben dürften. Daran schließen sich bron-
zene Gürtelbeschläge des IV. Jh. von jener Art,
wofür ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie“
S. 169, in Fig. 78 Beispiele aus Spalato gegeben
habe; die kreisrunden Ausladungen sind auch hier
noch, wie schon an jenen Emails, durch einge-
punzte Kreise mit zentralem Punkt markiert, die
hier besonders deutlich ihre Abkunft von einge-
rollten Rankenvoluten verraten (vgl. Fig. 215).
Seit dem V. Jh. begegnet die gleiche Neigung- an
Schnällchen mit Granateinlage gleich Fig. 212;
die drei Ausladungen sind in diesem Falle durch
die Köpfe der Nadeln motiviert, welche Riemen
und Schnalle zusammenhielten. An den Krain-
burger Schnallen sind an Stelle der Nagelköpfe
Fig. 212 Goldschnällchen mit Granateinlage, Draufsicht
und £ Seitenansicht. Bologna, Museo civico
die Granaten getreten; aber auch noch im VII.
und VIII. Jh. läßt sich die gleiche Stilneigung an
den großen und starken Schnallen nachweisen, die
an den Rändern mit gewaltigen, kalottenförmigen,
im Halbkreis ausladenden Knöpfen besetzt sind.
Man ist versucht, darin die gleiche Tendenz
zu erkennen, die in der gleichzeitigen Architektur
beständig Veranlassung gegeben hat, von geraden
Wänden halbrunde Exedren ausspringen zu lassen.
Die Tierköpfe der Krainburger Schnallen
haben wir an der Trierer Schnalle noch deutlich
als Löwenköpfe zu bestimmen vermocht. Von den
krummschnäbligen Vogelköpfen soll hier nur so-
viel gesagt sein, daß auch sie bereits im IV. Jh.
auf dem Gebiete der mittelländischen Dekoration
nachzuweisen sind. Für eine ausführliche Erör-
terung über ihren Ursprung ist an dieser Stelle
kein Raum.1) "Ich beschränke mich daher auf die
J) Zuletzt hat darüber Salomon Reinach in der Revue
archeologique 1901 S. 35ff. gehandelt und den entwicklungs-
geschichtlichen Zusammenhang der krummschnäbligen Vogel-
köpfe in der völkerwanderungszeitlichen Dekoration mit
dem altjonischen Greifen geschickt nachzuweisen versucht.
Bemerkung, daß es stets Raubtierköpfe mit ge-
öffnetem Rachen oder Vogelköpfe mit sehr kräf-
tigem Schnabel sind, denen wir in dieser Deko-
ration begegnen: daß also daran die Organe des
Beißens und Hackens, das ist des Kampfes und
Streites, in ganz besonderer Weise betont er-
scheinen. Daß ein Typus viele Jahrhunderte hin-
durch in Gebrauch gestanden wäre, ohne daß sich
seine Verfertiger oder Träger etwas dabei ge-
dacht hätten, ist doch wohl nicht zulässig; wir
müssen also annehmen, daß es den Leuten vom
IV. bis zum VIII. Jh. ästhetische Befriedigung be-
reitet hat, solche Sinnbilder wehrhaften Kampfes
stets vor Augen zu haben. Hatten doch schon die
Altorientalen in der bekannten Gruppe des Löwen,
der den Stier niederreißt u. ä. zu ihrem Behagen
den Ordnung schaffenden und garantierenden Sieg
des Stärkeren über den Schwächeren geschaut;
die Germanen des beginnenden Mittelalters haben
zwar für diese echt orientalische Auffassung ge-
wiß kein Verständnis besessen, aber dafür möchte
ihr individualistisches Gefühl durch die oben er-
wähnten Sinnbilder der Kampflust Erhöhung und
Befriedigung erfahren haben und der Charakter
dieser Stämme, wie er uns geschichtlich durch
tausendfache Zeugnisse überliefert ist, läßt jene
Annahme wohl gerechtfertigt erscheinen.
Von den übrigen drei Schnallen auf Taf. III
zählen Nr. 3 und 4 zu den beschläglosen, wie sie
im I.—III. Jh. die Regel gebildet hatten; ihrer
wulstigen Bildung halber konnten aber auch diese
Stücke nicht früher entstanden sein als die vor-
hin erörterten. Die Schnalle Nr. 3 zeigt eine feine
lineare Musterung durch reichlich eingepunzte
Motive, • aber von nicht ganz reiner Zeichnung.
Die Schnalle Nr. 4 gehört einem Typus an, der
namentlich im VII. Jh., in einer noch etwas der-
beren und plumperen Form, die gewöhnlichste
Marktware abgegeben haben muß. Das Krain-
burger Exemplar bewahrt verhältnismäßig noch
eine scharfe Profilierung; den Ansatz des Dornes
ziert ein Schild, dessen mit den komplementären
Motiven1) zusammenhängende Form (Kurvenschild,
nach den kontrastierenden Kurven aus denen sein
Umriß hauptsächlich gebildet ist) in dieser Funk-
tion seit dem V. Jh. angewendet, im VII. Jh. so-
gar die obligate geworden ist. Der obere Ab-
x) Spätrömische Kunstindustrie S. 142f.
15*
A. Riegt, Die Krainburger Funde
230
wicklungsgeschichtliche Vorstufe kleine abzwei-
gende Ranken von kreisförmiger Einrollung ge-
bildet haben dürften. Daran schließen sich bron-
zene Gürtelbeschläge des IV. Jh. von jener Art,
wofür ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie“
S. 169, in Fig. 78 Beispiele aus Spalato gegeben
habe; die kreisrunden Ausladungen sind auch hier
noch, wie schon an jenen Emails, durch einge-
punzte Kreise mit zentralem Punkt markiert, die
hier besonders deutlich ihre Abkunft von einge-
rollten Rankenvoluten verraten (vgl. Fig. 215).
Seit dem V. Jh. begegnet die gleiche Neigung- an
Schnällchen mit Granateinlage gleich Fig. 212;
die drei Ausladungen sind in diesem Falle durch
die Köpfe der Nadeln motiviert, welche Riemen
und Schnalle zusammenhielten. An den Krain-
burger Schnallen sind an Stelle der Nagelköpfe
Fig. 212 Goldschnällchen mit Granateinlage, Draufsicht
und £ Seitenansicht. Bologna, Museo civico
die Granaten getreten; aber auch noch im VII.
und VIII. Jh. läßt sich die gleiche Stilneigung an
den großen und starken Schnallen nachweisen, die
an den Rändern mit gewaltigen, kalottenförmigen,
im Halbkreis ausladenden Knöpfen besetzt sind.
Man ist versucht, darin die gleiche Tendenz
zu erkennen, die in der gleichzeitigen Architektur
beständig Veranlassung gegeben hat, von geraden
Wänden halbrunde Exedren ausspringen zu lassen.
Die Tierköpfe der Krainburger Schnallen
haben wir an der Trierer Schnalle noch deutlich
als Löwenköpfe zu bestimmen vermocht. Von den
krummschnäbligen Vogelköpfen soll hier nur so-
viel gesagt sein, daß auch sie bereits im IV. Jh.
auf dem Gebiete der mittelländischen Dekoration
nachzuweisen sind. Für eine ausführliche Erör-
terung über ihren Ursprung ist an dieser Stelle
kein Raum.1) "Ich beschränke mich daher auf die
J) Zuletzt hat darüber Salomon Reinach in der Revue
archeologique 1901 S. 35ff. gehandelt und den entwicklungs-
geschichtlichen Zusammenhang der krummschnäbligen Vogel-
köpfe in der völkerwanderungszeitlichen Dekoration mit
dem altjonischen Greifen geschickt nachzuweisen versucht.
Bemerkung, daß es stets Raubtierköpfe mit ge-
öffnetem Rachen oder Vogelköpfe mit sehr kräf-
tigem Schnabel sind, denen wir in dieser Deko-
ration begegnen: daß also daran die Organe des
Beißens und Hackens, das ist des Kampfes und
Streites, in ganz besonderer Weise betont er-
scheinen. Daß ein Typus viele Jahrhunderte hin-
durch in Gebrauch gestanden wäre, ohne daß sich
seine Verfertiger oder Träger etwas dabei ge-
dacht hätten, ist doch wohl nicht zulässig; wir
müssen also annehmen, daß es den Leuten vom
IV. bis zum VIII. Jh. ästhetische Befriedigung be-
reitet hat, solche Sinnbilder wehrhaften Kampfes
stets vor Augen zu haben. Hatten doch schon die
Altorientalen in der bekannten Gruppe des Löwen,
der den Stier niederreißt u. ä. zu ihrem Behagen
den Ordnung schaffenden und garantierenden Sieg
des Stärkeren über den Schwächeren geschaut;
die Germanen des beginnenden Mittelalters haben
zwar für diese echt orientalische Auffassung ge-
wiß kein Verständnis besessen, aber dafür möchte
ihr individualistisches Gefühl durch die oben er-
wähnten Sinnbilder der Kampflust Erhöhung und
Befriedigung erfahren haben und der Charakter
dieser Stämme, wie er uns geschichtlich durch
tausendfache Zeugnisse überliefert ist, läßt jene
Annahme wohl gerechtfertigt erscheinen.
Von den übrigen drei Schnallen auf Taf. III
zählen Nr. 3 und 4 zu den beschläglosen, wie sie
im I.—III. Jh. die Regel gebildet hatten; ihrer
wulstigen Bildung halber konnten aber auch diese
Stücke nicht früher entstanden sein als die vor-
hin erörterten. Die Schnalle Nr. 3 zeigt eine feine
lineare Musterung durch reichlich eingepunzte
Motive, • aber von nicht ganz reiner Zeichnung.
Die Schnalle Nr. 4 gehört einem Typus an, der
namentlich im VII. Jh., in einer noch etwas der-
beren und plumperen Form, die gewöhnlichste
Marktware abgegeben haben muß. Das Krain-
burger Exemplar bewahrt verhältnismäßig noch
eine scharfe Profilierung; den Ansatz des Dornes
ziert ein Schild, dessen mit den komplementären
Motiven1) zusammenhängende Form (Kurvenschild,
nach den kontrastierenden Kurven aus denen sein
Umriß hauptsächlich gebildet ist) in dieser Funk-
tion seit dem V. Jh. angewendet, im VII. Jh. so-
gar die obligate geworden ist. Der obere Ab-
x) Spätrömische Kunstindustrie S. 142f.
15*