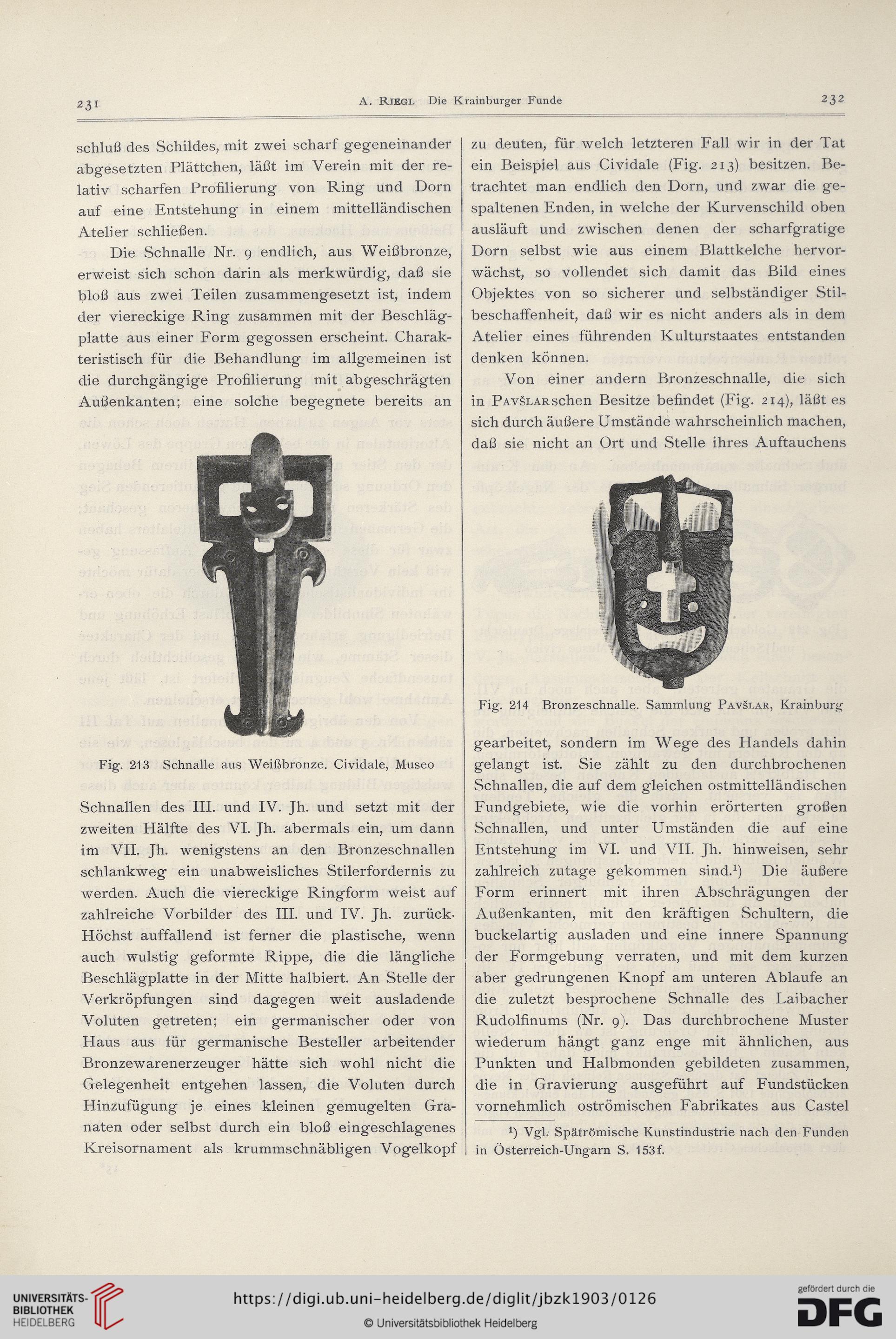231
232
A. Riegl Die Krainburger Funde
Schluß des Schildes, mit zwei scharf gegeneinander
abgesetzten Plättchen, läßt im Verein mit der re-
lativ scharfen Profilierung von Ring und Dorn
auf eine Entstehung in einem mittelländischen
Atelier schließen.
Die Schnalle Nr. 9 endlich, aus Weißbronze,
erweist sich schon darin als merkwürdig, daß sie
bloß aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, indem
der viereckige Ring zusammen mit der Beschläg-
platte aus einer Form gegossen erscheint. Charak-
teristisch für die Behandlung im allgemeinen ist
die durchgängige Profilierung mit abgeschrägten
Außenkanten; eine solche begegnete bereits an
Fig. 213 Schnalle aus Weißbronze. Cividale, Museo
Schnallen des III. und IV. Jh. und setzt mit der
zweiten Hälfte des VI. Jh. abermals ein, um dann
im VII. Jh. wenigstens an den Bronzeschnallen
schlankweg ein unabweisliches Stilerfordernis zu
werden. Auch die viereckige Ringform weist auf
zahlreiche Vorbilder des III. und IV. Jh. zurück-
Höchst auffallend ist ferner die plastische, wenn
auch wulstig geformte Rippe, die die längliche
Beschlägplatte in der Mitte halbiert. An Stelle der
Verkröpfungen sind dagegen weit ausladende
Voluten getreten; ein germanischer oder von
Haus aus für germanische Besteller arbeitender
Bronzewarenerzeuger hätte sich wohl nicht die
Gelegenheit entgehen lassen, die Voluten durch
Hinzufügung je eines kleinen gemugelten Gra-
naten oder selbst durch ein bloß eingeschlagenes
Kreisornament als krummschnäbligen Vogelkopf
zu deuten, für welch letzteren Fall wir in der Tat
ein Beispiel aus Cividale (Fig. 213) besitzen. Be-
trachtet man endlich den Dorn, und zwar die ge-
spaltenen Enden, in welche der Kurvenschild oben
ausläuft und zwischen denen der scharfgratige
Dorn selbst wie aus einem Blattkelche hervor-
wächst, so vollendet sich damit das Bild eines
Objektes von so sicherer und selbständiger Stil-
beschaffenheit, daß wir es nicht anders als in dem
Atelier eines führenden Kulturstaates entstanden
denken können.
Von einer andern Bronzeschnalle, die sich
in PAväLARschen Besitze befindet (Fig. 214), läßt es
sich durch äußere Umstände wahrscheinlich machen,
daß sie nicht an Ort und Stelle ihres Auftauchens
Fig. 214 Bronzeschnalle. Sammlung Pav§t.ar, Krainburg
gearbeitet, sondern im Wege des Handels dahin
gelangt ist. Sie zählt zu den durchbrochenen
Schnallen, die auf dem gleichen ostmittelländischen
Fundgebiete, wie die vorhin erörterten großen
Schnallen, und unter Umständen die auf eine
Entstehung im VI. und VII. Jh. hinweisen, sehr
zahlreich zutage gekommen sind.1) Die äußere
Form erinnert mit ihren Abschrägungen der
Außenkanten, mit den kräftigen Schultern, die
buckelartig ausladen und eine innere Spannung
der Formgebung verraten, und mit dem kurzen
aber gedrungenen Knopf am unteren Ablaufe an
die zuletzt besprochene Schnalle des Laibacher
Rudolfinums (Nr. 9). Das durchbrochene Muster
wiederum hängt ganz enge mit ähnlichen, aus
Punkten und Halbmonden gebildeten zusammen,
die in Gravierung ausgeführt auf Fundstücken
vornehmlich oströmischen Fabrikates aus Castel
1) Vgl. Spätrömische Kunstindustrie nach den Funden
in Österreich-Ungarn S. 153f.
232
A. Riegl Die Krainburger Funde
Schluß des Schildes, mit zwei scharf gegeneinander
abgesetzten Plättchen, läßt im Verein mit der re-
lativ scharfen Profilierung von Ring und Dorn
auf eine Entstehung in einem mittelländischen
Atelier schließen.
Die Schnalle Nr. 9 endlich, aus Weißbronze,
erweist sich schon darin als merkwürdig, daß sie
bloß aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, indem
der viereckige Ring zusammen mit der Beschläg-
platte aus einer Form gegossen erscheint. Charak-
teristisch für die Behandlung im allgemeinen ist
die durchgängige Profilierung mit abgeschrägten
Außenkanten; eine solche begegnete bereits an
Fig. 213 Schnalle aus Weißbronze. Cividale, Museo
Schnallen des III. und IV. Jh. und setzt mit der
zweiten Hälfte des VI. Jh. abermals ein, um dann
im VII. Jh. wenigstens an den Bronzeschnallen
schlankweg ein unabweisliches Stilerfordernis zu
werden. Auch die viereckige Ringform weist auf
zahlreiche Vorbilder des III. und IV. Jh. zurück-
Höchst auffallend ist ferner die plastische, wenn
auch wulstig geformte Rippe, die die längliche
Beschlägplatte in der Mitte halbiert. An Stelle der
Verkröpfungen sind dagegen weit ausladende
Voluten getreten; ein germanischer oder von
Haus aus für germanische Besteller arbeitender
Bronzewarenerzeuger hätte sich wohl nicht die
Gelegenheit entgehen lassen, die Voluten durch
Hinzufügung je eines kleinen gemugelten Gra-
naten oder selbst durch ein bloß eingeschlagenes
Kreisornament als krummschnäbligen Vogelkopf
zu deuten, für welch letzteren Fall wir in der Tat
ein Beispiel aus Cividale (Fig. 213) besitzen. Be-
trachtet man endlich den Dorn, und zwar die ge-
spaltenen Enden, in welche der Kurvenschild oben
ausläuft und zwischen denen der scharfgratige
Dorn selbst wie aus einem Blattkelche hervor-
wächst, so vollendet sich damit das Bild eines
Objektes von so sicherer und selbständiger Stil-
beschaffenheit, daß wir es nicht anders als in dem
Atelier eines führenden Kulturstaates entstanden
denken können.
Von einer andern Bronzeschnalle, die sich
in PAväLARschen Besitze befindet (Fig. 214), läßt es
sich durch äußere Umstände wahrscheinlich machen,
daß sie nicht an Ort und Stelle ihres Auftauchens
Fig. 214 Bronzeschnalle. Sammlung Pav§t.ar, Krainburg
gearbeitet, sondern im Wege des Handels dahin
gelangt ist. Sie zählt zu den durchbrochenen
Schnallen, die auf dem gleichen ostmittelländischen
Fundgebiete, wie die vorhin erörterten großen
Schnallen, und unter Umständen die auf eine
Entstehung im VI. und VII. Jh. hinweisen, sehr
zahlreich zutage gekommen sind.1) Die äußere
Form erinnert mit ihren Abschrägungen der
Außenkanten, mit den kräftigen Schultern, die
buckelartig ausladen und eine innere Spannung
der Formgebung verraten, und mit dem kurzen
aber gedrungenen Knopf am unteren Ablaufe an
die zuletzt besprochene Schnalle des Laibacher
Rudolfinums (Nr. 9). Das durchbrochene Muster
wiederum hängt ganz enge mit ähnlichen, aus
Punkten und Halbmonden gebildeten zusammen,
die in Gravierung ausgeführt auf Fundstücken
vornehmlich oströmischen Fabrikates aus Castel
1) Vgl. Spätrömische Kunstindustrie nach den Funden
in Österreich-Ungarn S. 153f.