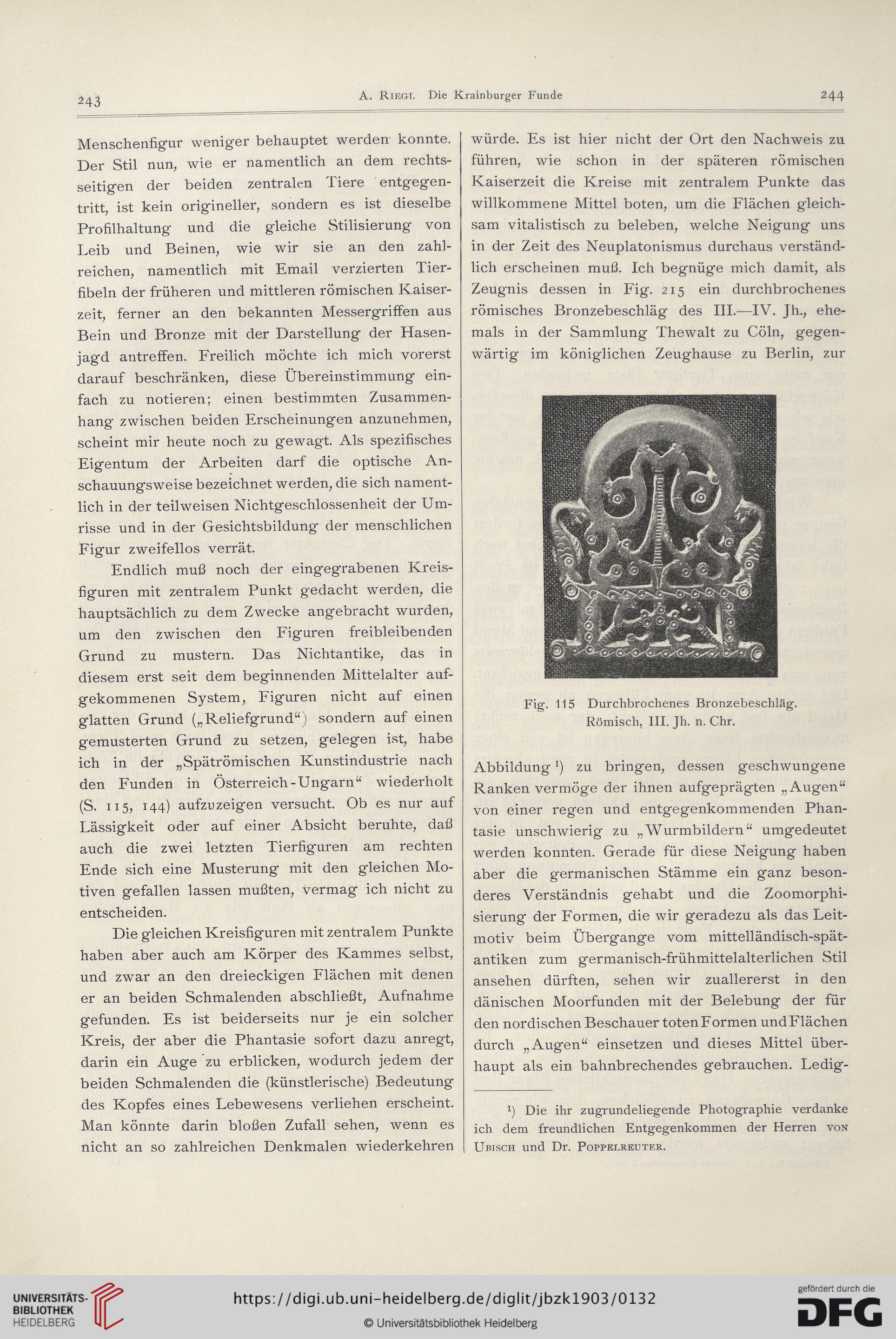244
243
A. Riegi. Die Krainburger Funde
Menschenfigur weniger behauptet werden konnte.
Der Stil nun, wie er namentlich an dem rechts-
seitigen der beiden zentralen Tiere entgegen-
tritt, ist kein origineller, sondern es ist dieselbe
Profilhaltung und die gleiche Stilisierung von
Leib und Beinen, wie wir sie an den zahl-
reichen, namentlich mit Email verzierten Tier-
fibeln der früheren und mittleren römischen Kaiser-
zeit, ferner an den bekannten Messergriffen aus
Bein und Bronze mit der Darstellung der Hasen-
jagd antreffen. Freilich möchte ich mich vorerst
darauf beschränken, diese Übereinstimmung ein-
fach zu notieren; einen bestimmten Zusammen-
hang zwischen beiden Erscheinungen anzunehmen,
scheint mir heute noch zu gewagt. Als spezifisches
Eigentum der Arbeiten darf die optische An-
schauungsweise bezeichnet werden, die sich nament-
lich in der teilweisen Nichtgeschlossenheit der Um-
risse und in der Gesichtsbildung der menschlichen
Figur zweifellos verrät.
Endlich muß noch der eingegrabenen Kreis-
figuren mit zentralem Punkt gedacht werden, die
hauptsächlich zu dem Zwecke angebracht wurden,
um den zwischen den Figuren freibleibenden
Grund zu mustern. Das Nichtantike, das in
diesem erst seit dem beginnenden Mittelalter auf-
gekommenen System, Figuren nicht auf einen
glatten Grund („Reliefgrund“) sondern auf einen
gemusterten Grund zu setzen, gelegen ist, habe
ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach
den Funden in Österreich-Ungarn“ wiederholt
(S. ii 5, 144) aufzuzeigen versucht. Ob es nur auf
Lässigkeit oder auf einer Absicht beruhte, daß
auch die zwei letzten Tierfiguren am rechten
Ende sich eine Musterung mit den gleichen Mo-
tiven gefallen lassen mußten, vermag ich nicht zu
entscheiden.
Die gleichen Kreisfiguren mit zentralem Punkte
haben aber auch am Körper des Kammes selbst,
und zwar an den dreieckigen Flächen mit denen
er an beiden Schmalenden abschließt, Aufnahme
gefunden. Es ist beiderseits nur je ein solcher
Kreis, der aber die Phantasie sofort dazu anregt,
darin ein Auge zu erblicken, wodurch jedem der
beiden Schmalenden die (künstlerische) Bedeutung
des Kopfes eines Lebewesens verliehen erscheint.
Man könnte darin bloßen Zufall sehen, wenn es
nicht an so zahlreichen Denkmalen wiederkehren
würde. Es ist hier nicht der Ort den Nachweis zu
führen, wie schon in der späteren römischen
Kaiserzeit die Kreise mit zentralem Punkte das
willkommene Mittel boten, um die Flächen gleich-
sam vitalistisch zu beleben, welche Neigung uns
in der Zeit des Neuplatonismus durchaus verständ-
lich erscheinen muß. Ich begnüge mich damit, als
Zeugnis dessen in Fig. 215 ein durchbrochenes
römisches Bronzebeschläg des III.—IV. Jh., ehe-
mals in der Sammlung Thewalt zu Cöln, gegen-
wärtig im königlichen Zeughause zu Berlin, zur
Fig. 115 Durchbrochenes Bronzebeschläg.
Römisch, III. Jh. n. Chr.
Abbildung’) zu bringen, dessen geschwungene
Ranken vermöge der ihnen aufgeprägten „Augen“
von einer regen und entgegenkommenden Phan-
tasie unschwierig zu „Wurmbildern“ umgedeutet
werden konnten. Gerade für diese Neigung haben
aber die germanischen Stämme ein ganz beson-
deres Verständnis gehabt und die Zoomorphi-
sierung der Formen, die wir geradezu als das Leit-
motiv beim Übergange vom mittelländisch-spät-
antiken zum germanisch-frühmittelalterlichen Stil
ansehen dürften, sehen wir zuallererst in den
dänischen Moorfunden mit der Belebung der für
den nordischen Beschauer toten Formen und Flächen
durch „Augen“ einsetzen und dieses Mittel über-
haupt als ein bahnbrechendes gebrauchen. Ledig-
*) Die ihr zugrundeliegende Photographie verdanke
ich dem freundlichen Entgegenkommen der Herren von
Ubisch und Dr. Poppelreuter.
243
A. Riegi. Die Krainburger Funde
Menschenfigur weniger behauptet werden konnte.
Der Stil nun, wie er namentlich an dem rechts-
seitigen der beiden zentralen Tiere entgegen-
tritt, ist kein origineller, sondern es ist dieselbe
Profilhaltung und die gleiche Stilisierung von
Leib und Beinen, wie wir sie an den zahl-
reichen, namentlich mit Email verzierten Tier-
fibeln der früheren und mittleren römischen Kaiser-
zeit, ferner an den bekannten Messergriffen aus
Bein und Bronze mit der Darstellung der Hasen-
jagd antreffen. Freilich möchte ich mich vorerst
darauf beschränken, diese Übereinstimmung ein-
fach zu notieren; einen bestimmten Zusammen-
hang zwischen beiden Erscheinungen anzunehmen,
scheint mir heute noch zu gewagt. Als spezifisches
Eigentum der Arbeiten darf die optische An-
schauungsweise bezeichnet werden, die sich nament-
lich in der teilweisen Nichtgeschlossenheit der Um-
risse und in der Gesichtsbildung der menschlichen
Figur zweifellos verrät.
Endlich muß noch der eingegrabenen Kreis-
figuren mit zentralem Punkt gedacht werden, die
hauptsächlich zu dem Zwecke angebracht wurden,
um den zwischen den Figuren freibleibenden
Grund zu mustern. Das Nichtantike, das in
diesem erst seit dem beginnenden Mittelalter auf-
gekommenen System, Figuren nicht auf einen
glatten Grund („Reliefgrund“) sondern auf einen
gemusterten Grund zu setzen, gelegen ist, habe
ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach
den Funden in Österreich-Ungarn“ wiederholt
(S. ii 5, 144) aufzuzeigen versucht. Ob es nur auf
Lässigkeit oder auf einer Absicht beruhte, daß
auch die zwei letzten Tierfiguren am rechten
Ende sich eine Musterung mit den gleichen Mo-
tiven gefallen lassen mußten, vermag ich nicht zu
entscheiden.
Die gleichen Kreisfiguren mit zentralem Punkte
haben aber auch am Körper des Kammes selbst,
und zwar an den dreieckigen Flächen mit denen
er an beiden Schmalenden abschließt, Aufnahme
gefunden. Es ist beiderseits nur je ein solcher
Kreis, der aber die Phantasie sofort dazu anregt,
darin ein Auge zu erblicken, wodurch jedem der
beiden Schmalenden die (künstlerische) Bedeutung
des Kopfes eines Lebewesens verliehen erscheint.
Man könnte darin bloßen Zufall sehen, wenn es
nicht an so zahlreichen Denkmalen wiederkehren
würde. Es ist hier nicht der Ort den Nachweis zu
führen, wie schon in der späteren römischen
Kaiserzeit die Kreise mit zentralem Punkte das
willkommene Mittel boten, um die Flächen gleich-
sam vitalistisch zu beleben, welche Neigung uns
in der Zeit des Neuplatonismus durchaus verständ-
lich erscheinen muß. Ich begnüge mich damit, als
Zeugnis dessen in Fig. 215 ein durchbrochenes
römisches Bronzebeschläg des III.—IV. Jh., ehe-
mals in der Sammlung Thewalt zu Cöln, gegen-
wärtig im königlichen Zeughause zu Berlin, zur
Fig. 115 Durchbrochenes Bronzebeschläg.
Römisch, III. Jh. n. Chr.
Abbildung’) zu bringen, dessen geschwungene
Ranken vermöge der ihnen aufgeprägten „Augen“
von einer regen und entgegenkommenden Phan-
tasie unschwierig zu „Wurmbildern“ umgedeutet
werden konnten. Gerade für diese Neigung haben
aber die germanischen Stämme ein ganz beson-
deres Verständnis gehabt und die Zoomorphi-
sierung der Formen, die wir geradezu als das Leit-
motiv beim Übergange vom mittelländisch-spät-
antiken zum germanisch-frühmittelalterlichen Stil
ansehen dürften, sehen wir zuallererst in den
dänischen Moorfunden mit der Belebung der für
den nordischen Beschauer toten Formen und Flächen
durch „Augen“ einsetzen und dieses Mittel über-
haupt als ein bahnbrechendes gebrauchen. Ledig-
*) Die ihr zugrundeliegende Photographie verdanke
ich dem freundlichen Entgegenkommen der Herren von
Ubisch und Dr. Poppelreuter.