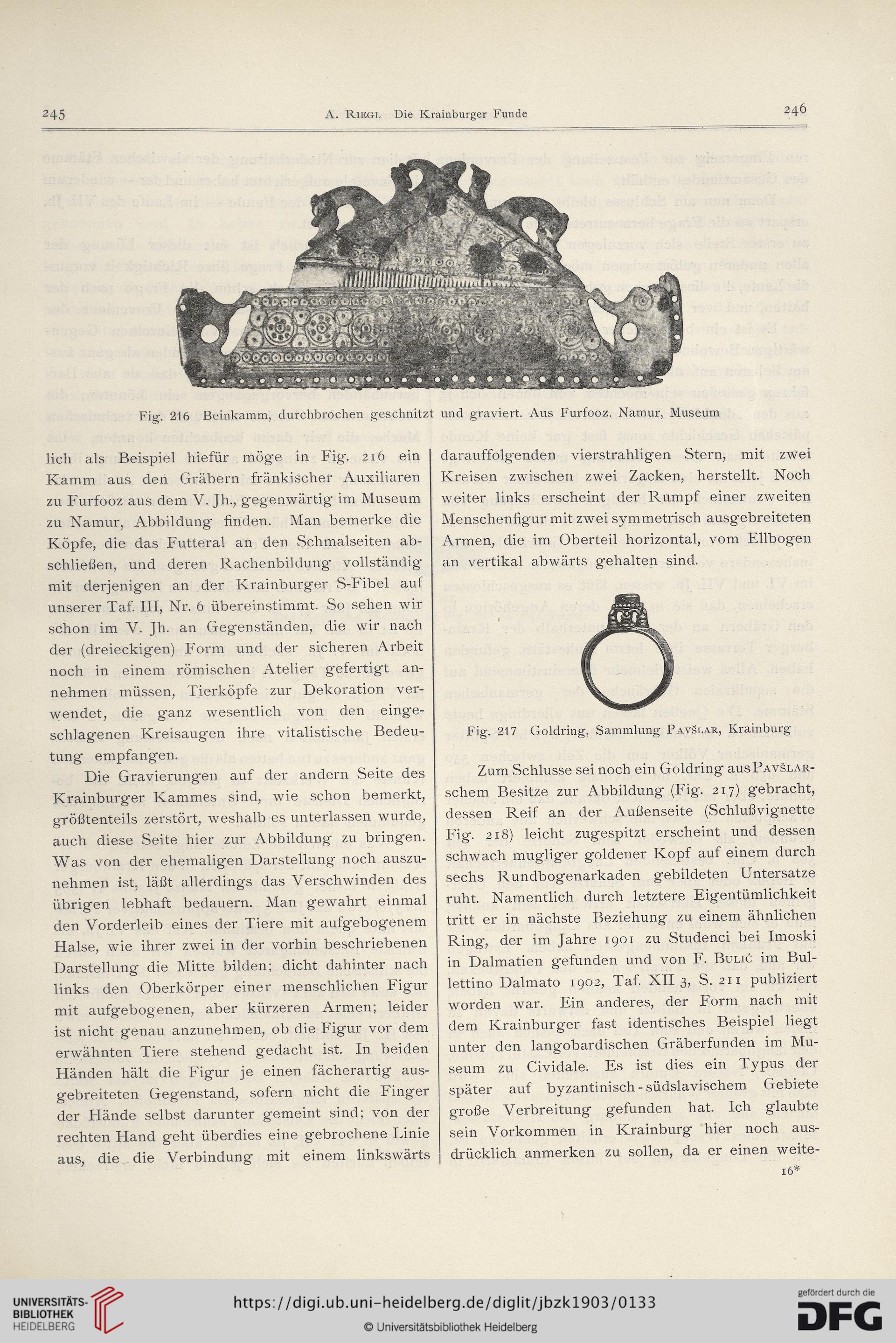245
A. Riegl Die Krainburger Funde
246
Fig. 216 Beinkamm, durchbrochen geschnitzt und graviert. Aus Furfooz. Namur, Museum
lieh als Beispiel hiefür mög'e in Fig. 216 ein
Kamm aus den Gräbern fränkischer Auxiliären
zu Furfooz aus dem V. Jh., gegenwärtig im Museum
zu Namur, Abbildung' finden. Man bemerke die
Köpfe, die das Futteral an den Schmalseiten ab-
schließen, und deren Rachenbildung vollständig
mit derjenigen an der Krainburger S-Fibel auf
unserer Taf. III, Nr. 6 übereinstimmt. So sehen wir
schon im V. Jh. an Gegenständen, die wir nach
der (dreieckigen) Form und der sicheren Arbeit
noch in einem römischen Atelier gefertigt an-
nehmen müssen, Tierköpfe zur Dekoration ver-
wendet, die ganz wesentlich von den einge-
schlagenen Kreisaugen ihre vitalistische Bedeu-
tung empfangen.
Die Gravierungen auf der andern Seite des
Krainburger Kammes sind, wie schon bemerkt,
größtenteils zerstört, weshalb es unterlassen wurde,
auch diese Seite hier zur Abbildung zu bringen.
Was von der ehemaligen Darstellung' noch auszu-
nehmen ist, läßt allerdings das Verschwinden des
übrigen lebhaft bedauern. Man gewahrt einmal
den Vorderleib eines der Tiere mit aufgebogenem
Halse, wie ihrer zwei in der vorhin beschriebenen
Darstellung die Mitte bilden; dicht dahinter nach
links den Oberkörper einer menschlichen Figur
mit aufgebogenen, aber kürzeren Armen; leider
ist nicht genau anzunehmen, ob die Figur vor dem
erwähnten Tiere stehend gedacht ist. In beiden
Händen hält die Figur je einen fächerartig aus-
gebreiteten Gegenstand, sofern nicht die Finger
der Hände selbst darunter gemeint sind; von der
rechten Hand geht überdies eine gebrochene Linie
aus, die . die Verbindung mit einem linkswärts
darauffolg'enden vierstrahligen Stern, mit zwei
Kreisen zwischen zwei Zacken, herstellt. Noch
weiter links erscheint der Rumpf einer zweiten
Menschenfigur mit zwei symmetrisch ausgebreiteten
Armen, die im Oberteil horizontal, vom Ellbogen
an vertikal abwärts gehalten sind.
Fig. 217 Goldring, Sammlung PavSlar, Krainburg
Zum Schlüsse sei noch ein Goldring ausPAväLAR-
schem Besitze zur Abbildung (Fig. 217) gebracht,
dessen Reif an der Außenseite (SchlußVignette
Fig. 218) leicht zugespitzt erscheint und dessen
schwach mugliger goldener Kopf auf einem durch
sechs Rundbogenarkaden gebildeten Untersatze
ruht. Namentlich durch letztere Eigentümlichkeit
tritt er in nächste Beziehung zu einem ähnlichen
Ring, der im Jahre 1901 zu Studenci bei Imoski
in Dalmatien gefunden und von F. Buliö im Bul-
lettino Dalmato 1902, Taf. XII 3, S. 211 publiziert
worden war. Ein anderes, der Form nach mit
dem Krainburger fast identisches Beispiel liegt
unter den langobardischen Gräberfunden im Mu-
seum zu Cividale. Es ist dies ein Typus der
später auf byzantinisch - südslavischem Gebiete
große Verbreitung gefunden hat. Ich glaubte
sein Vorkommen in Krainburg hier noch aus-
drücklich anmerken zu sollen, da er einen weite-
16*
A. Riegl Die Krainburger Funde
246
Fig. 216 Beinkamm, durchbrochen geschnitzt und graviert. Aus Furfooz. Namur, Museum
lieh als Beispiel hiefür mög'e in Fig. 216 ein
Kamm aus den Gräbern fränkischer Auxiliären
zu Furfooz aus dem V. Jh., gegenwärtig im Museum
zu Namur, Abbildung' finden. Man bemerke die
Köpfe, die das Futteral an den Schmalseiten ab-
schließen, und deren Rachenbildung vollständig
mit derjenigen an der Krainburger S-Fibel auf
unserer Taf. III, Nr. 6 übereinstimmt. So sehen wir
schon im V. Jh. an Gegenständen, die wir nach
der (dreieckigen) Form und der sicheren Arbeit
noch in einem römischen Atelier gefertigt an-
nehmen müssen, Tierköpfe zur Dekoration ver-
wendet, die ganz wesentlich von den einge-
schlagenen Kreisaugen ihre vitalistische Bedeu-
tung empfangen.
Die Gravierungen auf der andern Seite des
Krainburger Kammes sind, wie schon bemerkt,
größtenteils zerstört, weshalb es unterlassen wurde,
auch diese Seite hier zur Abbildung zu bringen.
Was von der ehemaligen Darstellung' noch auszu-
nehmen ist, läßt allerdings das Verschwinden des
übrigen lebhaft bedauern. Man gewahrt einmal
den Vorderleib eines der Tiere mit aufgebogenem
Halse, wie ihrer zwei in der vorhin beschriebenen
Darstellung die Mitte bilden; dicht dahinter nach
links den Oberkörper einer menschlichen Figur
mit aufgebogenen, aber kürzeren Armen; leider
ist nicht genau anzunehmen, ob die Figur vor dem
erwähnten Tiere stehend gedacht ist. In beiden
Händen hält die Figur je einen fächerartig aus-
gebreiteten Gegenstand, sofern nicht die Finger
der Hände selbst darunter gemeint sind; von der
rechten Hand geht überdies eine gebrochene Linie
aus, die . die Verbindung mit einem linkswärts
darauffolg'enden vierstrahligen Stern, mit zwei
Kreisen zwischen zwei Zacken, herstellt. Noch
weiter links erscheint der Rumpf einer zweiten
Menschenfigur mit zwei symmetrisch ausgebreiteten
Armen, die im Oberteil horizontal, vom Ellbogen
an vertikal abwärts gehalten sind.
Fig. 217 Goldring, Sammlung PavSlar, Krainburg
Zum Schlüsse sei noch ein Goldring ausPAväLAR-
schem Besitze zur Abbildung (Fig. 217) gebracht,
dessen Reif an der Außenseite (SchlußVignette
Fig. 218) leicht zugespitzt erscheint und dessen
schwach mugliger goldener Kopf auf einem durch
sechs Rundbogenarkaden gebildeten Untersatze
ruht. Namentlich durch letztere Eigentümlichkeit
tritt er in nächste Beziehung zu einem ähnlichen
Ring, der im Jahre 1901 zu Studenci bei Imoski
in Dalmatien gefunden und von F. Buliö im Bul-
lettino Dalmato 1902, Taf. XII 3, S. 211 publiziert
worden war. Ein anderes, der Form nach mit
dem Krainburger fast identisches Beispiel liegt
unter den langobardischen Gräberfunden im Mu-
seum zu Cividale. Es ist dies ein Typus der
später auf byzantinisch - südslavischem Gebiete
große Verbreitung gefunden hat. Ich glaubte
sein Vorkommen in Krainburg hier noch aus-
drücklich anmerken zu sollen, da er einen weite-
16*