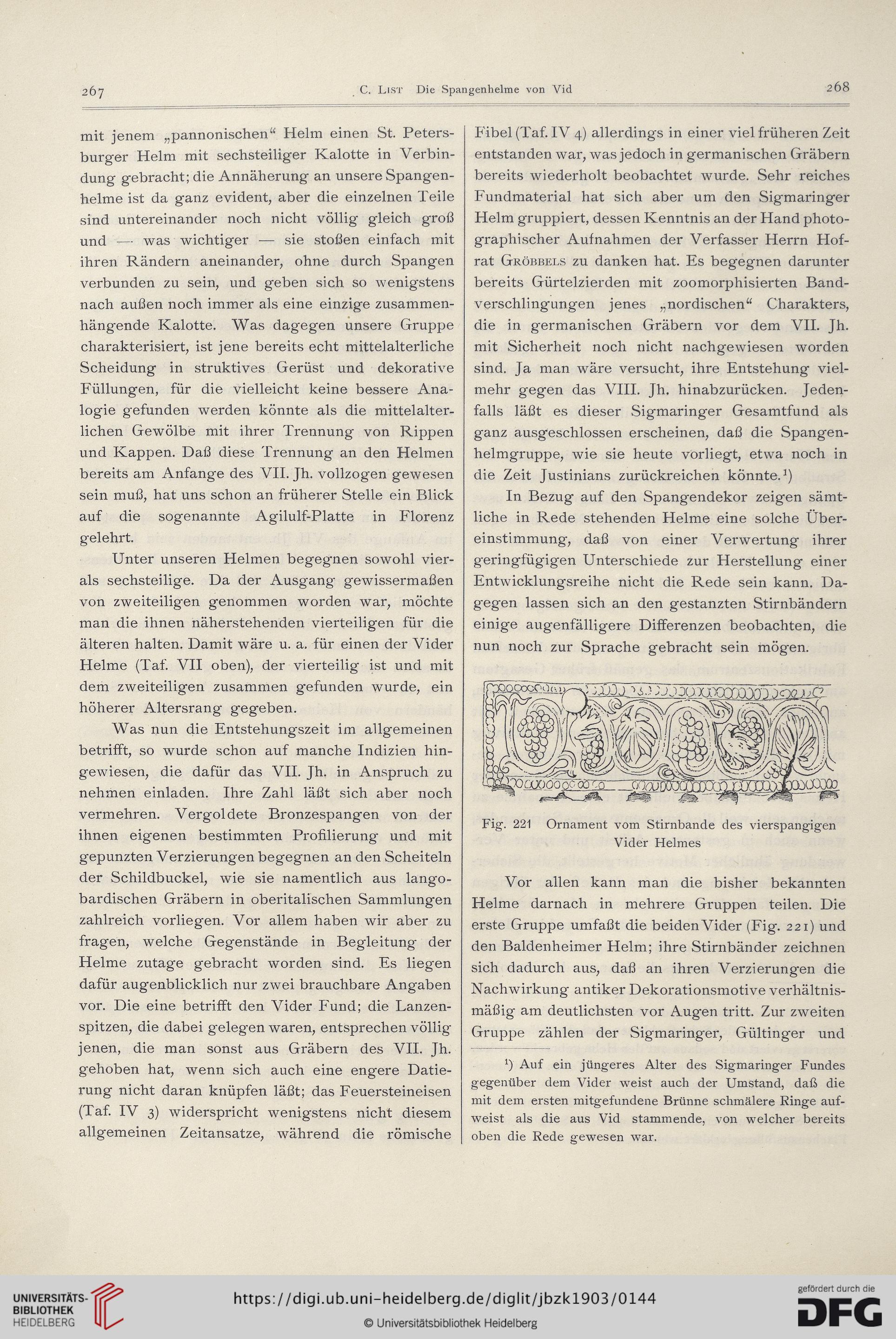267
C. List Die Spangenhelme von Vid
268
mit jenem „pannonischen“ Helm einen St. Peters-
burger Helm mit sechsteiliger Kalotte in Verbin-
dung gebracht; die Annäherung an unsere Spangen-
helme ist da ganz evident, aber die einzelnen Teile
sind untereinander noch nicht völlig gleich groß
und — was wichtiger — sie stoßen einfach mit
ihren Rändern aneinander, ohne durch Spangen
verbunden zu sein, und geben sich so wenigstens
nach außen noch immer als eine einzige zusammen-
hängende Kalotte. Was dagegen unsere Gruppe
charakterisiert, ist jene bereits echt mittelalterliche
Scheidung in struktives Gerüst und dekorative
Füllungen, für die vielleicht keine bessere Ana-
logie gefunden werden könnte als die mittelalter-
lichen Gewölbe mit ihrer Trennung von Rippen
und Kappen. Daß diese Trennung an den Helmen
bereits am Anfänge des VII. Jh. vollzogen gewesen
sein muß, hat uns schon an früherer Stelle ein Blick
auf die sogenannte Agilulf-Platte in Florenz
gelehrt.
Unter unseren Helmen begegnen sowohl vier-
als sechsteilige. Da der Ausgang gewissermaßen
von zweiteiligen genommen worden war, möchte
man die ihnen näherstehenden vierteiligen für die
älteren halten. Damit wäre u. a. für einen der Vider
Helme (Taf. VII oben), der vierteilig ist und mit
dem zweiteiligen zusammen gefunden wurde, ein
höherer Altersrang gegeben.
Was nun die Entstehungszeit im allgemeinen
betrifft, so wurde schon auf manche Indizien hin-
gewiesen, die dafür das VII. Jh. in Anspruch zu
nehmen einladen. Ihre Zahl läßt sich aber noch
vermehren. Vergoldete Bronzespangen von der
ihnen eigenen bestimmten Profilierung und mit
gepunzten Verzierungen begegnen an den Scheiteln
der Schildbuckel, wie sie namentlich aus lango-
bardischen Gräbern in oberitalischen Sammlungen
zahlreich vorliegen. Vor allem haben wir aber zu
fragen, welche Gegenstände in Begleitung der
Helme zutage gebracht worden sind. Es liegen
dafür aug'enblicklich nur zwei brauchbare Angaben
vor. Die eine betrifft den Vider Fund; die Lanzen-
spitzen, die dabei gelegen waren, entsprechen völlig
jenen, die man sonst aus Gräbern des VII. Jh.
gehoben hat, wenn sich auch eine engere Datie-
rung nicht daran knüpfen läßt; das Feuersteineisen
(Taf. IV 3) widerspricht wenigstens nicht diesem
allgemeinen Zeitansatze, während die römische
Fibel (Taf. IV 4) allerdings in einer viel früheren Zeit
entstanden war, was jedoch in germanischen Gräbern
bereits wiederholt beobachtet wurde. Sehr reiches
Fundmaterial hat sich aber um den Sigmaringer
Helm gruppiert, dessen Kenntnis an der Hand photo-
graphischer Aufnahmen der Verfasser Herrn Hof-
rat Gröbbels zu danken hat. Es begegnen darunter
bereits Gürtelzierden mit zoomorphisierten Band-
verschlingungen jenes „nordischen“ Charakters,
die in germanischen Gräbern vor dem VII. Jh.
mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden
sind. Ja man wäre versucht, ihre Entstehung viel-
mehr gegen das VIII. Jh. hinabzurücken. Jeden-
falls läßt es dieser Sigmaringer Gesamtfund als
ganz ausgeschlossen erscheinen, daß die Spangen-
helmgruppe, wie sie heute vorliegt, etwa noch in
die Zeit Justinians zurückreichen konnte.1)
In Bezug auf den Spangendekor zeigen sämt-
liche in Rede stehenden Helme eine solche Über-
einstimmung, daß von einer Verwertung ihrer
geringfügigen Unterschiede zur Herstellung einer
Entwicklungsreihe nicht die Rede sein kann. Da-
gegen lassen sich an den gestanzten Stirnbändern
einige augenfälligere Differenzen beobachten, die
nun noch zur Sprache gebracht sein mögen.
Fig. 221 Ornament vom Stirnbande des vierspangigen
Vider Helmes
Vor allen kann man die bisher bekannten
Helme darnach in mehrere Gruppen teilen. Die
erste Gruppe umfaßt die beidenVider (Fig. 221) und
den Baldenheimer Helm; ihre Stirnbänder zeichnen
sich dadurch aus, daß an ihren Verzierungen die
Nachwirkung antiker Dekorationsmotive verhältnis-
mäßig am deutlichsten vor Augen tritt. Zur zweiten
Gruppe zählen der Sigmaringer, Gültinger und
b Auf ein jüngeres Alter des Sigmaringer Fundes
gegenüber dem Vider weist auch der Umstand, daß die
mit dem ersten mitgefundene Brünne schmälere Ringe auf-
weist als die aus Vid stammende, von welcher bereits
oben die Rede gewesen war.
C. List Die Spangenhelme von Vid
268
mit jenem „pannonischen“ Helm einen St. Peters-
burger Helm mit sechsteiliger Kalotte in Verbin-
dung gebracht; die Annäherung an unsere Spangen-
helme ist da ganz evident, aber die einzelnen Teile
sind untereinander noch nicht völlig gleich groß
und — was wichtiger — sie stoßen einfach mit
ihren Rändern aneinander, ohne durch Spangen
verbunden zu sein, und geben sich so wenigstens
nach außen noch immer als eine einzige zusammen-
hängende Kalotte. Was dagegen unsere Gruppe
charakterisiert, ist jene bereits echt mittelalterliche
Scheidung in struktives Gerüst und dekorative
Füllungen, für die vielleicht keine bessere Ana-
logie gefunden werden könnte als die mittelalter-
lichen Gewölbe mit ihrer Trennung von Rippen
und Kappen. Daß diese Trennung an den Helmen
bereits am Anfänge des VII. Jh. vollzogen gewesen
sein muß, hat uns schon an früherer Stelle ein Blick
auf die sogenannte Agilulf-Platte in Florenz
gelehrt.
Unter unseren Helmen begegnen sowohl vier-
als sechsteilige. Da der Ausgang gewissermaßen
von zweiteiligen genommen worden war, möchte
man die ihnen näherstehenden vierteiligen für die
älteren halten. Damit wäre u. a. für einen der Vider
Helme (Taf. VII oben), der vierteilig ist und mit
dem zweiteiligen zusammen gefunden wurde, ein
höherer Altersrang gegeben.
Was nun die Entstehungszeit im allgemeinen
betrifft, so wurde schon auf manche Indizien hin-
gewiesen, die dafür das VII. Jh. in Anspruch zu
nehmen einladen. Ihre Zahl läßt sich aber noch
vermehren. Vergoldete Bronzespangen von der
ihnen eigenen bestimmten Profilierung und mit
gepunzten Verzierungen begegnen an den Scheiteln
der Schildbuckel, wie sie namentlich aus lango-
bardischen Gräbern in oberitalischen Sammlungen
zahlreich vorliegen. Vor allem haben wir aber zu
fragen, welche Gegenstände in Begleitung der
Helme zutage gebracht worden sind. Es liegen
dafür aug'enblicklich nur zwei brauchbare Angaben
vor. Die eine betrifft den Vider Fund; die Lanzen-
spitzen, die dabei gelegen waren, entsprechen völlig
jenen, die man sonst aus Gräbern des VII. Jh.
gehoben hat, wenn sich auch eine engere Datie-
rung nicht daran knüpfen läßt; das Feuersteineisen
(Taf. IV 3) widerspricht wenigstens nicht diesem
allgemeinen Zeitansatze, während die römische
Fibel (Taf. IV 4) allerdings in einer viel früheren Zeit
entstanden war, was jedoch in germanischen Gräbern
bereits wiederholt beobachtet wurde. Sehr reiches
Fundmaterial hat sich aber um den Sigmaringer
Helm gruppiert, dessen Kenntnis an der Hand photo-
graphischer Aufnahmen der Verfasser Herrn Hof-
rat Gröbbels zu danken hat. Es begegnen darunter
bereits Gürtelzierden mit zoomorphisierten Band-
verschlingungen jenes „nordischen“ Charakters,
die in germanischen Gräbern vor dem VII. Jh.
mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden
sind. Ja man wäre versucht, ihre Entstehung viel-
mehr gegen das VIII. Jh. hinabzurücken. Jeden-
falls läßt es dieser Sigmaringer Gesamtfund als
ganz ausgeschlossen erscheinen, daß die Spangen-
helmgruppe, wie sie heute vorliegt, etwa noch in
die Zeit Justinians zurückreichen konnte.1)
In Bezug auf den Spangendekor zeigen sämt-
liche in Rede stehenden Helme eine solche Über-
einstimmung, daß von einer Verwertung ihrer
geringfügigen Unterschiede zur Herstellung einer
Entwicklungsreihe nicht die Rede sein kann. Da-
gegen lassen sich an den gestanzten Stirnbändern
einige augenfälligere Differenzen beobachten, die
nun noch zur Sprache gebracht sein mögen.
Fig. 221 Ornament vom Stirnbande des vierspangigen
Vider Helmes
Vor allen kann man die bisher bekannten
Helme darnach in mehrere Gruppen teilen. Die
erste Gruppe umfaßt die beidenVider (Fig. 221) und
den Baldenheimer Helm; ihre Stirnbänder zeichnen
sich dadurch aus, daß an ihren Verzierungen die
Nachwirkung antiker Dekorationsmotive verhältnis-
mäßig am deutlichsten vor Augen tritt. Zur zweiten
Gruppe zählen der Sigmaringer, Gültinger und
b Auf ein jüngeres Alter des Sigmaringer Fundes
gegenüber dem Vider weist auch der Umstand, daß die
mit dem ersten mitgefundene Brünne schmälere Ringe auf-
weist als die aus Vid stammende, von welcher bereits
oben die Rede gewesen war.