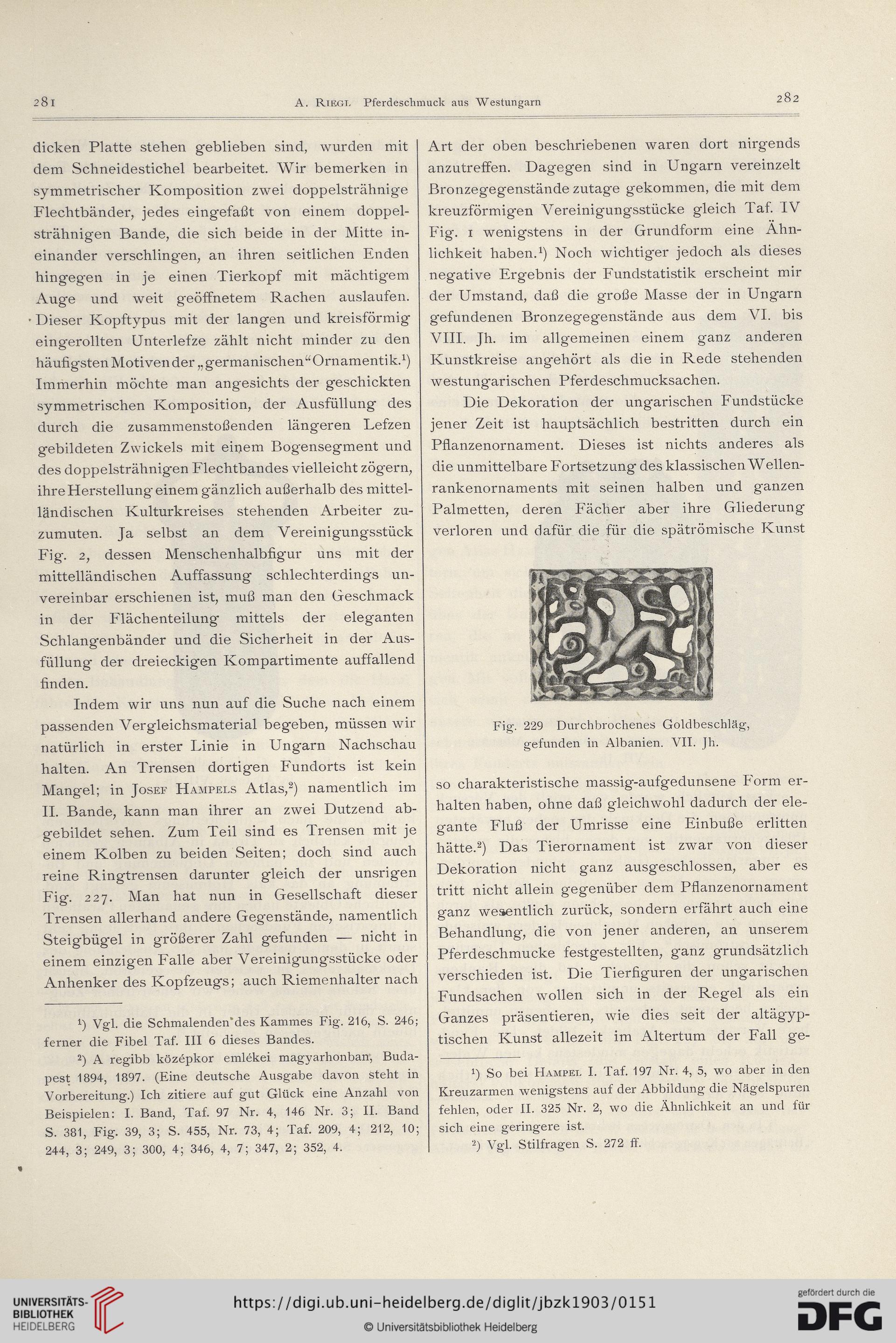281
282
A. Riegt. Pferdeschmuck aus Westungarn
dicken Platte stehen geblieben sind, wurden mit
dem Schneidestichel bearbeitet. Wir bemerken in
symmetrischer Komposition zwei doppelsträhnige
Flechtbänder, jedes eingefaßt von einem doppel-
strähnigen Bande, die sich beide in der Mitte in-
einander verschlingen, an ihren seitlichen Enden
hingegen in je einen Tierkopf mit mächtigem
Auge und weit geöffnetem Rachen auslaufen.
Dieser Kopftypus mit der langen und kreisförmig
eingerollten Unterlefze zählt nicht minder zu den
häufigsten Motiven der „ germanischen u Ornamentik.1)
Immerhin möchte man angesichts der geschickten
symmetrischen Komposition, der Ausfüllung des
durch die zusammenstoßenden längeren Lefzen
gebildeten Zwickels mit einem Bogensegment und
des doppelsträhnigen Flechtbandes vielleicht zögern,
ihre Herstellung einem gänzlich außerhalb des mittel-
ländischen Kulturkreises stehenden Arbeiter zu-
zumuten. Ja selbst an dem Vereinigungsstück
Fig. 2, dessen Menschenhalbfig'ur uns mit der
mittelländischen Auffassung schlechterdings un-
vereinbar erschienen ist, muß man den Geschmack
in der Flächenteilung mittels der eleganten
Schlang’enbänder und die Sicherheit in der Aus-
füllung der dreieckigen Kompartimente auffallend
finden.
Indem wir uns nun auf die Suche nach einem
passenden Vergleichsmaterial begeben, müssen wir
natürlich in erster Linie in Ungarn Nachschau
halten. An Trensen dortigen Fundorts ist kein
Mangel; in Josef Hampels Atlas,2) namentlich im
II. Bande, kann man ihrer an zwei Dutzend ab-
gebildet sehen. Zum Teil sind es Trensen mit je
einem Kolben zu beiden Seiten; doch sind auch
reine Ringtrensen darunter gleich der unsrigen
Fig. 227. Man hat nun in Gesellschaft dieser
Trensen allerhand andere Gegenstände, namentlich
Steigbüg'el in größerer Zahl gefunden — nicht in
einem einzigen Falle aber Vereinigungsstücke oder
Anhenker des Kopfzeugs; auch Riemenhalter nach
b Vgl. die Schmalenden des Kammes Fig. 216, S. 246;
ferner die Fibel Taf. III 6 dieses Bandes.
2) A regibb közepkor emlekei magyarhonban, Buda-
pest 1894, 1897. (Eine deutsche Ausgabe davon steht in
Vorbereitung.) Ich zitiere auf gut Glück eine Anzahl von
Beispielen: I. Band, Taf. 97 Nr. 4, 146 Nr. 3; II. Band
S. 381, Fig. 39, 3; S. 455, Nr. 73, 4; Taf. 209, 4; 212, 10;
244, 3; 249, 3; 300, 4; 346, 4, 7; 347, 2; 352, 4.
Art der oben beschriebenen waren dort nirgends
anzutreffen. Dagegen sind in Ungarn vereinzelt
Bronzegegenstände zutage gekommen, die mit dem
kreuzförmigen Vereinigungsstücke gleich Taf. IV
Fig. 1 wenigstens in der Grundform eine Ähn-
lichkeit haben.1) Noch wichtig’er jedoch als dieses
negative Ergebnis der Fundstatistik erscheint mir
der Umstand, daß die große Masse der in Ungarn
gefundenen Bronzegegenstände aus dem VI. bis
VIII. Jh. im allgemeinen einem ganz anderen
Kunstkreise angehört als die in Rede stehenden
westungarischen Pferdeschmucksachen.
Die Dekoration der ungarischen Fundstücke
jener Zeit ist hauptsächlich bestritten durch ein
Pflanzenornament. Dieses ist nichts anderes als
die unmittelbare Fortsetzung des klassischen Wellen-
rankenornaments mit seinen halben und ganzen
Palmetten, deren Fächer aber ihre Gliederung
verloren und dafür die für die spätrömische Kunst
Fig. 229 Durchbrochenes Goldbeschläg,
gefunden in Albanien. VII. Jh.
so charakteristische massig-aufgedunsene Form er-
halten haben, ohne daß gleichwohl dadurch der ele-
gante Fluß der Umrisse eine Einbuße erlitten
hätte.2) Das Tierornament ist zwar von dieser
Dekoration nicht ganz ausgeschlossen, aber es
tritt nicht allein gegenüber dem Pflanzenornament
ganz wesentlich zurück, sondern erfährt auch eine
Behandlung, die von jener anderen, an unserem
Pferdeschmucke festgestellten, ganz grundsätzlich
verschieden ist. Die Tierfiguren der ungarischen
Fundsachen wollen sich in der Regel als ein
Ganzes präsentieren, wie dies seit der altägyp-
tischen Kunst allezeit im Altertum der Fall ge-
b So bei Hampet. I. Taf. 197 Nr. 4, 5, wo aber in den
Kreuzarmen wenigstens auf der Abbildung die Nägelspuren
fehlen, oder II. 325 Nr. 2, wo die Ähnlichkeit an und für
sich eine geringere ist.
2) Vgl. Stilfragen S. 272 ff.
282
A. Riegt. Pferdeschmuck aus Westungarn
dicken Platte stehen geblieben sind, wurden mit
dem Schneidestichel bearbeitet. Wir bemerken in
symmetrischer Komposition zwei doppelsträhnige
Flechtbänder, jedes eingefaßt von einem doppel-
strähnigen Bande, die sich beide in der Mitte in-
einander verschlingen, an ihren seitlichen Enden
hingegen in je einen Tierkopf mit mächtigem
Auge und weit geöffnetem Rachen auslaufen.
Dieser Kopftypus mit der langen und kreisförmig
eingerollten Unterlefze zählt nicht minder zu den
häufigsten Motiven der „ germanischen u Ornamentik.1)
Immerhin möchte man angesichts der geschickten
symmetrischen Komposition, der Ausfüllung des
durch die zusammenstoßenden längeren Lefzen
gebildeten Zwickels mit einem Bogensegment und
des doppelsträhnigen Flechtbandes vielleicht zögern,
ihre Herstellung einem gänzlich außerhalb des mittel-
ländischen Kulturkreises stehenden Arbeiter zu-
zumuten. Ja selbst an dem Vereinigungsstück
Fig. 2, dessen Menschenhalbfig'ur uns mit der
mittelländischen Auffassung schlechterdings un-
vereinbar erschienen ist, muß man den Geschmack
in der Flächenteilung mittels der eleganten
Schlang’enbänder und die Sicherheit in der Aus-
füllung der dreieckigen Kompartimente auffallend
finden.
Indem wir uns nun auf die Suche nach einem
passenden Vergleichsmaterial begeben, müssen wir
natürlich in erster Linie in Ungarn Nachschau
halten. An Trensen dortigen Fundorts ist kein
Mangel; in Josef Hampels Atlas,2) namentlich im
II. Bande, kann man ihrer an zwei Dutzend ab-
gebildet sehen. Zum Teil sind es Trensen mit je
einem Kolben zu beiden Seiten; doch sind auch
reine Ringtrensen darunter gleich der unsrigen
Fig. 227. Man hat nun in Gesellschaft dieser
Trensen allerhand andere Gegenstände, namentlich
Steigbüg'el in größerer Zahl gefunden — nicht in
einem einzigen Falle aber Vereinigungsstücke oder
Anhenker des Kopfzeugs; auch Riemenhalter nach
b Vgl. die Schmalenden des Kammes Fig. 216, S. 246;
ferner die Fibel Taf. III 6 dieses Bandes.
2) A regibb közepkor emlekei magyarhonban, Buda-
pest 1894, 1897. (Eine deutsche Ausgabe davon steht in
Vorbereitung.) Ich zitiere auf gut Glück eine Anzahl von
Beispielen: I. Band, Taf. 97 Nr. 4, 146 Nr. 3; II. Band
S. 381, Fig. 39, 3; S. 455, Nr. 73, 4; Taf. 209, 4; 212, 10;
244, 3; 249, 3; 300, 4; 346, 4, 7; 347, 2; 352, 4.
Art der oben beschriebenen waren dort nirgends
anzutreffen. Dagegen sind in Ungarn vereinzelt
Bronzegegenstände zutage gekommen, die mit dem
kreuzförmigen Vereinigungsstücke gleich Taf. IV
Fig. 1 wenigstens in der Grundform eine Ähn-
lichkeit haben.1) Noch wichtig’er jedoch als dieses
negative Ergebnis der Fundstatistik erscheint mir
der Umstand, daß die große Masse der in Ungarn
gefundenen Bronzegegenstände aus dem VI. bis
VIII. Jh. im allgemeinen einem ganz anderen
Kunstkreise angehört als die in Rede stehenden
westungarischen Pferdeschmucksachen.
Die Dekoration der ungarischen Fundstücke
jener Zeit ist hauptsächlich bestritten durch ein
Pflanzenornament. Dieses ist nichts anderes als
die unmittelbare Fortsetzung des klassischen Wellen-
rankenornaments mit seinen halben und ganzen
Palmetten, deren Fächer aber ihre Gliederung
verloren und dafür die für die spätrömische Kunst
Fig. 229 Durchbrochenes Goldbeschläg,
gefunden in Albanien. VII. Jh.
so charakteristische massig-aufgedunsene Form er-
halten haben, ohne daß gleichwohl dadurch der ele-
gante Fluß der Umrisse eine Einbuße erlitten
hätte.2) Das Tierornament ist zwar von dieser
Dekoration nicht ganz ausgeschlossen, aber es
tritt nicht allein gegenüber dem Pflanzenornament
ganz wesentlich zurück, sondern erfährt auch eine
Behandlung, die von jener anderen, an unserem
Pferdeschmucke festgestellten, ganz grundsätzlich
verschieden ist. Die Tierfiguren der ungarischen
Fundsachen wollen sich in der Regel als ein
Ganzes präsentieren, wie dies seit der altägyp-
tischen Kunst allezeit im Altertum der Fall ge-
b So bei Hampet. I. Taf. 197 Nr. 4, 5, wo aber in den
Kreuzarmen wenigstens auf der Abbildung die Nägelspuren
fehlen, oder II. 325 Nr. 2, wo die Ähnlichkeit an und für
sich eine geringere ist.
2) Vgl. Stilfragen S. 272 ff.