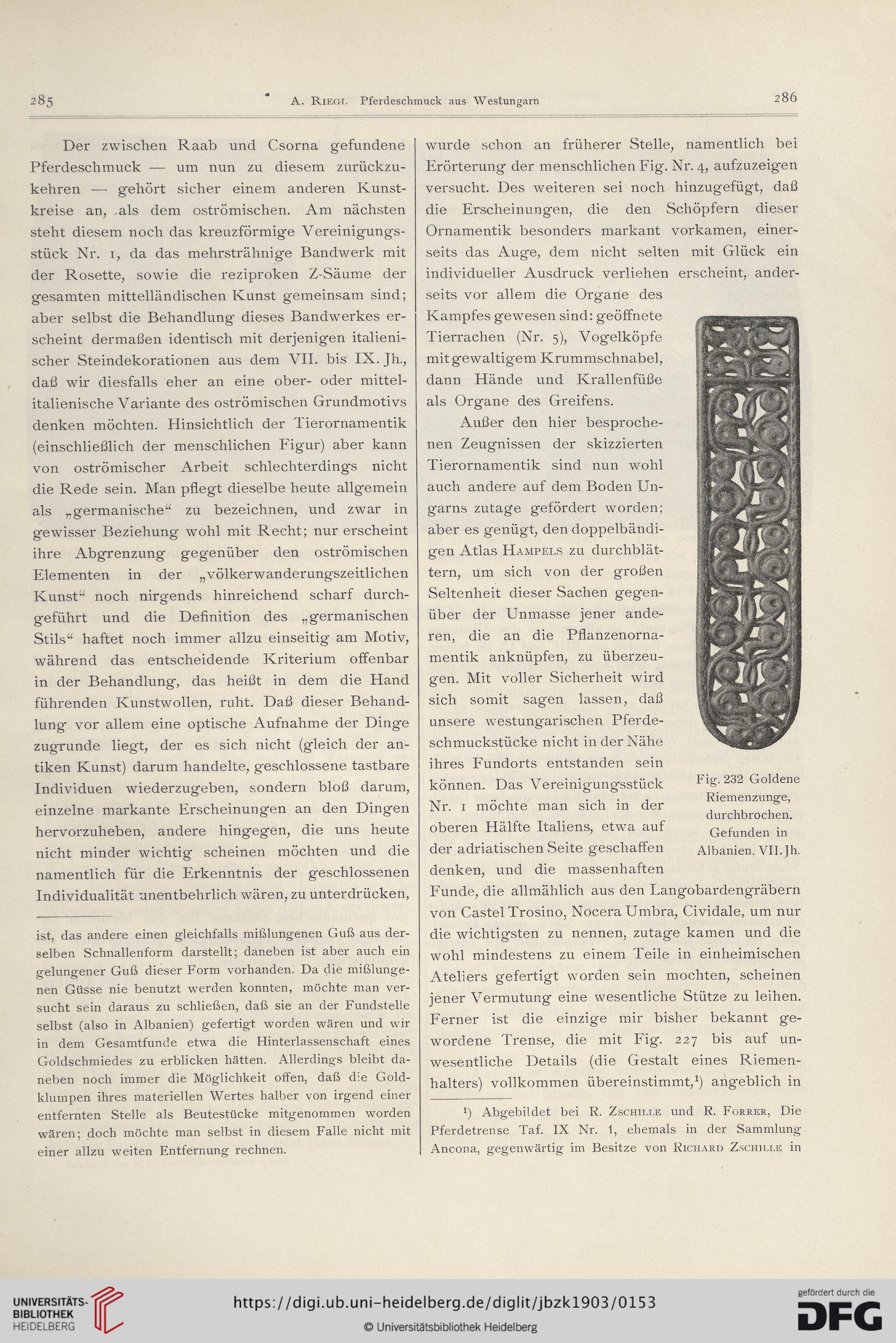A. Riegl Pferdeschmuck aus Westungarn
286
Der zwischen Raab und Csorna gefundene
Pferdeschmuck — um nun zu diesem zurückzu-
kehren — gehört sicher einem anderen Kunst-
kreise an, als dem oströmischen. Am nächsten
steht diesem noch das kreuzförmige Vereinigungs-
stück Nr. 1, da das mehrsträhnige Bandwerk mit
der Rosette, sowie die reziproken Z-Säume der
gesamten mittelländischen Kunst gemeinsam sind;
aber selbst die Behandlung- dieses Bandwerkes er-
scheint dermaßen identisch mit derjenigen italieni-
scher Steindekorationen aus dem VII. bis IX. Jh.,
daß wir diesfalls eher an eine ober- oder mittel-
italienische Variante des oströmischen Grundmotivs
denken möchten. Hinsichtlich der Tierornamentik
(einschließlich der menschlichen Figur) aber kann
von oströmischer Arbeit schlechterding-s nicht
die Rede sein. Man pflegt dieselbe heute allgemein
als „germanische“ zu bezeichnen, und zwar in
gewisser Beziehung wohl mit Recht; nur erscheint
ihre Abgrenzung gegenüber den oströmischen
Elementen in der „völkerwanderungszeitlichen
Kunst“ noch nirgends hinreichend scharf durch-
geführt und die Definition des „germanischen
Stils“ haftet noch immer allzu einseitig am Motiv,
während das entscheidende Kriterium offenbar
in der Behandlung, das heißt in dem die Hand
führenden Kunstwollen, ruht. Daß dieser Behand-
lung- vor allem eine optische Aufnahme der Dinge
zugrunde liegt, der es sich nicht (gleich der an-
tiken Kunst) darum handelte, geschlossene tastbare
Individuen wiederzugeben, sondern bloß darum,
einzelne markante Erscheinungen an den Dingen
hervorzuheben, andere hingegen, die uns heute
nicht minder wichtig scheinen möchten und die
namentlich für die Erkenntnis der geschlossenen
Individualität unentbehrlich wären, zu unterdrücken,
ist, das andere einen gleichfalls mißlungenen Guß aus der-
selben Schnallenform darstellt; daneben ist aber auch ein
gelungener Guß dieser Form vorhanden. Da die mißlunge-
nen Güsse nie benutzt werden konnten, möchte man ver-
sucht sein daraus zu schließen, daß sie an der Fundstelle
selbst (also in Albanien) gefertigt worden wären und wir
in dem Gesamtfunde etwa die Hinterlassenschaft eines
Goldschmiedes zu erblicken hätten. Allerdings bleibt da-
neben noch immer die Möglichkeit offen, daß die Gold-
klumpen ihres materiellen Wertes halber von irgend einer
entfernten Stelle als Beutestücke mitgenommen worden
wären; doch möchte man selbst in diesem Falle nicht mit
einer allzu weiten Entfernung rechnen.
wurde schon an früherer Stelle, namentlich bei
Erörterung der menschlichen Fig. Nr. 4, aufzuzeigen
versucht. Des weiteren sei noch hinzugefügt, daß
die Erscheinungen, die den Schöpfern dieser
Ornamentik besonders markant vorkamen, einer-
seits das Auge, dem nicht selten mit Glück ein
individueller Ausdruck verliehen
seits vor allem die Organe des
Kampfes gewesen sind: geöffnete
Tierrachen (Nr. 5), Vogelköpfe
mit gewaltigem Krummschnabel,
dann Hände und Krallenfüße
als Organe des Greifens.
Außer den hier besproche¬
nen Zeugnissen der skizzierten
Tierornamentik sind nun wohl
auch andere auf dem Boden Un¬
garns zutage gefördert worden;
aber es genügt, den doppelbändi¬
gen Atlas Hampels zu durchblät¬
tern, um sich von der großen
Seltenheit dieser Sachen gegen¬
über der Unmasse jener ande¬
ren, die an die Pflanzenorna¬
mentik anknüpfen, zu überzeu¬
gen. Mit voller Sicherheit wird
sich somit sagen lassen, daß
unsere westungarischen Pferde¬
schmuckstücke nicht in der Nähe
ihres Fundorts entstanden sein
können. Das Vereinigungsstück
Nr. 1 möchte man sich in der
oberen Hälfte Italiens, etwa auf
der adriatischen Seite geschaffen
denken, und die massenhaften
Funde, die allmählich aus den Langobardengräbern
von Castel Trosino, Nocera Umbra, Cividale, um nur
die wichtigsten zu nennen, zutage kamen und die
wohl mindestens zu einem Teile in einheimischen
Ateliers gefertigt worden sein mochten, scheinen
jener Vermutung eine wesentliche Stütze zu leihen.
Ferner ist die einzige mir bisher bekannt ge-
wordene Trense, die mit Fig. 227 bis auf un-
wesentliche Details (die Gestalt eines Riemen-
halters) vollkommen übereinstimmt,1) angeblich in
*) Abgebildet bei R. Zschilt.e und R. Forrer, Die
Pferdetrense Taf. IX Nr. 1, ehemals in der Sammlung
Ancona, gegenwärtig im Besitze von Richard Zschilt.e in
erscheint, ander-
Fig. 232 Goldene
Riemenzunge,
durchbrochen.
Gefunden in
Albanien. VII. Jh.
286
Der zwischen Raab und Csorna gefundene
Pferdeschmuck — um nun zu diesem zurückzu-
kehren — gehört sicher einem anderen Kunst-
kreise an, als dem oströmischen. Am nächsten
steht diesem noch das kreuzförmige Vereinigungs-
stück Nr. 1, da das mehrsträhnige Bandwerk mit
der Rosette, sowie die reziproken Z-Säume der
gesamten mittelländischen Kunst gemeinsam sind;
aber selbst die Behandlung- dieses Bandwerkes er-
scheint dermaßen identisch mit derjenigen italieni-
scher Steindekorationen aus dem VII. bis IX. Jh.,
daß wir diesfalls eher an eine ober- oder mittel-
italienische Variante des oströmischen Grundmotivs
denken möchten. Hinsichtlich der Tierornamentik
(einschließlich der menschlichen Figur) aber kann
von oströmischer Arbeit schlechterding-s nicht
die Rede sein. Man pflegt dieselbe heute allgemein
als „germanische“ zu bezeichnen, und zwar in
gewisser Beziehung wohl mit Recht; nur erscheint
ihre Abgrenzung gegenüber den oströmischen
Elementen in der „völkerwanderungszeitlichen
Kunst“ noch nirgends hinreichend scharf durch-
geführt und die Definition des „germanischen
Stils“ haftet noch immer allzu einseitig am Motiv,
während das entscheidende Kriterium offenbar
in der Behandlung, das heißt in dem die Hand
führenden Kunstwollen, ruht. Daß dieser Behand-
lung- vor allem eine optische Aufnahme der Dinge
zugrunde liegt, der es sich nicht (gleich der an-
tiken Kunst) darum handelte, geschlossene tastbare
Individuen wiederzugeben, sondern bloß darum,
einzelne markante Erscheinungen an den Dingen
hervorzuheben, andere hingegen, die uns heute
nicht minder wichtig scheinen möchten und die
namentlich für die Erkenntnis der geschlossenen
Individualität unentbehrlich wären, zu unterdrücken,
ist, das andere einen gleichfalls mißlungenen Guß aus der-
selben Schnallenform darstellt; daneben ist aber auch ein
gelungener Guß dieser Form vorhanden. Da die mißlunge-
nen Güsse nie benutzt werden konnten, möchte man ver-
sucht sein daraus zu schließen, daß sie an der Fundstelle
selbst (also in Albanien) gefertigt worden wären und wir
in dem Gesamtfunde etwa die Hinterlassenschaft eines
Goldschmiedes zu erblicken hätten. Allerdings bleibt da-
neben noch immer die Möglichkeit offen, daß die Gold-
klumpen ihres materiellen Wertes halber von irgend einer
entfernten Stelle als Beutestücke mitgenommen worden
wären; doch möchte man selbst in diesem Falle nicht mit
einer allzu weiten Entfernung rechnen.
wurde schon an früherer Stelle, namentlich bei
Erörterung der menschlichen Fig. Nr. 4, aufzuzeigen
versucht. Des weiteren sei noch hinzugefügt, daß
die Erscheinungen, die den Schöpfern dieser
Ornamentik besonders markant vorkamen, einer-
seits das Auge, dem nicht selten mit Glück ein
individueller Ausdruck verliehen
seits vor allem die Organe des
Kampfes gewesen sind: geöffnete
Tierrachen (Nr. 5), Vogelköpfe
mit gewaltigem Krummschnabel,
dann Hände und Krallenfüße
als Organe des Greifens.
Außer den hier besproche¬
nen Zeugnissen der skizzierten
Tierornamentik sind nun wohl
auch andere auf dem Boden Un¬
garns zutage gefördert worden;
aber es genügt, den doppelbändi¬
gen Atlas Hampels zu durchblät¬
tern, um sich von der großen
Seltenheit dieser Sachen gegen¬
über der Unmasse jener ande¬
ren, die an die Pflanzenorna¬
mentik anknüpfen, zu überzeu¬
gen. Mit voller Sicherheit wird
sich somit sagen lassen, daß
unsere westungarischen Pferde¬
schmuckstücke nicht in der Nähe
ihres Fundorts entstanden sein
können. Das Vereinigungsstück
Nr. 1 möchte man sich in der
oberen Hälfte Italiens, etwa auf
der adriatischen Seite geschaffen
denken, und die massenhaften
Funde, die allmählich aus den Langobardengräbern
von Castel Trosino, Nocera Umbra, Cividale, um nur
die wichtigsten zu nennen, zutage kamen und die
wohl mindestens zu einem Teile in einheimischen
Ateliers gefertigt worden sein mochten, scheinen
jener Vermutung eine wesentliche Stütze zu leihen.
Ferner ist die einzige mir bisher bekannt ge-
wordene Trense, die mit Fig. 227 bis auf un-
wesentliche Details (die Gestalt eines Riemen-
halters) vollkommen übereinstimmt,1) angeblich in
*) Abgebildet bei R. Zschilt.e und R. Forrer, Die
Pferdetrense Taf. IX Nr. 1, ehemals in der Sammlung
Ancona, gegenwärtig im Besitze von Richard Zschilt.e in
erscheint, ander-
Fig. 232 Goldene
Riemenzunge,
durchbrochen.
Gefunden in
Albanien. VII. Jh.